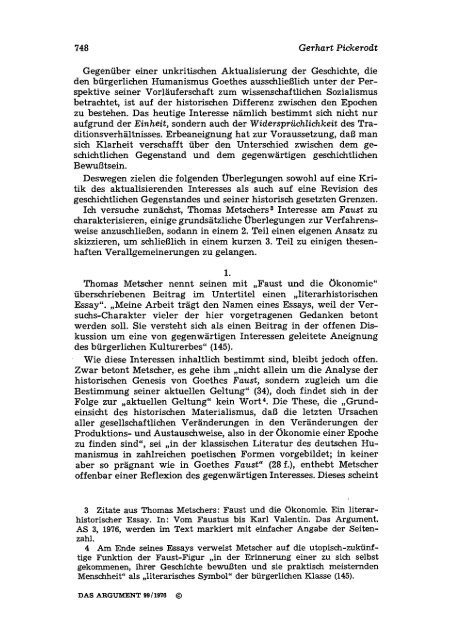Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
748 Gerhart Pickerodt<br />
Gegenüber einer un<strong>kritische</strong>n Aktualisierung der Geschichte, die<br />
den bürgerlichen Humanismus Goethes ausschließlich unter der Perspektive<br />
seiner Vorläuferschaft zum wissenschaftlichen Sozialismus<br />
betrachtet, ist auf der historischen Differenz zwischen den Epochen<br />
zu bestehen. <strong>Das</strong> heutige Interesse nämlich bestimmt sich nicht nur<br />
aufgrund der Einheit, sondern auch der Widersprüchlichkeit des Traditionsverhältnisses.<br />
Erbeaneignung hat zur Voraussetzung, daß man<br />
sich Klarheit verschafft über den Unterschied zwischen dem geschichtlichen<br />
Gegenstand und dem gegenwärtigen geschichtlichen<br />
Bewußtsein.<br />
Deswegen zielen die folgenden Überlegungen sowohl auf eine Kritik<br />
des aktualisierenden Interesses als auch auf eine Revision des<br />
geschichtlichen Gegenstandes und seiner historisch gesetzten Grenzen.<br />
Ich versuche zunächst, Thomas Metschers 3 Interesse am Faust zu<br />
charakterisieren, einige grundsätzliche Überlegungen zur Verfahrensweise<br />
anzuschließen, sodann in einem 2. Teil einen eigenen Ansatz zu<br />
skizzieren, um schließlich in einem kurzen 3. Teil zu einigen thesenhaften<br />
Verallgemeinerungen zu gelangen.<br />
1.<br />
Thomas Metscher nennt seinen mit „Faust und die Ökonomie"<br />
überschriebenen Beitrag im Untertitel einen „literarhistorischen<br />
Essay". „Meine Arbeit trägt den Namen eines Essays, weil der Versuchs-Charakter<br />
vieler der hier vorgetragenen Gedanken betont<br />
werden soll. Sie versteht sich als einen Beitrag in der offenen Diskussion<br />
um eine von gegenwärtigen Interessen geleitete Aneignung<br />
des bürgerlichen Kulturerbes" (145).<br />
Wie diese Interessen inhaltlich bestimmt sind, bleibt jedoch offen.<br />
Zwar betont Metscher, es gehe ihm „nicht allein um die Analyse der<br />
historischen Genesis von Goethes Faust, sondern zugleich um die<br />
Bestimmung seiner aktuellen Geltung" (34), doch findet sich in der<br />
Folge zur „aktuellen Geltung" kein Wort 4 . Die These, die „Grundeinsicht<br />
des historischen Materialismus, daß die letzten Ursachen<br />
aller gesellschaftlichen Veränderungen in den Veränderungen der<br />
Produktions- und Austauschweise, also in der Ökonomie einer Epoche<br />
zu finden sind", sei „in der klassischen Literatur des deutschen Humanismus<br />
in zahlreichen poetischen Formen vorgebildet; in keiner<br />
aber so prägnant wie in Goethes Faust" (28 f.), enthebt Metscher<br />
offenbar einer Reflexion des gegenwärtigen Interesses. Dieses scheint<br />
3 Zitate aus Thomas Metschers: Faust und die Ökonomie. Ein literarhistorischer<br />
Essay. In: Vom Faustus bis Karl Valentin. <strong>Das</strong> <strong>Argument</strong>.<br />
AS 3, 1976, werden im Text markiert mit einfacher Angabe der Seitenzahl.<br />
4 Am Ende seines Essays verweist Metscher auf die utopisch-zukünftige<br />
Funktion der Faust-Figur „in der Erinnerung einer zu sich selbst<br />
gekommenen, ihrer Geschichte bewußten und sie praktisch meisternden<br />
Menschheit" als „literarisches Symbol" der bürgerlichen Klasse (145).<br />
DAS A R G U M E N T <strong>99</strong>/1976 ©