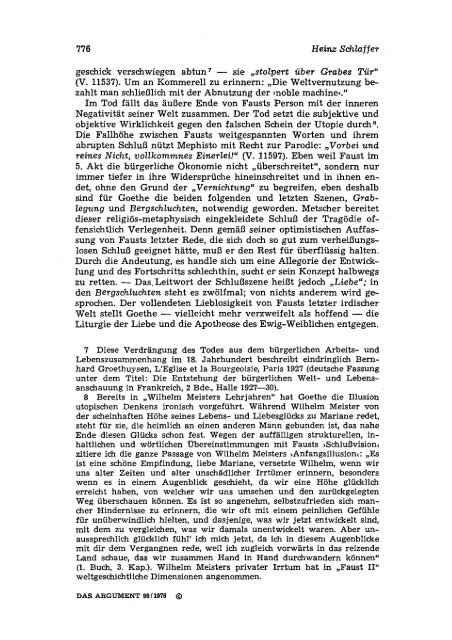Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
776 Heinz Schlaffer<br />
geschick verschwiegen abtun 7 — sie „stolpert über Grabes Tür"<br />
(V. 11537). Um an Kommereil zu erinnern: „Die Weltvernutzung bezahlt<br />
man schließlich mit der Abnutzung der >noble machine«."<br />
Im Tod fällt das äußere Ende von Fausts Person mit der inneren<br />
Negativität seiner Welt zusammen. Der Tod setzt die subjektive und<br />
objektive Wirklichkeit gegen den falschen Schein der Utopie durch 8 .<br />
Die Fallhöhe zwischen Fausts weitgespannten Worten und ihrem<br />
abrupten Schluß nützt Mephisto mit Recht zur Parodie: „Vorbei und<br />
reines Nicht, vollkommnes Einerlei!" (V. 11597). Eben weil Faust im<br />
5. Akt die bürgerliche Ökonomie nicht „überschreitet", sondern nur<br />
immer tiefer in ihre Widersprüche hineinschreitet und in ihnen endet,<br />
ohne den Grund der „Vernichtung" zu begreifen, eben deshalb<br />
sind <strong>für</strong> Goethe die beiden folgenden und letzten Szenen, Grablegung<br />
und Bergschluchten, notwendig geworden. Metscher bereitet<br />
dieser religiös-metaphysisch eingekleidete Schluß der Tragödie offensichtlich<br />
Verlegenheit. Denn gemäß seiner optimistischen Auffassung<br />
von Fausts letzter Rede, die sich doch so gut zum verheißungslosen<br />
Schluß geeignet hätte, muß er den Rest <strong>für</strong> überflüssig halten.<br />
Durch die Andeutung, es handle sich um eine Allegorie der Entwicklung<br />
und des Fortschritts schlechthin, sucht er sein Konzept halbwegs<br />
zu retten. — <strong>Das</strong>. Leitwort der Schlußszene heißt jedoch „Liebe"; in<br />
den Bergschluchten steht es zwölfmal; von nichts anderem wird gesprochen.<br />
Der vollendeten Lieblosigkeit von Fausts letzter irdischer<br />
Welt stellt Goethe — vielleicht mehr verzweifelt als hoffend — die<br />
Liturgie der Liebe und die Apotheose des Ewig-Weiblichen entgegen.<br />
7 Diese Verdrängung des Todes aus dem bürgerlichen Arbeits- und<br />
Lebenszusammenhang im 18. Jahrhundert beschreibt eindringlich Bernhard<br />
Groethuysen, L'Eglise et la Bourgeoisie, Paris 1927 (deutsche Fassung<br />
unter dem Titel: Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung<br />
in Frankreich, 2 Bde., Halle 1927—30).<br />
8 Bereits in „Wilhelm Meisters Lehrjahren" hat Goethe die Illusion<br />
utopischen Denkens ironisch vorgeführt. Während Wilhelm Meister von<br />
der scheinhaften Höhe seines Lebens- und Liebesglücks zu Mariane redet,<br />
steht <strong>für</strong> sie, die heimlich an einen anderen Mann gebunden ist, das nahe<br />
Ende diesen Glücks schon fest. Wegen der auffälligen strukturellen, inhaltlichen<br />
und wörtlichen Ubereinstimmungen mit Fausts >Schlußvision<<br />
zitiere ich die ganze Passage von Wilhelm Meisters >Anfangsillusion