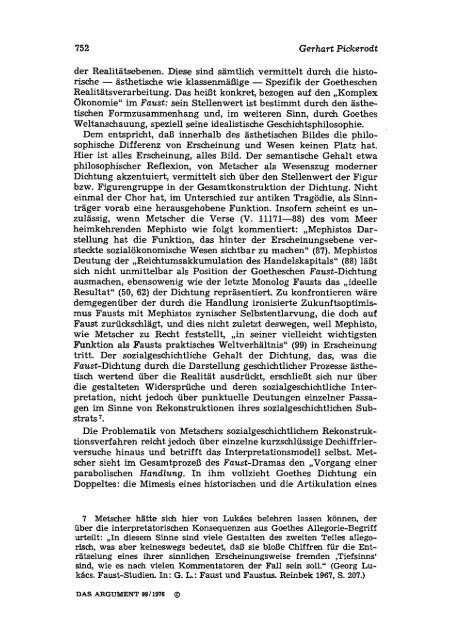Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 99 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
752 Gerhart Pickerodt<br />
der Realitätsebenen. Diese sind sämtlich vermittelt durch die historische<br />
— ästhetische wie klassenmäßige — Spezifik der Goetheschen<br />
Realitätsverarbeitimg. <strong>Das</strong> heißt konkret, bezogen auf den „Komplex<br />
Ökonomie" im Faust: sein Stellenwert ist bestimmt durch den ästhetischen<br />
Formzusammenhang und, im weiteren Sinn, durch Goethes<br />
Weltanschauung, speziell seine idealistische Geschichtsphilosophie.<br />
Dem entspricht, daß innerhalb des ästhetischen Bildes die philosophische<br />
Differenz von Erscheinung und Wesen keinen Platz hat.<br />
Hier ist alles Erscheinung, alles Bild. Der semantische Gehalt etwa<br />
philosophischer Reflexion, von Metscher als Wesenszug moderner<br />
Dichtung akzentuiert, vermittelt sich über den Stellenwert der Figur<br />
bzw. Figurengruppe in der Gesamtkonstruktion der Dichtung. Nicht<br />
einmal der Chor hat, im Unterschied zur antiken Tragödie, als Sinnträger<br />
vorab eine herausgehobene Funktion. Insofern scheint es unzulässig,<br />
wenn Metscher die Verse (V. 11171—88) des vom Meer<br />
heimkehrenden Mephisto wie folgt kommentiert: „Mephistos Darstellung<br />
hat die Funktion, das hinter der Erscheinungsebene versteckte<br />
sozialökonomische Wesen sichtbar zu machen" (87). Mephistos<br />
Deutung der „Reichtumsakkumulation des Handelskapitals" (88) läßt<br />
sich nicht unmittelbar als Position der Goetheschen Faust-Dichtung<br />
ausmachen, ebensowenig wie der letzte Monolog Fausts das „ideelle<br />
Resultat" (50, 62) der Dichtung repräsentiert. Zu konfrontieren wäre<br />
demgegenüber der durch die Handlung ironisierte Zukunftsoptimismus<br />
Fausts mit Mephistos zynischer Selbstentlarvung, die doch auf<br />
Faust zurückschlägt, und dies nicht zuletzt deswegen, weil Mephisto,<br />
wie Metscher zu Recht feststellt, „in seiner vielleicht wichtigsten<br />
Funktion als Fausts praktisches Weltverhältnis" (<strong>99</strong>) in Erscheinung<br />
tritt. Der sozialgeschichtliche Gehalt der Dichtung, das, was die<br />
Faust-Dichtung durch die Darstellung geschichtlicher Prozesse ästhetisch<br />
wertend über die Realität ausdrückt, erschließt sich nur über<br />
die gestalteten Widersprüche und deren sozialgeschichtliche Interpretation,<br />
nicht jedoch über punktuelle Deutungen einzelner Passagen<br />
im Sinne von Rekonstruktionen ihres sozialgeschichtlichen Substrats<br />
7 .<br />
Die Problematik von Metschers sozialgeschichtlichem Rekonstruktionsverfahren<br />
reicht jedoch über einzelne kurzschlüssige Dechiffrierversuche<br />
hinaus und betrifft das Interpretationsmodell selbst. Metscher<br />
sieht im Gesamtprozeß des Faust-Dramas den „Vorgang einer<br />
parabolischen Handlung. In ihm vollzieht Goethes Dichtung ein<br />
Doppeltes: die Mimesis eines historischen und die Artikulation eines<br />
7 Metscher hätte sich hier von Lukâcs belehren lassen können, der<br />
über die interpretatorischen Konsequenzen aus Goethes Allegorie-Begriff<br />
urteilt: „In diesem Sinne sind viele Gestalten des zweiten Teiles allegorisch,<br />
was aber keineswegs bedeutet, daß sie bloße Chiffren <strong>für</strong> die Enträtselung<br />
eines ihrer sinnlichen Erscheinungsweise fremden ,Tiefsinns'<br />
sind, wie es nach vielen Kommentatoren der Fall sein soll." (Georg Lukâcs.<br />
Faust-Studien. In: G. L.: Faust und Faustus. Reinbek 1967, S. 207.)<br />
DAS A R G U M E N T <strong>99</strong>/1976 ©