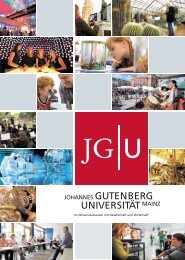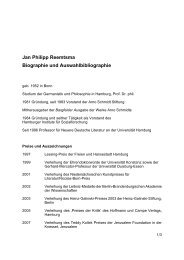Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
Zu den Lebensstil- strukturierenden Einflussgrößen zählen u. a. Body-Mass-Index <strong>und</strong> Adipositas,<br />
Tabakkonsum, Passivrauchen, Alkoholkonsum, Sport <strong>und</strong> physische Aktivität, Schlafdauer, soziale<br />
Netzwerkdichte <strong>und</strong> Qualität, Stress <strong>und</strong> Inanspruchnahmeverhalten (ebd., S. 11- 12).<br />
2.4. Medizinische Kontrollvariablen<br />
Zu den medizinischen Kontrollvariablen zählen u. a. Hypertonie, Diabetes Mellitus, Cholesterinparameter<br />
sowie die Pulsfrequenz (ebd., S. 12).<br />
3. Ausgewählte Schwerpunktthemen<br />
3.1. Der Einfluss von Sport <strong>und</strong> physischer Aktivität auf die Mortalität<br />
Die Deutsche Herz- Kreislauf- Präventionsstudie (DHP-Studie) wurde von 1984-1986, 1987-1988<br />
<strong>und</strong> 1990-1991 durchgeführt (ebd., S. 94). Hiernach ist die Sterblichkeitsrate von sportlich Aktiven<br />
nachweisbar niedriger als die von Nicht-Sporttreibenden (ebd., S. 96). In einer regionalen Unterstichprobe<br />
der DHP-Studie wurde die Mortalitätsrate für 40 bis 69- jährige Männer über 5 bis 8<br />
Jahre bestimmt. Bei körperlich aktiven Männern war das relative Risiko, an einer Herz- Kreislauf-<br />
Erkrankung zu sterben, unabhängig von sonstigen kardiovaskulären Risikofaktoren, signifikant geringer.<br />
Für Frauen konnte dies aufgr<strong>und</strong> einer zu geringen Zahl an kardiovaskulären Todesfällen<br />
nicht untersucht werden (ebd., S. 96).<br />
3.2. Der Einfluss von Tabakkonsum auf die Mortalität<br />
Pro Tag werden durchschnittlich 386 Mill. Zigaretten, 9 Mill. Zigarren <strong>und</strong> Zigarillos, 40 Tonnen<br />
Feinschnitt <strong>und</strong> 2 Tonnen Pfeifentabak geraucht. Rein rechnerisch entfallen auf jeden Einwohner<br />
Deutschlands, egal ob Raucher oder Nichtraucher, Erwachsener oder Kind, knapp 5 Zigaretten pro<br />
Tag <strong>und</strong> jeden zehnten Tag eine Zigarre oder ein Zigarillo (STATISTISCHES BUNDESAMT<br />
DEUTSCHLAND 1, Stand: 02.12.2003).<br />
Tabakkonsum zählt zu demjenigen Risikoverhalten mit den deutlichsten Auswirkungen auf die Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Obwohl die Aussage “Rauchen gefährdet die Ges<strong>und</strong>heit” <strong>zum</strong> Allgemeinwissen gehört<br />
<strong>und</strong> ähnliche Aussagen mittlerweile auf jeder Zigarettenpackung zu lesen sind, rauchten im Jahr<br />
1998 ca. 28% der Frauen <strong>und</strong> 37% der Männer im Alter von 18 bis 79 Jahren. Der mittlere Zigarettenkonsum<br />
liegt für Männer bei 20, für Frauen bei 16 Stück pro Tag. Der Trend geht allerdings für<br />
Männer in allen Altersgruppen sukzessive zurück, während er bei den weiblichen Rauchern uneinheitlich<br />
ist. Gründe hierfür sind die Änderung der weiblichen Rollenstruktur; Rauchen als sichtbares<br />
Zeichen der Emanzipation. Die Raucherquoten der beiden Geschlechter nähern sich also immer<br />
weiter an (SCHNEIDER, S. 83 f). Für ehemalige Raucher besteht, neben zahlreichen Morbiditätsrisiken<br />
weiterhin ein erhöhtes Mortalitätsrisiko, welches nachweisbar zwischen dem der Nicht- <strong>und</strong><br />
dem der Gelegenheitsraucher liegt (ebd., S. 84 f).<br />
3.3. Der Einfluss von Alkoholkonsum auf die Mortalität<br />
Von 1950 bis 1980 stieg der jährliche Pro- Kopf- Verbrauch von ca. 3 l reinen Alkohols auf ca. 12 l<br />
an. Dies geschah kontinuierlich <strong>und</strong> hat sich seither auf diesem Niveau stabilisiert. Für die 15- bis<br />
70jährigen ergibt sich ein durchschnittlicher Alkoholkonsum von 36 g/Tag. Im Ges<strong>und</strong>heitsbericht<br />
der B<strong>und</strong>esregierung wird als starker Konsum bei Männern mehr als 40 g/Tag <strong>und</strong> bei Frauen<br />
mehr als 20 g/Tag definiert. Folgen übermäßigen Alkoholkonsums können auf der körperlichen,<br />
der psychischen <strong>und</strong> der sozialen Ebene stattfinden. Ein leichter bis moderater Alkoholkonsum<br />
wirkt allerdings reduzierend auf die Gesamtmorbidität <strong>und</strong> -mortalität (SCHNEIDER, S. 90 f).<br />
Die Ergebnisse einer Sonderauswertung der Todesursachenstatistik ergab, dass im Jahr 2000 in<br />
Deutschland 16.610 Personen im Zusammenhang mit dem Genuss von Alkohol starben. Dies entspricht<br />
2% aller Sterbefälle. Bezogen auf 100.000 Einwohner starben im Jahr 2000 etwa 20 Personen<br />
durch alkoholbedingte Krankheiten oder äußere Umstände. Das Verhältnis von Männern<br />
<strong>und</strong> Frauen betrug ca. 3:1. Die häufigste alkoholbedingte Todesursache (mehr als 50% der Gesamttodesfälle<br />
durch Alkohol) war die alkoholische Leberzirrhose mit 9.550 Verstorbenen<br />
(STATISTISCHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND 2, Stand: 02.12.2003).<br />
4. Fazit<br />
Die Frage, welche Faktoren zu einem langen Leben beitragen, ist nicht pauschal beantwortbar.<br />
Natürlich ist es so, dass sich bestimmte Lebensstile negativ auf die Morbidität <strong>und</strong> folglich auch auf<br />
die Mortalität auswirken. So gelten z. B. das Rauchen <strong>und</strong> der Alkoholkonsum als Risikofaktoren.<br />
Mortalität muss allerdings als Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Faktoren gesehen werden,<br />
wie ein Zitat von Hauser verdeutlicht „Nicht jede Morbidität führt zu Mortalität, <strong>und</strong> einige Todesfälle<br />
ereignen sich ohne vorangehende Erkrankung (SCHNEIDER, S. 140).“ Außerdem gibt es in der