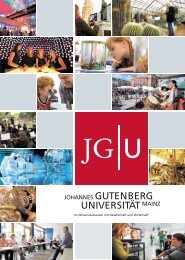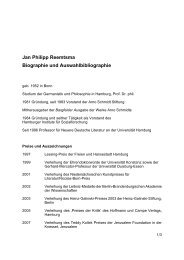Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Programm und Kurzfassungen zum interdisziplinären Seminar ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
51<br />
<strong>Kurzfassungen</strong> zur 11. St<strong>und</strong>e vom 28.01.04<br />
<strong>Seminar</strong> Sport <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, Studienschwerpunkt Freizeitsport,<br />
Fachbereich Sport, Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
Leitung: Prof. Dr. Dr. M. Messing, Prof. Dr. H.-V. Ulmer<br />
Referent: Björn Weber, Datum: 28.01.2004<br />
E-Mail: bjoernweber@t-online.de<br />
Thema 21: Sport <strong>und</strong> subjektives Ges<strong>und</strong>heitsempfinden aus der Sicht behinderter<br />
Athleten (M)<br />
1. Entwicklung des Behindertensports in Deutschland<br />
Der Behindertensport als wesentlicher Beitrag zur Rehabilitation erlangt eine immer größer werdende<br />
Bedeutung. Seine systematische Entwicklung vollzog sich seit dem letzten Weltkrieg vom<br />
deutschen Versehrtensportverband (DVS) bis 1975 <strong>zum</strong> deutschen Behindertensportverband<br />
(DBS) <strong>und</strong> dem Zusatz Fachverband für Sport in Rehabilitation <strong>und</strong> Prävention (1990).<br />
(BLAUMEISER 1999, 110)<br />
2. Ziele des Behindertensports<br />
Ziel der sportlichen Betätigung im Versehrtensport, so z.B. beim Querschnittsgelähmten, ist insbesondere<br />
die Kompensation der erhalten gebliebenen Muskelgruppen, die Entwicklung eines neuen<br />
Gleichgewichtsempfindens, die Herausbildung eines so genannten „Oberkörperathleten“. (ARNOLD<br />
et al. 1992, 52 f)<br />
Personelle Faktoren der Leistungsstruktur:<br />
• Psychische Verhaltens- <strong>und</strong> Steuereigenschaften<br />
• Technik/Koordination<br />
• Taktik<br />
• Konstitution<br />
Äußere Faktoren der Leistungsstruktur:<br />
• Materiell-technische Bedingungen (Rollstuhl, Sportanlagen u.ä.)<br />
• Äußere Verhältnisse<br />
3. Definition <strong>und</strong> Formen der Behinderung<br />
Als Behinderung gilt jede funktionelle Störung, die Sport nicht ohne Einschränkung betreiben lässt:<br />
Einschränkungen auf körperlicher, geistiger <strong>und</strong> seelischer Ebene, Einschränkungen der Motorik,<br />
der Denk- oder Lernfähigkeit, der Kommunikation <strong>und</strong>/oder der Verhaltensweisen. Damit es sinnvoll<br />
ist, einen speziellen Sport, den Behindertensport, auszuüben, muss die Funktionsstörung von<br />
einer gewissen Dauer gegeben sein. (SCHEID u. RIEDER, 2000, 88 f)<br />
Die klassischen Formen der körperlichen Behinderung sind:<br />
• Amputation<br />
• Blindheit<br />
• zerebralbedingte Lähmungen<br />
• Taubheit<br />
• spinale Querschnittslähmung (BLAUMEISER 1999, 110)<br />
Für den Sport ist aber weniger die medizinische Diagnose als vielmehr die Art des Funktionsverlustes<br />
von Bedeutung. Diese verursacht die Einschränkung in der Ausübung des Sportes.<br />
Wesentliche Arten von Funktionsverlusten:<br />
• verkürzte Reichweite, schlechte Hebel<br />
• Kraftverlust<br />
• Konditionsmangel<br />
• Beweglichkeitseinschränkung<br />
• Instabilität