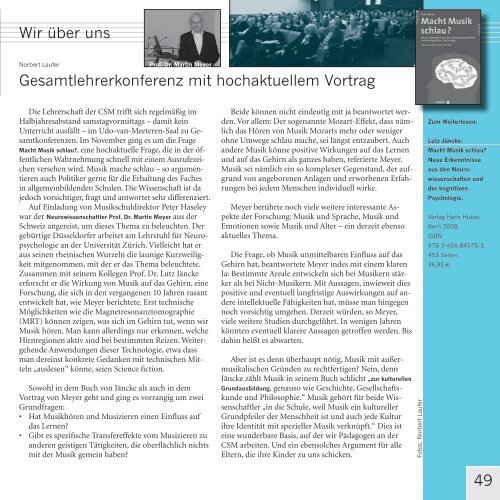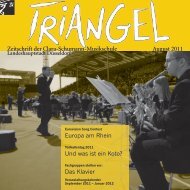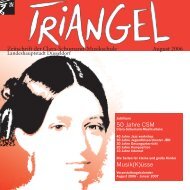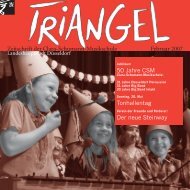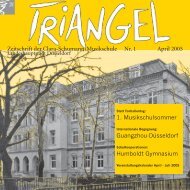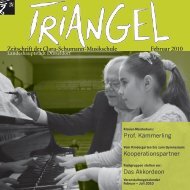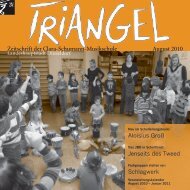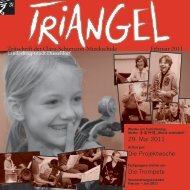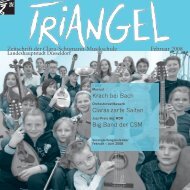Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta
Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta
Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wir über uns<br />
Norbert Laufer<br />
Prof. Dr. Martin Meyer<br />
Gesamtlehrerkonferenz mit hochaktuellem Vortrag<br />
Die Lehrerschaft <strong>der</strong> CSM trifft sich regelmäßig im<br />
Halbjahresabstand samstagvormittags – damit kein<br />
Unterricht ausfällt – im Udo-van-Meeteren-Saal zu Gesamtkonferenzen.<br />
Im November ging es um die Frage<br />
Macht Musik schlau?, eine hochaktuelle Frage, die in <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Wahrnehmung schnell mit einem Ausrufezeichen<br />
versehen wird. Musik mache schlau – so argumentieren<br />
auch Politiker gerne für die Erhaltung des Faches<br />
in allgemeinbildenden Schulen. Die Wissenschaft ist da<br />
jedoch vorsichtiger, fragt und antwortet sehr differenziert.<br />
Auf Einladung <strong>von</strong> Musikschuldirektor Peter Haseley<br />
war <strong>der</strong> Neurowissenschaftler Prof. Dr. Martin Meyer aus <strong>der</strong><br />
Schweiz angereist, um dieses Thema zu beleuchten. Der<br />
gebürtige Düsseldorfer arbeitet am Lehrstuhl für Neuropsychologie<br />
an <strong>der</strong> Universität Zürich. Vielleicht hat er<br />
aus seinen rheinischen Wurzeln die launige Kurzweiligkeit<br />
mitgenommen, mit <strong>der</strong> er das Thema beleuchtete.<br />
Zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Lutz Jäncke<br />
erforscht er die Wirkung <strong>von</strong> Musik auf das Gehirn, eine<br />
Forschung, die sich in den vergangenen 10 Jahren rasant<br />
entwickelt hat, wie Meyer berichtete. Erst technische<br />
Möglichkeiten wie die Magnetresonanztomographie<br />
(MRT) können zeigen, was sich im Gehirn tut, wenn wir<br />
Musik hören. Man kann allerdings nur erkennen, welche<br />
Hirnregionen aktiv sind bei bestimmten Reizen. Weitergehende<br />
Anwendungen dieser Technologie, etwa dass<br />
man <strong>der</strong>einst konkrete Gedanken mit technischen Mitteln<br />
„auslesen“ könne, seien Science fiction.<br />
Sowohl in dem Buch <strong>von</strong> Jäncke als auch in dem<br />
Vortrag <strong>von</strong> Meyer geht und ging es vorrangig um zwei<br />
Grundfragen:<br />
• Hat Musikhören und Musizieren einen Einfluss auf<br />
das Lernen?<br />
• Gibt es spezifische Transfereffekte vom Musizieren zu<br />
an<strong>der</strong>en geistigen Tätigkeiten, die oberflächlich nichts<br />
mit <strong>der</strong> Musik gemein haben?<br />
Beide können nicht eindeutig mit ja beantwortet werden.<br />
Vor allem: Der sogenannte Mozart-Effekt, dass nämlich<br />
das Hören <strong>von</strong> Musik Mozarts mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
ohne Umwege schlau mache, sei längst entzaubert. Auch<br />
an<strong>der</strong>e Musik könne positive Wirkungen auf das Lernen<br />
und auf das Gehirn als ganzes haben, referierte Meyer.<br />
Musik sei nämlich ein so komplexer Gegenstand, <strong>der</strong> aufgrund<br />
<strong>von</strong> angeborenen Anlagen und erworbenen Erfahrungen<br />
bei jedem Menschen individuell wirke.<br />
Meyer berührte noch viele weitere interessante Aspekte<br />
<strong>der</strong> Forschung: Musik und Sprache, Musik und<br />
Emotionen sowie Musik und Alter – ein <strong>der</strong>zeit ebenso<br />
aktuelles Thema.<br />
Die Frage, ob Musik unmittelbaren Einfluss auf das<br />
Gehirn hat, beantwortete Meyer indes mit einem klaren<br />
Ja: Bestimmte Areale entwickeln sich bei Musikern stärker<br />
als bei Nicht-Musikern. Mit Aussagen, inwieweit dies<br />
positive und eventuell langfristige Auswirkungen auf an<strong>der</strong>e<br />
intellektuelle Fähigkeiten hat, müsse man hingegen<br />
noch vorsichtig umgehen. Derzeit würden, so Meyer,<br />
viele weitere Studien durchgeführt. In wenigen Jahren<br />
könnten eventuell klarere Aussagen getroffen werden. Bis<br />
dahin heißt es abwarten.<br />
Aber ist es denn überhaupt nötig, Musik mit außermusikalischen<br />
Gründen zu rechtfertigen? Nein, denn<br />
Jäncke zählt Musik in seinem Buch schlicht „zur kulturellen<br />
Grundausbildung, genauso wie Geschichte, Gesellschaftskunde<br />
und Philosophie.“ Musik gehört für beide Wissenschaftler<br />
„in die Schule, weil Musik ein kultureller<br />
Grundpfeiler <strong>der</strong> Menschheit ist und auch jede Kultur<br />
ihre Identität mit spezieller Musik verknüpft.“ Dies ist<br />
eine wun<strong>der</strong>bare Basis, auf <strong>der</strong> wir Pädagogen an <strong>der</strong><br />
CSM arbeiten. Und ein ebensolches Argument für alle<br />
Eltern, die ihre Kin<strong>der</strong> zu uns schicken.<br />
Lutz Jäncke:<br />
Macht Musik schlau?<br />
Neue Erkenntnisse<br />
aus den Neuro-<br />
wissenschaften und<br />
<strong>der</strong> kognitiven<br />
Psychologie.<br />
Verlag Hans Huber,<br />
Bern 2008.<br />
ISBN<br />
978-3-456-84575-3.<br />
453 Seiten.<br />
36,95 €.<br />
Fotos: Norbert Laufer Zum Weiterlesen:<br />
49