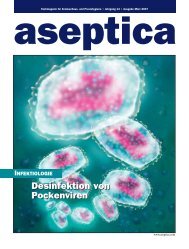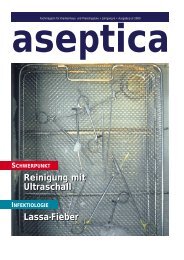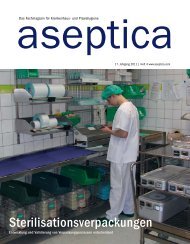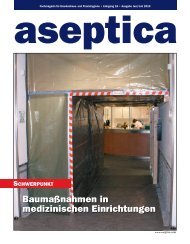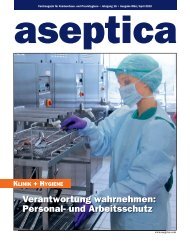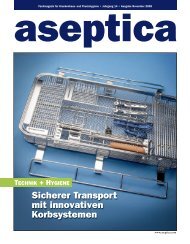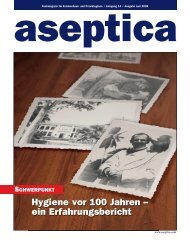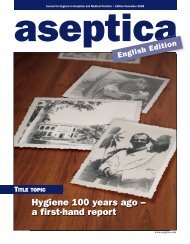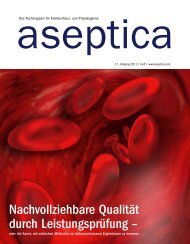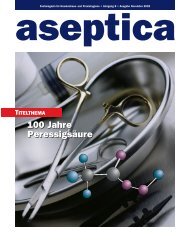Ausgabe 3/2001 - aseptica
Ausgabe 3/2001 - aseptica
Ausgabe 3/2001 - aseptica
- TAGS
- aseptica
- www.aseptica.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
enbildung erfolgt außerhalb des infizierten<br />
Tieres oder Menschen im Erdreich. In den<br />
Körperflüssigkeiten oder in ungeöffneten Leichen/Tierkadavern<br />
findet keine Sporenbildung<br />
statt. Durch das Abhäuten und Zerlegen<br />
von Milzbrand-Tierkörpern und das Trocknen<br />
der Felle kommt es jedoch zu einer massenhaften<br />
Sporenbildung während des Trocknungsprozesses.<br />
Da vor allem die Sporen bei<br />
der Infektion des Menschen eine zentrale Rolle<br />
spielen, ist die Gefährdung, die von einem<br />
infizierten Menschen ausgeht, als beherrschbar<br />
einzustufen. Infektionen von Mensch zu<br />
Mensch finden nur äußerst selten statt.<br />
Krankheitsbild beim Menschen<br />
Für den Menschen ist die Infektion mit dem<br />
Erreger aber äußerst gefährlich. Man unterscheidet<br />
hier 4 Formen:<br />
1. Beim Hautmilzbrand handelt es sich<br />
um die häufigste Manifestation, die in ca.<br />
95 % aller aufgetretenen Milzbrandfälle beobachtet<br />
wird und unbehandelt bei jedem fünften<br />
Infizierten zum Tode führt.<br />
2. Weit gefährlicher ist der Lungenmilzbrand<br />
nach Einatmen von erregerhaltigem<br />
Material (Staub, Aerosole) oder der<br />
3. Darmmilzbrand nach Verschlucken des<br />
Erregers. Lungen- wie Darmmilzbrand verlaufen<br />
unbehandelt oder zu spät behandelt<br />
immer tödlich.<br />
4. Alle drei bisher genannten Formen<br />
können in die gleichfalls tödliche Milzbrandsepsis<br />
übergehen.<br />
Bei Hautmilzbrand bildet sich nach einer<br />
Inkubationszeit von 2 bis 5 Tagen an der<br />
Infektionsstelle innerhalb von 24 bis 48 Stunden<br />
eine schmerzlose Papel mit stark ödematösem<br />
Randsaum, deren Zentrum schwarznekrotisch<br />
zerfällt, während am Rand weitere<br />
seröse Bläschen entstehen. Lungenmilzbrand<br />
beginnt mit grippeähnlichen Symptomen, die<br />
sich in wenigen Stunden zu einer Pneumonie<br />
mit hohem Fieber, Atemnot und massiven<br />
Ödemen im Nacken, Thorax- und Mediastinalbereich<br />
entwickeln. Darmmilzbrand<br />
äußert sich als schwere Enteritis mit blutigserösen<br />
Ausscheidungen und Aszitesbildung.<br />
Wie viele andere bakterielle Erreger wird<br />
auch Bacillus anthracis erst durch die Bildung<br />
von Toxinen zu einem hochgradig pathogenen<br />
Mikroorganismus: Das Anthrax-Toxin besteht<br />
aus zwei enzymatisch aktiven Teilen, dem<br />
Ödem-Faktor und dem Letal-Faktor, mit<br />
Infektiologie<br />
Abb. 1: Bildung von hitze- und<br />
chemikalienresistenten<br />
Endosporen bei vegetativen<br />
Bakterien der Gattung Bacillus<br />
und Clostridium.<br />
einer katalytischen Aktivität für<br />
Makromoleküle im Zellinneren.<br />
Der dritte Faktor wird als<br />
protektives Antigen bezeichnet.<br />
Es bindet an Rezeptormoleküle<br />
auf Zelloberflächen und vermittelt<br />
die Aufnahme der beiden<br />
zuvor genannten Faktoren<br />
in die Zelle.<br />
Prävention<br />
Impfstoffe für Risikogruppen<br />
wie zum Beispiel Abdecker,<br />
Landwirte, Fleischverarbeiter<br />
oder Tierärzte sind in den meisten<br />
Ländern wegen ihrer<br />
schlechten Verträglichkeit zur<br />
Zeit nicht zugelassen. Milzbrandpatienten<br />
müssen daher<br />
unverzüglich mit wirksamen<br />
Antibiotika behandelt werden.<br />
Ebenso nehmen Expositionsprophylaxe<br />
und Desinfektionsmaßnahmen<br />
bei der<br />
Prävention eine zentrale Rolle<br />
ein. Hier ist grundsätzlich zu<br />
unterscheiden, ob man es mit<br />
dem vegetativen Erreger im<br />
Körper oder Körperflüssigkeiten<br />
eines erkrankten Individuums<br />
(Tieres oder Menschen) zu<br />
tun hat oder mit Milzbrandsporen,<br />
die sich außerhalb des<br />
Körpers haben bilden können.<br />
Resistenz des vegetativen<br />
Erregers<br />
Die vegetativen Zellen von<br />
Bacillus anthracis werden als<br />
empfindlich eingestuft und<br />
sind laut Empfehlungen des<br />
RKI (Robert Koch Institut)<br />
daher durch jedes RKI-gelistete<br />
Desinfektionsverfahren mit<br />
Wirkungsbereich A abzutöten.<br />
<strong>aseptica</strong> 7. Jahrgang <strong>2001</strong> - Heft 3 13