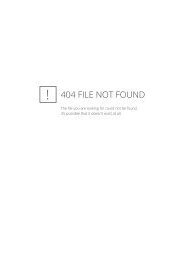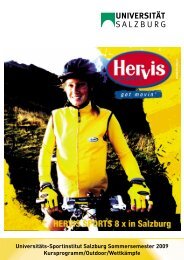Skript-Betaversion - Universität Salzburg
Skript-Betaversion - Universität Salzburg
Skript-Betaversion - Universität Salzburg
- TAGS
- salzburg
- www.sbg.ac.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22 Franz Riffert & Andreas Paschon<br />
1.4 Die Neuverteilung der Verantwortlichkeiten durch die Schulautonomie<br />
Der skizzierte schulautonome Freiraum zur Stundentafel- und Unterrichtsgestaltung<br />
ist nur dann verantwortbar, wenn er von einem System der Rechenschaftslegung<br />
begleitet wird: So muss bei einer verantworteten Schulentwicklung<br />
natürlich überprüft werden, ob die im Leitbild und Schulprogramm gesetzten<br />
Ziele, deren Umsetzung durch entsprechende schulautonomen Maßnahmen<br />
und deren Qualität – z.B. Einführung eines neuen Schulzweigs, oder von<br />
Integrationsklassen, eines neuen Fachs ‚Sozialerziehung’, oder eines Projekts<br />
‚offenes Lernen’, um nur ein paar wenige Möglichkeiten anzudeuten – zu den<br />
gewünschten positiven Effekten führen. Eine verlässliche Feststellung der (positiven<br />
oder auch negativen) Effekte von Veränderungsmaßnahmen kann nur<br />
über eine wissenschaftliche Standards erfüllende Evaluation der vorgenommenen<br />
Veränderungsmaßnahmen erfolgen.<br />
Von diesem unverzichtbaren Element autonomer Schulentwicklung ist in der<br />
endgültigen Fassung des Lehrplans 2000 aber nur mehr an einer einzigen Stelle<br />
die Rede: „Aspekte des Lehrens und Lernens wie Unterrichtsgestaltung, Erziehungsstil<br />
und individuelle Förderung sowie Rückmeldungen über das Unterrichts-<br />
und Schulgeschehen sind wichtige Bereiche von Qualität in der Schule.<br />
Schulqualität umfasst weiters Elemente wie Schulklima, Schulmanagement,<br />
Außenbeziehungen und Professionalität sowie Personalentwicklung. Die Entwicklung<br />
von Schulqualität wird auch durch geeignete Maßnahmen der Selbstevaluation<br />
gefördert.“ (BGBl. 133/2000: Dritter Teil; Hervorhebung nicht im<br />
Original)<br />
Diese kryptische Formulierung in Form einer deskriptiven Aussage lässt<br />
viele Fragen offen und bedarf ebenfalls dringend einer schärferen Fassung.<br />
Denn bei enger Lesart liegt – weil eben deskriptiv und nicht präskriptiv<br />
formuliert – keinerlei Verpflichtung zur Selbstevaluation vor. Bei einer weiteren<br />
Interpretation lässt sich argumentieren, dass – unter der Voraussetzung, dass<br />
Schulen möglichst hohe Qualität zu erbringen haben – qualitätssteigernde Maßnahmen<br />
wie Selbstevaluierung zumindest implizit gefordert sind. Nur über<br />
Evaluation lässt sich verantwortet Rechenschaft ablegen über die Aktivitäten,<br />
die im Rahmen des schulautonomen Freiraums gesetzt wurden. Selbstevaluation<br />
stellt damit ein unverzichtbares Element in einem selbstreferenziellen Adaptationsprozess<br />
dar.<br />
Bis vor wenigen Jahren wurden die Schulen – LehrerInnen und SchulleiterInnen<br />
– im Rahmen ihrer Ausbildung nur unzureichend auf die Autonomie<br />
und die damit einhergehende Qualitätssicherung (Selbstevaluation) vorbereitet.