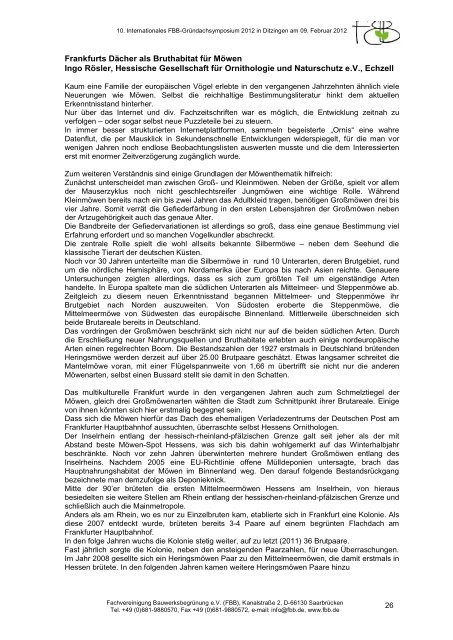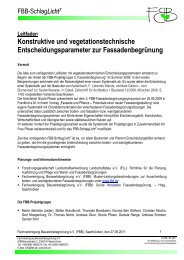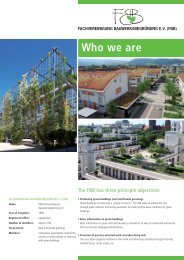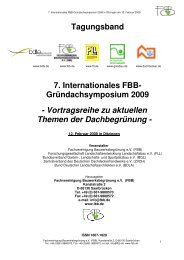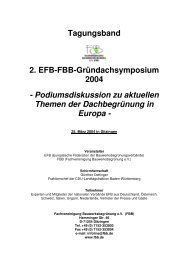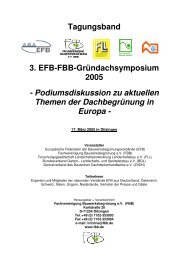Tagungsband 10 - Fachvereinigung Bauwerksbegrünung eV
Tagungsband 10 - Fachvereinigung Bauwerksbegrünung eV
Tagungsband 10 - Fachvereinigung Bauwerksbegrünung eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>10</strong>. Internationales FBB-Gründachsymposium 2012 in Ditzingen am 09. Februar 2012<br />
Frankfurts Dächer als Bruthabitat für Möwen<br />
Ingo Rösler, Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., Echzell<br />
Kaum eine Familie der europäischen Vögel erlebte in den vergangenen Jahrzehnten ähnlich viele<br />
Neuerungen wie Möwen. Selbst die reichhaltige Bestimmungsliteratur hinkt dem aktuellen<br />
Erkenntnisstand hinterher.<br />
Nur über das Internet und div. Fachzeitschriften war es möglich, die Entwicklung zeitnah zu<br />
verfolgen – oder sogar selbst neue Puzzleteile bei zu steuern.<br />
In immer besser strukturierten Internetplattformen, sammeln begeisterte „Ornis“ eine wahre<br />
Datenflut, die per Mausklick in Sekundenschnelle Entwicklungen widerspiegelt, für die man vor<br />
wenigen Jahren noch endlose Beobachtungslisten auswerten musste und die dem Interessierten<br />
erst mit enormer Zeitverzögerung zugänglich wurde.<br />
Zum weiteren Verständnis sind einige Grundlagen der Möwenthematik hilfreich:<br />
Zunächst unterscheidet man zwischen Groß- und Kleinmöwen. Neben der Größe, spielt vor allem<br />
der Mauserzyklus noch nicht geschlechtsreifer Jungmöwen eine wichtige Rolle. Während<br />
Kleinmöwen bereits nach ein bis zwei Jahren das Adultkleid tragen, benötigen Großmöwen drei bis<br />
vier Jahre. Somit verrät die Gefiederfärbung in den ersten Lebensjahren der Großmöwen neben<br />
der Artzugehörigkeit auch das genaue Alter.<br />
Die Bandbreite der Gefiedervariationen ist allerdings so groß, dass eine genaue Bestimmung viel<br />
Erfahrung erfordert und so manchen Vogelkundler abschreckt.<br />
Die zentrale Rolle spielt die wohl allseits bekannte Silbermöwe – neben dem Seehund die<br />
klassische Tierart der deutschen Küsten.<br />
Noch vor 30 Jahren unterteilte man die Silbermöwe in rund <strong>10</strong> Unterarten, deren Brutgebiet, rund<br />
um die nördliche Hemisphäre, von Nordamerika über Europa bis nach Asien reichte. Genauere<br />
Untersuchungen zeigten allerdings, dass es sich zum größten Teil um eigenständige Arten<br />
handelte. In Europa spaltete man die südlichen Unterarten als Mittelmeer- und Steppenmöwe ab.<br />
Zeitgleich zu diesem neuen Erkenntnisstand begannen Mittelmeer- und Steppenmöwe ihr<br />
Brutgebiet nach Norden auszuweiten. Von Südosten eroberte die Steppenmöwe, die<br />
Mittelmeermöwe von Südwesten das europäische Binnenland. Mittlerweile überschneiden sich<br />
beide Brutareale bereits in Deutschland.<br />
Das vordringen der Großmöwen beschränkt sich nicht nur auf die beiden südlichen Arten. Durch<br />
die Erschließung neuer Nahrungsquellen und Bruthabitate erlebten auch einige nordeuropäische<br />
Arten einen regelrechten Boom. Die Bestandszahlen der 1927 erstmals in Deutschland brütenden<br />
Heringsmöwe werden derzeit auf über 25.00 Brutpaare geschätzt. Etwas langsamer schreitet die<br />
Mantelmöwe voran, mit einer Flügelspannweite von 1,66 m übertrifft sie nicht nur die anderen<br />
Möwenarten, selbst einen Bussard stellt sie damit in den Schatten.<br />
Das multikulturelle Frankfurt wurde in den vergangenen Jahren auch zum Schmelztiegel der<br />
Möwen, gleich drei Großmöwenarten wählten die Stadt zum Schnittpunkt ihrer Brutareale. Einige<br />
von ihnen könnten sich hier erstmalig begegnet sein.<br />
Dass sich die Möwen hierfür das Dach des ehemaligen Verladezentrums der Deutschen Post am<br />
Frankfurter Hauptbahnhof aussuchten, überraschte selbst Hessens Ornithologen.<br />
Der Inselrhein entlang der hessisch-rheinland-pfälzischen Grenze galt seit jeher als der mit<br />
Abstand beste Möwen-Spot Hessens, was sich bis dahin wohlgemerkt auf das Winterhalbjahr<br />
beschränkte. Noch vor zehn Jahren überwinterten mehrere hundert Großmöwen entlang des<br />
Inselrheins. Nachdem 2005 eine EU-Richtlinie offene Mülldeponien untersagte, brach das<br />
Hauptnahrungshabitat der Möwen im Binnenland weg. Den darauf folgende Bestandsrückgang<br />
bezeichnete man demzufolge als Deponieknick.<br />
Mitte der 90’er brüteten die ersten Mittelmeermöwen Hessens am Inselrhein, von hieraus<br />
besiedelten sie weitere Stellen am Rhein entlang der hessischen-rheinland-pfälzischen Grenze und<br />
schließlich auch die Mainmetropole.<br />
Anders als am Rhein, wo es nur zu Einzelbruten kam, etablierte sich in Frankfurt eine Kolonie. Als<br />
diese 2007 entdeckt wurde, brüteten bereits 3-4 Paare auf einem begrünten Flachdach am<br />
Frankfurter Hauptbahnhof.<br />
In den folge Jahren wuchs die Kolonie stetig weiter, auf zu letzt (2011) 36 Brutpaare.<br />
Fast jährlich sorgte die Kolonie, neben den ansteigenden Paarzahlen, für neue Überraschungen.<br />
Im Jahr 2008 gesellte sich ein Heringsmöwen Paar zu den Mittelmeermöwen, die damit erstmals in<br />
Hessen brütete. In den folgenden Jahren kamen weitere Heringsmöwen Paare hinzu<br />
<strong>Fachvereinigung</strong> <strong>Bauwerksbegrünung</strong> e.V. (FBB), Kanalstraße 2, D-66130 Saarbrücken<br />
Tel. +49 (0)681-9880570, Fax +49 (0)681-9880572, e-mail: info@fbb.de, www.fbb.de<br />
26