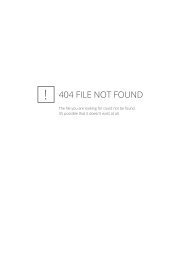Harte Röntgenstrahlung aus relativistischen Laserplasmen und ...
Harte Röntgenstrahlung aus relativistischen Laserplasmen und ...
Harte Röntgenstrahlung aus relativistischen Laserplasmen und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1. Der Jenaer Titan:Saphir Laser 5<br />
Abb. 2.2: Vergleich der (gemessenen) Spektren des Oszillators <strong>und</strong> des verstärkten Pulses.<br />
Die bandbreiten begrenzten Pulse des Oszillators haben eine Dauer von 45 fs. Nach der<br />
Verstärkung beträgt die Bandbreite des Pulses 15 nm, womit eine minimale Pulsdauer<br />
von 60 fs unterstützt wird. Die leichte Rotverschiebung des Spektrums beruht auf der<br />
bevorzugten Verstärkung des vorweglaufenden roten Spektralanteils des gechirpten Pulses.<br />
weitet, um die Leistungsdichte herabzusetzen. Nach viermaligem Durchgang durch<br />
den Ti:Saphir Kristall der zweiten Verstärkerstufe besitzt der Puls bereits 300 mJ<br />
Energie.<br />
Die letzte Verstärkerstufe soll nun etwas detaillierter beschrieben werden. Abb. 2.3<br />
zeigt eine Aufsicht auf den 3-Pass-Verstärker. Er wird beidseitig von frequenzver-<br />
doppelten Nd-YAG Lasern gepumpt. Die Pumpenergie je Strahl beträgt 2.5 J, also<br />
insgesamt 5 J pro Puls. 34% der absorbierten Energie werden durch die Stokesver-<br />
schiebung zwischen Absorptionsenergie <strong>und</strong> Emissionsenergie in thermische Energie<br />
umgewandelt. Um diese schneller abzuführen <strong>und</strong> damit den Effekt einer thermi-<br />
schen Linse zu minimieren, wird der Verstärkerkristall gekühlt. Die Durchmesser<br />
der Pumppulse <strong>und</strong> des Ti:Saphir-Pulses betragen am Ort des 13.4 mm langen<br />
Verstärkerkristalls etwa 15 mm. Die Dotierung des Kristalls mit Ti 3+ -Ionen beträgt<br />
5 · 10 19 /cm 3 . Mit dem Verstärkungsmodell von Frantz <strong>und</strong> Nodvig [9] läßt sich dar-<br />
<strong>aus</strong> die resultierende Verstärkung des Lichtpulses berechnen [10]. Abb. 2.4 zeigt die<br />
Verstärkungskurve, das heißt die Pulsenergie als Funktion der durchlaufenen Kri-<br />
stallänge. Die Stufen nach jeweils einem Durchgang durch den Kristall werden durch<br />
die Reflexion an den unbeschichteten Kristalloberflächen hervorgerufen. Die berech-