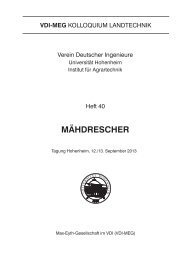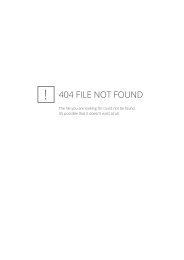- Seite 1 und 2: Besteuerung von Real Estate Investm
- Seite 3 und 4: Vorwort Die vorliegende Arbeit wurd
- Seite 5 und 6: 6.2. Steuerbefreiung nur für REIT-
- Seite 7 und 8: 2.3.2. Beihilferecht ..............
- Seite 9 und 10: 4.2.2.1.2. REIT-Dienstleistungsgese
- Seite 11 und 12: Abkürzungsverzeichnis a. A. andere
- Seite 13 und 14: FdS Fachinstitut der Steuerberater
- Seite 15 und 16: NTJ National Tax Journal (Zeitschri
- Seite 17 und 18: Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Inte
- Seite 19 und 20: Schaffung heutiger Hinzurechnungsbe
- Seite 21 und 22: in ein JStG 2010 inkorporiert. 25 L
- Seite 23 und 24: von Einkünften aus Kapitalvermöge
- Seite 25 und 26: Weiteres Unterziel der betriebswirt
- Seite 27 und 28: günstigte (§ 3 Nr. 70 EStG). Zu d
- Seite 29 und 30: gezogen. Verfassungsrechtlich werde
- Seite 31 und 32: 2. Betriebswirtschaftliche und rech
- Seite 33 und 34: Erreichen als hinreichend betrachte
- Seite 35 und 36: tet werden.“ 93 Schließlich steh
- Seite 37: nicht einheitlich beantwortet: 108
- Seite 41 und 42: wenn das auf dem Gebiet des Quellen
- Seite 43 und 44: Durch den allgemeinen Gleichheitssa
- Seite 45 und 46: anerkannte Gerechtigkeitswertungen
- Seite 47 und 48: sich vor diesem Hintergrund durch e
- Seite 49 und 50: sich auf den realisierten Reinverm
- Seite 51 und 52: ichtigkeit begründet folglich die
- Seite 53 und 54: Binnenmarkt grundlegende Prinzipien
- Seite 55 und 56: echtlich allerdings nicht angestreb
- Seite 57 und 58: sehen“ 243 . Nicht abschließend
- Seite 59 und 60: fertigung kommen nach der EuGH-Rech
- Seite 61 und 62: Demgegenüber unterliegen sog. Port
- Seite 63 und 64: fallen regelmäßig nicht unter Art
- Seite 65 und 66: te Diskriminierungen. 291 Das Verbo
- Seite 67 und 68: Gem. primärrechtlicher Vorgabe sin
- Seite 69 und 70: abhängiger Besteuerungsunterschied
- Seite 71 und 72: tung (Kapitalexportneutralität) vo
- Seite 73 und 74: Die zahlreichen Regulierungsmaßnah
- Seite 75 und 76: Der gewählte holistische Gesetzgeb
- Seite 77 und 78: ob sämtliche vorgenannte gesellsch
- Seite 79 und 80: � Anteilen an Immobilienpersoneng
- Seite 81 und 82: Selbst wenn Immobilienpersonengesel
- Seite 83 und 84: 3.2.2. Sitz und Ort der Geschäftsl
- Seite 85 und 86: Unterbewertung bringt regelmäßig
- Seite 87 und 88: gister einträgt, ohne dass die Vor
- Seite 89 und 90:
ner kann die Streubesitzanforderung
- Seite 91 und 92:
findet eine umfassende Stimmrechtsz
- Seite 93 und 94:
Die für § 12 Abs. 2 REITG zentral
- Seite 95 und 96:
teilseigner ausschütten (§ 13 Abs
- Seite 97 und 98:
sung in der Literatur als mit Gläu
- Seite 99 und 100:
seits eingeschränkt sind, muss er
- Seite 101 und 102:
derheitsbeteiligungen an Immobilien
- Seite 103 und 104:
Für eine REIT-Aktiengesellschaft,
- Seite 105 und 106:
abgeschirmte Vermögenssphäre; 528
- Seite 107 und 108:
sikos vom REIT erwirtschafteter Gew
- Seite 109 und 110:
darf nach den Beteiligungsbeschrän
- Seite 111 und 112:
wenn zwischen Obergesellschaft und
- Seite 113 und 114:
hat damit nur noch Relevanz für Di
- Seite 115 und 116:
wendung der §§ 3 Nr. 40 EStG, 8b
- Seite 117 und 118:
net (§ 19 Abs. 1 REITG); Kapitaler
- Seite 119 und 120:
Eine abkommensrechtliche Bestimmung
- Seite 121 und 122:
Das REITG sieht für Wirtschaftspr
- Seite 123 und 124:
ten Einnahmen festsetzen. 641 Bei e
- Seite 125 und 126:
REITG). Abhängig vom gewählten Re
- Seite 127 und 128:
nach dürfte der Antrag auf Börsen
- Seite 129 und 130:
den, um es in Anspruch nehmen zu k
- Seite 131 und 132:
� Soweit in der Vergangenheit von
- Seite 133 und 134:
Auch der Vor-REIT kann wie eingangs
- Seite 135 und 136:
4. Steuerliche Folgen der Investiti
- Seite 137 und 138:
de. 722 Hierdurch käme es zu keine
- Seite 139 und 140:
Mithin erscheint die Sanktionierung
- Seite 141 und 142:
die Rechte einschränkt, zu einer v
- Seite 143 und 144:
gelbesteuerten Immobilien-Aktienges
- Seite 145 und 146:
aus Sicht privater Investoren von B
- Seite 147 und 148:
4.1.3. Auslandsbezogene Sachverhalt
- Seite 149 und 150:
che Kriterien des § 19 Abs. 5 REIT
- Seite 151 und 152:
REITs üblicherweise lediglich ein
- Seite 153 und 154:
lensteuer auf 5 % zu berücksichtig
- Seite 155 und 156:
15 %iger Steuereinbehalt (zzgl. Sol
- Seite 157 und 158:
aber zur Zusatzlast, wenn sie aufgr
- Seite 159 und 160:
schaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 REITG). I
- Seite 161 und 162:
die Erbringung entgeltlicher immobi
- Seite 163 und 164:
Hierüber hinausgehend war bei Gewi
- Seite 165 und 166:
tematisch richtige Besteuerung erre
- Seite 167 und 168:
nen in der Praxis durchaus weniger
- Seite 169 und 170:
Freistellungsverfahren, 889 das dem
- Seite 171 und 172:
tion (keine) Vorteilhaftigkeit gege
- Seite 173 und 174:
REIT-Aktiengesellschaften stehen bi
- Seite 175 und 176:
4.4. Zwischenergebnis Die wesentlic
- Seite 177 und 178:
5. Verfassungsrechtliche Analyse un
- Seite 179 und 180:
ten aufweisen kann, wird im Zuge de
- Seite 181 und 182:
die Bodenrichtwerte entsprechen Vor
- Seite 183 und 184:
esser als das ausschließlich am Gl
- Seite 185 und 186:
seitige, sondern um tatbestandsseit
- Seite 187 und 188:
Anforderungen Rechnung zu tragen ve
- Seite 189 und 190:
e in Deutschland existierende Forme
- Seite 191 und 192:
ob diese Sonderbehandlung verfassun
- Seite 193 und 194:
Ausdruck, dass Dividenden nur als a
- Seite 195 und 196:
5.2.2.2. Nichtbesteuerte Gewinne 5.
- Seite 197 und 198:
5.2.2.2.2. Reinvestitionsrücklage
- Seite 199 und 200:
deutschen Steuerrechts ist eine äh
- Seite 201 und 202:
Jacob spricht ob ihrer Geltung von
- Seite 203 und 204:
ob sowohl im Allgemeinen als auch s
- Seite 205 und 206:
dem Ziel, Belastungsgleichheit zu A
- Seite 207 und 208:
greift. Dies führt nicht nur zu re
- Seite 209 und 210:
schaft, die erst sukzessive bestimm
- Seite 211 und 212:
Thematik Möglicher Verstoß Rechtf
- Seite 213 und 214:
auffassung sei ohnehin zu beachten,
- Seite 215 und 216:
den, auf der anderen Seite, dass di
- Seite 217 und 218:
tigt sich aus steuerlicher Sicht, d
- Seite 219 und 220:
Fällen gerade zu dem zweifelhaften
- Seite 221 und 222:
Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaa
- Seite 223 und 224:
derlassungsfreiheit i. S. d. Art. 4
- Seite 225 und 226:
ner „indirekte(n) Diskriminierung
- Seite 227 und 228:
6.4. Treaty Override 6.4.1. Derogat
- Seite 229 und 230:
cher Perspektive konzentriert wird.
- Seite 231 und 232:
hätte vor dem Hintergrund europäi
- Seite 233 und 234:
staat verstoße i. d. R. nicht grun
- Seite 235 und 236:
Wären ausländische Anlagevermöge
- Seite 237 und 238:
In ihrer beihilferechtlichen Analys
- Seite 239 und 240:
6.6. Zwischenergebnis Die Ergebniss
- Seite 241 und 242:
insofern fortgeführt, durch § 19a
- Seite 243 und 244:
nach für "Großinvestoren" die Fre
- Seite 245 und 246:
Belastungsvergleich 2 Inländische
- Seite 247 und 248:
Belastungsvergleich 4 Inländische
- Seite 249 und 250:
Belastungsvergleich 6 Inländische
- Seite 251 und 252:
Belastungsvergleich 8 Inländische
- Seite 253 und 254:
Belastungsvergleich 10 Inländische
- Seite 255 und 256:
Belastungsvergleich 12 Inländische
- Seite 257 und 258:
Belastungsvergleich 14 Jahr 2009, K
- Seite 259 und 260:
Belastungsvergleich 16 Inländische
- Seite 261 und 262:
Belastungsvergleich 18 Inländische
- Seite 263 und 264:
Belastungsvergleich 20 Jahr 2009, K
- Seite 265 und 266:
FR 2010, 472, FR 2010, S. 455-462.
- Seite 267 und 268:
elles/Pressemitteilungen/2005/29403
- Seite 269 und 270:
ilien-Aktiengesellschaften mit bör
- Seite 271 und 272:
nungsmethode, S. 50-78. Cornelisse,
- Seite 273 und 274:
pital nach der Unternehmensteuerref
- Seite 275 und 276:
me Deutschlands und Spaniens, Diss.
- Seite 277 und 278:
BFIT 2010, S. 211-223. Frotscher, G
- Seite 279 und 280:
Gosch, Dietmar (DStR 2007): Vielerl
- Seite 281 und 282:
dächtnisschrift für Michael Gruso
- Seite 283 und 284:
Köln 2001, S. 155-223. Hey, Johann
- Seite 285 und 286:
Hughes, Fraser/Lewis, Gareth (in: M
- Seite 287 und 288:
Steuerlehre und Steuerberatung, Fes
- Seite 289 und 290:
Kiemel, Wolfgang (in: von der Groeb
- Seite 291 und 292:
Deutschland, in: Handbuch Real Esta
- Seite 293 und 294:
KPMG (Hrsg.) (Taxation REITs): Taxa
- Seite 295 und 296:
Besteuerung auf Ebene des REITs und
- Seite 297 und 298:
Baden 2007. Lenz, Thomas (StuB 2007
- Seite 299 und 300:
teuerreform): Einführung einer Abg
- Seite 301 und 302:
O. V. (I & F 2010): Drängen auf di
- Seite 303 und 304:
echtlichen Rechnungslegung an die I
- Seite 305 und 306:
Ruf, Martin (StuW 2008): Anforderun
- Seite 307 und 308:
Schimmelschmidt, Uwe (in: FS Mellwi
- Seite 309 und 310:
werb und Europäischen Grundfreihei
- Seite 311 und 312:
systeme - Wirkungen auf Investition
- Seite 313 und 314:
Sotelo, Ramón (GP 2008): Doppelte
- Seite 315 und 316:
Striegel, Andreas (in: Striegel (Hr
- Seite 317 und 318:
2006, S. 2105-2111. Van Kann, Jürg
- Seite 319 und 320:
Heidelberg 2010. Von Busekist, Kons
- Seite 321 und 322:
IStR 2008, S. 197-199. Wassermeyer,
- Seite 323 und 324:
REIT-Gesetz, Gesetz über deutsche
- Seite 325 und 326:
Rechtsprechungsverzeichnis 1. Europ
- Seite 327 und 328:
Amsterdam BV (C-291) und Voormeer B
- Seite 329 und 330:
15.1.2002 C-55/00, Gottardo/Istitut
- Seite 331 und 332:
Gemeinschaften/Portugiesische Repub
- Seite 333 und 334:
10.5.2007 C-492/04, Lasertec Gesell
- Seite 335 und 336:
2. Bundesverfassungsgericht Datum A
- Seite 337 und 338:
31.1.1996 2 BvL 39/93 BVerfGE 93, S
- Seite 339 und 340:
3. Bundesfinanzhof Datum Az. Fundst
- Seite 341 und 342:
13.12.2006 VIII R 79/03 BStBl. II 2
- Seite 343 und 344:
2. Europäisches Sekundärrecht Ric
- Seite 345 und 346:
Investmentgesetz (InvG) vom 15. Dez
- Seite 347:
Bundestag Drucksache 16/7036, Beric