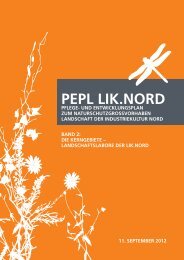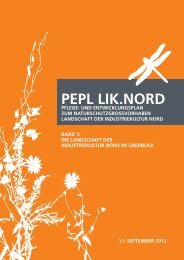Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PEPL <strong>LIK</strong>.Nord <strong>Sonderuntersuchung</strong> <strong>Heuschrecken</strong><br />
cken, etwa in den Mittelgebirgen (MAAS et al. 2002). Als Folge der Abnahme geeigneter Feuchtgebiet ist<br />
bundesweit ein Rückgang der Bestände zu verzeichnen, weshalb die Art in der Vorwarnliste geführt wird.<br />
Auch im Saarland ist sie selten, wenn auch ohne auffällige Verbreitungslücken. Aufgrund der engen Bindung<br />
an sehr nasse Habitate und dem Rückgang derartiger Flächen wird die Art jedoch in der Roten Liste<br />
des Saarlandes als stark gefährdet aufgeführt (DORDA et al. 1996).<br />
Bestand und Vorkommen in den Kerngebieten<br />
Von der Kurzflügeligen Schwertschrecke liegen Funde aus drei Kerngebieten vor: Nachweise gelangen in<br />
mit Binsen und Stauden bestandenen Quellfluren am Rande des Merchtales (Kerngebiet 2) und im Gebiet<br />
Graulheck (Kerngebiet 10) sowie in Feuchtgrünland am Oberlauf des „Fahrbachs“ („Wildbrunnen“, Kerngebiet<br />
14). Damit zählt die Art zu den selteneren <strong>Heuschrecken</strong>, die offenkundig nur in den von Offenland<br />
dominierten Kerngebieten auftritt.<br />
Von allen Fundorten liegen Beobachtungen sowohl von Imagines als auch von Larvenstadien vor. Die Art<br />
tritt in den besiedelten Habitaten jeweils gemeinsam mit der langflügeligen Schwesterart Conocephalus<br />
fuscus auf, ist jedoch im Vergleich zu dieser merklich seltener. Alle Habitate weisen zumindest kleinere<br />
Stauden- bzw. Altgrasstrukturen ohne Nutzung auf bzw. unterliegen nur teilweise einer extensiven Bewirtschaftung<br />
durch ein bis zweischürige Mahd bzw. eine Beweidung. Auffallend ist das Fehlen in den<br />
Ufersäumen und Röhrichten im Umfeld der untersuchten Schlammweiher; diese Habitattypen werden im<br />
Projektraum offenkundig ausschließlich von der Schwesterart Conocephalus fuscus besiedelt, hier teils mit<br />
hoher Individuendichte.<br />
Die Kurzflügelige Schwertschrecke ist auch im Projektraum eine Zeigerart des extensiv bewirtschafteten<br />
Feuchtgrünlandes. Als wichtiges Habitatelement sind zumindest schmale randliche Saumstrukturen innerhalb<br />
des ansonsten bewirtschafteten Grünlandes erforderlich. In den Auen entlang des Gewässersystems<br />
der ILL ist die Kurzflügelige Schwertschrecke eine noch verbreitete und stellenweise häufige Art der<br />
Feuchtwiesen, feuchten Hochstauden- und Quellfluren (SÜßMILCH 1993, S. Maas mdl. Mittl.).<br />
4.2.2 Warzenbeißer (Decticus verrucivorus)<br />
Gefährdung/Schutzstatus<br />
RL Saarland - Kategorie 3: gefährdet<br />
RL Deutschland - Kategorie 3: gefährdet<br />
besonders geschützte Art nach § 7 BNatSchG/Bundesartenschutzverordnung<br />
Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen<br />
Der Warzenbeißer besiedelt verschiedene Wiesen und Weiden; das Spektrum reicht von trockenen Magerrasen<br />
und Heiden, Saum- und Wegrändern mit geringer Vegetationsdichte bis hin zu kurzgrasigen Bergwiesen<br />
sowie Feuchtwiesen und Mooren (BELLMANN 1993). Zumeist sind die Habitate gekennzeichnet<br />
durch ein Mosaik aus offenen, oft mit Steinen besetzten Stellen sowie solchen mit dichterer Vegetation,<br />
welche den Tieren Unterschlupf bietet. Mit zunehmender Höhe sind die Habitate meist südwestexponiert<br />
(SCHLUMPRECHT & WAEBER 2003).<br />
Die Nahrung besteht zu zwei Dritteln aus tierischer sowie zu einem Drittel aus pflanzlicher Kost (HARZ<br />
1957). Die Eiablage erfolgt in offenen Stellen an Böden mit wenigstens zeitweise hoher Feuchte; in der<br />
Regel verläuft die Entwicklung über zwei Jahre mit Überwinterung in Eiruhe. Die Larven benötigen aufgrund<br />
ihres hohen Wärmebedarfs eine kurzrasige Vegetation mit hoher Sonneneinstrahlung (unter 20 cm;<br />
INGRISCH 1978, 1979).<br />
Als Mindestareal wurden Größen zwischen 3,1 ha (für Feuchtflächen) sowie 8,3 bis 33 ha für Magerrasen<br />
ermittelt (SACHLEBEN & RIESS 1997). DETZEL (1998) schätzt die Größe der benötigten Habitatfläche auf 10<br />
ha. Adulte Tiere treten zumeist nur mit wenigen Tieren pro 100 m² und damit in geringer Dichte auf;<br />
große Bestände sind ausgesprochen selten. In Zusammenhang mit der zwei bis dreijährigen Embryonal-<br />
eco�r a t – Umweltberatung & Freilandforschung 14