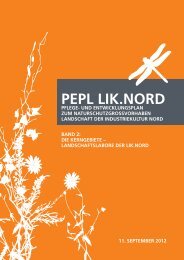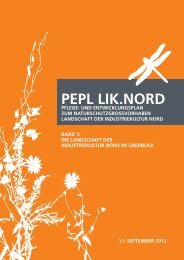Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PEPL <strong>LIK</strong>.Nord <strong>Sonderuntersuchung</strong> <strong>Heuschrecken</strong><br />
4.2.5 Weinhähnchen (Oecanthus pellucens)<br />
Gefährdung/Schutzstatus<br />
RL Saarland - Kategorie R: extrem selten<br />
RL Deutschland - ungefährdet<br />
besonders geschützte Art nach § 7 BNatSchG/Bundesartenschutzverordnung<br />
Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen<br />
Das Weinhähnchen besiedelt als thermophile Art die Kraut- und Strauchschicht von wärmebegünstigten<br />
Standorten wie Kalk-Halbtrockenrasen, Sandrasen, Sand- und Kiesgruben oder brachgefallene Weinberge.<br />
In Deutschland verläuft die nordwestliche Verbreitungsgrenze des Weinhähnchens, wobei derzeit eine<br />
Arealausdehnung entlang der größeren Flusstäler (Rhein, Mosel, Main, Lahn) zu beobachten ist (MAAS et<br />
al. 2002).<br />
Die Eiablage erfolgt in die markhaltigen Stängel verschiedener krautiger Pflanzen; während die Larven<br />
vorwiegend im Gras leben, halten sich die Imagines bevorzugt in der höheren Kraut- und Strauchschicht<br />
auf (die Imagines im Saarland vorzugsweise an Hauhechel Ononis spinosa als Nahrungspflanze). Unter<br />
günstigen Bedingungen können hohe Populationsdichten erreicht werden (mit mehr als 100 Individuen<br />
pro 25 m², DORDA 1995, 1998). Als Minimalareal für eine überlebensfähige Population werden Flächen<br />
von 0,5-1 ha (NIEHUIS 1991) bzw. 3 ha (DORDA 1995) angegeben.<br />
Im Saarland liegen die Schwerpunktvorkommen des Weinhähnchens in den Kalk-Halbtrockenrasen des<br />
südöstlichen Landesteils. Seit mehreren Jahren ist auch hier eine anhaltende Arealexpansion festzustellen,<br />
die zu zahlreichen neuen Nachweisen vor allem in den Muschelkalkgebieten des Saargaues und den<br />
Sandgebieten des Saarlouiser Raumes geführt haben (DORDA et al. 1996, eigene Beob.). Begünstigt wird<br />
dies durch das Auftreten von langflügeligen (makropteren) Formen, wodurch eine hohe Wanderfähigkeit<br />
mit Flugstrecken von bis zu 100 m resultiert (DORDA 1995). Im Zuge der allgemeinen Arealausweitung ist<br />
das Weinhähnchen neuerdings auch an Standorten wie trockenen Säumen und Böschungen, entlang von<br />
Bahnanlagen oder Industriebrachen, nachzuweisen. Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung ist der Gefährdungsstatus<br />
der gültigen Roten Liste des Saarlandes („extrem selten“, DORDA et al. 1996) nicht mehr<br />
zutreffend ist.<br />
Bestand und Vorkommen in den Kerngebieten<br />
Vom Weinhähnchen bestehen aktuelle Nachweise aus den Kerngebieten 2 (Hahnwiesweiher) und 14<br />
(Eisenhümes). Südwestlich des Hahnwiesweihers wurde Ende August ein männliches makropteres Imago<br />
in einem potenziellen Habitat, einer mageren Wiese am Talhang des Merchtals (NSG „Oberes Merchtal“)<br />
gekeschert. Ebenfalls durch Kescherfang gelang ein Einzelnachweis ( ) im krautigen Saum einer Hecke am<br />
südwestexponierten Hang des Fahrbachtals (Kerngebiet 14, Eisenhümes). Im Rahmen von zwei nachfolgenden<br />
Abendbegehungen gelangen jedoch an keinen der beiden Standorte Nachweise singender Tiere.<br />
Die vorliegenden Funde erlauben derzeit weder eine Einschätzung der Populationsgröße, noch eine Bewertung<br />
der Bodenständigkeit der Art an den beiden Fundorten. Durch eine massive und anhaltende<br />
Arealausbreitung kann das Weinhähnchen inzwischen in annähernd allen Landesteilen des Saarlandes<br />
nachgewiesen werden, entlang von Bahnlinien dringt die Art selbst bis in nördliche, höher gelegene Landesteile<br />
vor (eig. Beob.), wenn auch hier dauerhafte Ansiedlungen außerhalb von wärmebegünstigten<br />
Sonderstandorten bislang nicht belegt sind. Bis Mitte der 1990er Jahre fehlen jegliche Hinweise aus dem<br />
Projektraum (DORDA et al. 1996).<br />
An beiden Fundorten bieten sich der Art durchaus geeignete Reproduktionsmöglichkeiten, neben einer<br />
wärmebegünstigen Exposition bestehen an den Standorten geeignete Habitatstrukturen (magere Wiesen<br />
mit Altgrassäumen bzw. geringer Verbuschung) sowie Nahrungspflanzen (u. a. Hauhechel). Auch andere<br />
Kerngebiete weisen grundsätzlich geeignete Lebensräume für das Weinhähnchen auf, etwa verschiedene<br />
Bergehalten bzw. vergraste Schlackenhalden (z. B. die Halde Göttelborn) und sonstige Abbaugebiete (z. B.<br />
die Tongrube Tongrube Neunkircher Ziegelwerk, Kerngebiet 9). Von den genannten Sekundärstandorten<br />
fehlen (bislang) jedoch konkrete Nachweise; möglicherweise erschwert die isolierte Lage innerhalb des von<br />
ausgedehnten Waldflächen dominierten Naturraumes eine rasche Besiedlung der meisten Bergbauflächen.<br />
eco�r a t – Umweltberatung & Freilandforschung 18