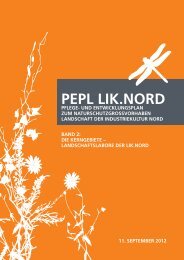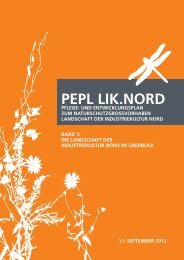Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sonderuntersuchung Heuschrecken - LIK NORD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PEPL <strong>LIK</strong>.Nord <strong>Sonderuntersuchung</strong> <strong>Heuschrecken</strong><br />
1. Veranlassung und Zielsetzung<br />
Das Naturschutzgroßvorhaben „Landschaft der Industriekultur Nord“ (<strong>LIK</strong>.Nord) liegt im mittleren Saarland<br />
und umfasst einen urban-industriellen Raum, dessen Landschaft in charakteristischer Weise von der<br />
Montanindustrie geprägt wurde. Während der südliche Teil durch einen hohen Waldanteil mit zahlreichen<br />
Landschaftsprägenden Bergbaurelikten gekennzeichnet ist, dominieren im nördlichen Teil Offenlandflächen,<br />
in denen die Entwicklung des Arbeiterbauerntums eine kleinparzellierte Nutzung gefördert hat (PLA-<br />
NUNGSGRUPPE AGL 2008). Die sehr unterschiedlichen, meist jedoch eng verzahnten Strukturen haben dadurch<br />
eine Vielzahl an Ökozonen und Übergangsbereichen hervorgebracht, die von besonderem ökologischem<br />
Interesse sind.<br />
Der Projektraum zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt an sehr verschiedenen Standortvoraussetzungen,<br />
Ökosystemen und Arten aus. Für die Landschaft der Industriekultur Nord sind zahlreiche repräsentative<br />
Arten und Lebensräume dokumentiert, die aufgrund ihres Rote-Liste-Status als gefährdet gelten oder für<br />
die das Saarland eine besondere Schutzverantwortung trägt (vgl. ZfB 2005, PLANUNGSGRUPPE AGL 2008).<br />
Aus diesem Pool sowie einem projektbedingten Entwicklungspotenzial wurden im Zuge des Projektantrages<br />
Zielarten und -biotope abgeleitet, die vorrangig geschützt und entwickelt werden sollen.<br />
Als Grundlage zur Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans für das Naturschutzgroßvorhaben erfolgte<br />
im Sommer 2011 eine aktuelle Erhebung der <strong>Heuschrecken</strong> auf ausgewählten Probeflächen, ergänzt<br />
durch Übersichtsbegehungen in bevorzugten <strong>Heuschrecken</strong>-Lebensräumen innerhalb der Kerngebiete.<br />
Im Vordergrund steht die Erfassung von wertgebenden bzw. gebietstypischen <strong>Heuschrecken</strong>arten,<br />
anhand derer sich die naturschutzfachlichen Ziele im Projektraum beispielhaft definieren und evaluieren<br />
lassen.<br />
Aufbauend auf den Ergebnissen der aktuellen Erfassung soll die <strong>Heuschrecken</strong>fauna des Projektraumes<br />
charakterisiert und bewertet werden. Hieraus werden konkrete Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
für Zielarten abgeleitet und konkretisiert.<br />
2. Methodik<br />
Die Angaben zur <strong>Heuschrecken</strong>fauna resultieren aus der jeweils zweimaligen Begehung aller 18 Kerngebiete<br />
im Juli und August 2011. Der Nachweis phänologisch früher Arten (v. a. Feldgrille, Dornschrecken)<br />
erfolgte durch zusätzliche Kontrollen entsprechender Habitate im Mai und Juni (im Rahmen der avifaunistischen<br />
Erhebungen, ECORAT 2011).<br />
Die Sommerbegehungen wurden nur an warmen, trockenen Tagen zu Zeiten maximaler <strong>Heuschrecken</strong>aktivität<br />
zwischen 10.30 und 17.00 Uhr durchgeführt. Während auf den Halden- und Abgrabungsflächen<br />
eine weitgehend flächendeckende Kontrolle erfolgte, wurden innerhalb der übrigen Offenlandschaft (z. B.<br />
in den Kerngebieten 10, 14 oder 15) die für <strong>Heuschrecken</strong> besonders geeignet erscheinenden Teilflächen<br />
gezielt aufgesucht. Waldflächen bzw. Waldsäume wurden dagegen nur stichprobenartig untersucht.<br />
Neben dem Handfang und dem gezielten Keschern einzelner <strong>Heuschrecken</strong> erfolgte die qualitative Erfassung<br />
im Wesentlichen anhand der artspezifischen Gesänge. Zum Nachweis nicht singender <strong>Heuschrecken</strong>,<br />
etwa den Arten der Gattung Tetrix, wurde direkt in von ihnen bevorzugten Strukturen (Rohbodenstandorte,<br />
Ufersäume etc.) nachgesucht.<br />
Zur Erfassung möglicher dämmerungs- und nachtaktiver Arten wurden zwei Begehungen unter Einsatz<br />
eines Detektors (SSF BAT 2) in die späten Abendstunden ausgedehnt. Neben dem etwaigen Nachweis von<br />
Arten der Gattung Barbitistes wurde der Detektor auch zum Aufspüren von Schwertschrecken (insbesondere<br />
von Conocephalus dorsalis) eingesetzt.<br />
Mit Ausnahme stichpunktartiger Kontrollen (Umdrehen von Steinen) wurde aus Naturschutzgründen auf<br />
die gezielte Suche nach der Ameisengrille Myrmecophilus acervorum, die vorwiegend in Nestern von Ameisen<br />
der Gattung Lasius lebt, verzichtet, zumal keine Hinweise auf ein etwaiges Vorkommen der Art im<br />
Projektgebiet vorlagen (S. Maas, pers. Mittl.).<br />
Als semiquantitative Erfassungsmethode fand eine Abschätzung der Individuendichte auf insgesamt 17<br />
ausgesuchten Probeflächen statt, die entweder für das Untersuchungsgebiet charakteristische Biotoptypen<br />
eco�r a t – Umweltberatung & Freilandforschung 4