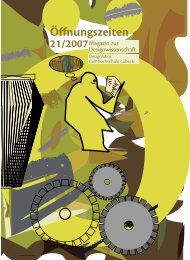Öffnungszeiten 25 / 2011 - Fachhochschule Lübeck
Öffnungszeiten 25 / 2011 - Fachhochschule Lübeck
Öffnungszeiten 25 / 2011 - Fachhochschule Lübeck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
tivierter« Wert entsteht aus einem auf der subjektiven Ebene<br />
stattfindenden sozialpsychologischen Prozess, der mit einem<br />
ausgeprägten Symbolfetischismus einhergeht – mit Design.<br />
Ein wichtiger Aspekt der Simmelschen Theorie des Geldes<br />
ist die Gegenüberstellung von Inhalt und Form. Inhalt sind<br />
die arbiträren Bedürfnisse des Individuums, seine Interessen,<br />
Motive, Zwecke, Neigungen. Sie haben zunächst keinen sozialen<br />
Charakter. Sie sind die von Simmel so genannte »Materie<br />
der Vergesellschaftung«. Diese »Materie« wird im Prozess<br />
der Vergesellschaftung in eine »Form« gestellt, herbeigeführt<br />
durch die Verbindungen, die Individuen miteinander<br />
eingehen. Anstelle von »Form« würden wir heute eher von<br />
»Struktur« sprechen. Der Charakter des Sozialen kommt<br />
zustande, indem die »Formen« als selbstständige Strukturen<br />
aus der Wechselwirkung zwischen Individuen hervorgehen.<br />
Die Individuen, in ihrem Handeln aufeinander bezogen, folgen<br />
bestimmten Ordnungsmustern (sprich Formen). Formen sind<br />
abstrakt und allgemein; innerhalb der abstrakten Formen realisieren<br />
die Individuen ihre konkreten Inhalte. Für Simmel sind<br />
Formen der Gesellschaft z. B. Familie, Gruppe, Verband, Über-<br />
und Unterordnung, Konkurrenz, Konflikte oder Arbeitsteilung.<br />
– Sicherlich wird die heutige Soziologie der Differenzierung<br />
von Form und Inhalt zustimmen können; jedoch nicht der<br />
Vorordnung des Individuums gegenüber der Gesellschaft; vielmehr<br />
erscheint die Gesellschaft als das produktive System, das<br />
Individuen überhaupt erst ermöglicht. Inhalt und Form sind<br />
eine formale Unterscheidung, keine inhaltliche.<br />
Aus dem übersummativen Zusammenwirken von Elementen<br />
– Individuen – ergeben sich nach Simmel gestalthaft Formen<br />
– Gesellschaftsdesign. Auf die Philosophie des Geldes bezogen,<br />
verwandelt sich diese Aussage in die Feststellung, Geld sei ein<br />
allgemeines Medium, das ein spezielles, individuelles Handeln<br />
erlaubt, den Tausch. Geld gestaltet einen Markt.<br />
Eine Birne für einen Apfel zu tauschen, ist dank des Geldes nicht<br />
mehr nur Inhalt (zwei Individuen, die jedes Mal neu darüber<br />
verhandeln), sondern eine Form: das Geld reguliert den Tausch.<br />
Birnen oder Äpfel werden zu Waren abstrahiert und in eine<br />
etablierte Sozialform, das Geld, übersetzt. Geld verleiht jedem<br />
Objekt einen Wert. Keine Frage aber, nicht alles hat für jedes<br />
Individuum den gleichen Wert. In einer Gesellschaft kann ein<br />
Gegenstand für ein Individuum den höchsten, für ein anderes<br />
den niedrigsten Wert repräsentieren. Diese Subjektivität, so<br />
Simmel, ist nicht Willkür. Dem Subjekt ist schon bewusst, dass<br />
es am sozialen Wert meist so wenig ändern kann wie an den<br />
übrigen Wirklichkeiten. Der soziale Wert des Gegenstandes<br />
kann das Subjekt aber gleichgültig lassen. So kann es nach<br />
Simmel sein, dass jemand einem Objekt einen subjektiven<br />
Wert gibt, den niemand anderer bereit ist, zu akzeptieren. Der<br />
Wert bleibt aber für diese Person genauso hoch, auch wenn das<br />
Objekt dadurch unverkäuflich wird 6 . Hier kämen, so Simmel,<br />
30 <strong>Öffnungszeiten</strong> <strong>25</strong> / <strong>2011</strong><br />
individuelle Inhalte zur Geltung. Das Mittel Geld lässt also<br />
zwar eine Objektivierung zu, subjektive Werte, die zu dieser<br />
Objektivierung führen, sind dann durch die Bereitschaft, etwas<br />
für das Objekt zu opfern, zu messen. Geld erlaubt es dem<br />
Individuum, einen Wert für das Objekt zu geben oder zu verlangen,<br />
einen Wert, der durch die Geldquantität intersubjektiv<br />
messbar wird.<br />
Simmel schreibt: »Von der Mehrzahl der Objekte kann<br />
man sagen: sie sind nicht wertvoll, sondern sie werden es –<br />
denn dazu müssen sie fortwährend aus sich heraus und in<br />
Wechselwirkung mit anderen treten; es sind nur Wirkungen<br />
ihrer, an die sich ein Wertgefühl knüpft.« 7 Der objektivierte<br />
Wert geht nach Simmel also aus der Summe subjektiver<br />
Bewertungen hervor. Was die heutige Wirtschaftstheorie – siehe<br />
Marketing – etwas anders akzentuiert.<br />
Geld als »objektives« Symbol<br />
Wieso kann etwas zugleich subjektiv und objektiv existieren,<br />
wie das Geld? Simmel meint, »der Mensch ist das tauschende<br />
Tier; […] der Mensch ist das objektive Tier. Nirgends in der<br />
Tierwelt finden wir auch nur Ansätze zu demjenigen, was<br />
man Objektivität nennt, der Betrachtung und Behandlung<br />
der Dinge, die sich jenseits des subjektiven Fühlens und<br />
Wollens stellt« 8 . Durch Geld werden die wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse der Objekte, ihre Tauschbarkeit, ausdifferenziert,<br />
und zwar durch die quasi begriffliche Existenz des Geldes, die<br />
an ein sichtbares Symbol geknüpft ist 9 . Geld verkörpert sich<br />
in Münzen und Geldscheinen, die sich wie die Wörter einer<br />
Sprache verhalten. Geld bekommt so eine Art Universalität<br />
(verschiedene Sprachen – verschiedene Geldscheine; aber<br />
dieselbe Sache Geld).<br />
Nach Simmel findet ein Tausch statt, wenn eine Leerstelle, die<br />
durch das Geben (oder die Trennung) eines Objekts entstanden<br />
ist, mit einem vermeintlich noch wertvolleren Objekt ausgefüllt<br />
wird. »[…] Schema des Tausches: von der niedrigsten<br />
Bedürfnisbefriedigung bis zum Erwerbe der höchsten intellektuellen<br />
und religiösen Güter muß immer ein Wert eingesetzt<br />
werden, um einen Wert zu gewinnen.« 10 Nach Simmel vollzieht<br />
sich unser gesamtes Handeln in Tausch-Kategorien, da jedes<br />
Gut die Hingabe eines Gegengutes verlangt. Hierbei ist schließlich<br />
ein Wechsel von Qualität zur Quantität möglich, d. h. zum<br />
Geld. Für den Vorteil etwa, durch intellektuelle Tätigkeit seinen<br />
Lebensunterhalt zu verdienen, war immer das Opfer eines großen<br />
Zeit- und Energieeinsatzes für die Aus- und Weiterbildung<br />
zu erbringen; eine quantitative Kompensation wäre dafür<br />
zu erwarten in Form höheren Einkommens. In der heutigen<br />
Gesellschaft findet diese Kompensation in der Regel nicht<br />
mehr statt. Das Gut »Freizeit« muss für das Gut »intellektuelle<br />
Tätigkeit« ohne quantitative Kompensation hingegeben<br />
werden. Die quantitative Kompensation wird heute eher für