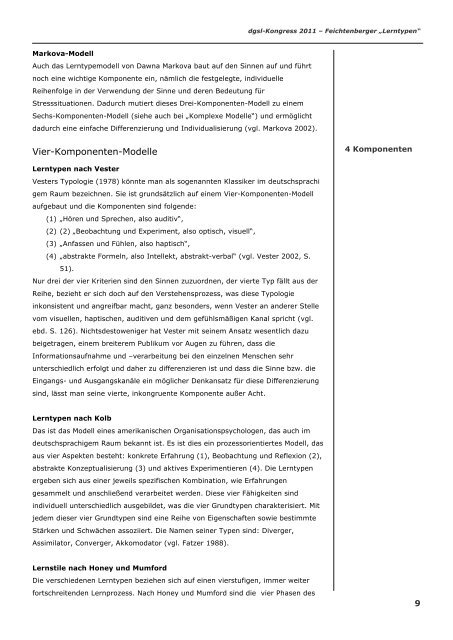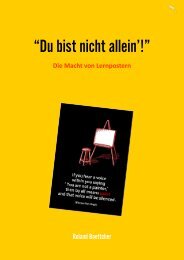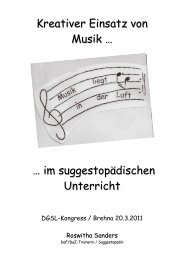Feichtenberger-Dosta.. - DGSL
Feichtenberger-Dosta.. - DGSL
Feichtenberger-Dosta.. - DGSL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Markova-Modell<br />
Auch das Lerntypemodell von Dawna Markova baut auf den Sinnen auf und führt<br />
noch eine wichtige Komponente ein, nämlich die festgelegte, individuelle<br />
Reihenfolge in der Verwendung der Sinne und deren Bedeutung für<br />
Stresssituationen. Dadurch mutiert dieses Drei-Komponenten-Modell zu einem<br />
Sechs-Komponenten-Modell (siehe auch bei „Komplexe Modelle“) und ermöglicht<br />
dadurch eine einfache Differenzierung und Individualisierung (vgl. Markova 2002).<br />
Vier-Komponenten-Modelle<br />
Lerntypen nach Vester<br />
Vesters Typologie (1978) könnte man als sogenannten Klassiker im deutschsprachi<br />
gem Raum bezeichnen. Sie ist grundsätzlich auf einem Vier-Komponenten-Modell<br />
aufgebaut und die Komponenten sind folgende:<br />
(1) „Hören und Sprechen, also auditiv“,<br />
(2) (2) „Beobachtung und Experiment, also optisch, visuell“,<br />
(3) „Anfassen und Fühlen, also haptisch“,<br />
(4) „abstrakte Formeln, also Intellekt, abstrakt-verbal“ (vgl. Vester 2002, S.<br />
51).<br />
Nur drei der vier Kriterien sind den Sinnen zuzuordnen, der vierte Typ fällt aus der<br />
Reihe, bezieht er sich doch auf den Verstehensprozess, was diese Typologie<br />
inkonsistent und angreifbar macht, ganz besonders, wenn Vester an anderer Stelle<br />
vom visuellen, haptischen, auditiven und dem gefühlsmäßigen Kanal spricht (vgl.<br />
ebd. S. 126). Nichtsdestoweniger hat Vester mit seinem Ansatz wesentlich dazu<br />
beigetragen, einem breiterem Publikum vor Augen zu führen, dass die<br />
Informationsaufnahme und –verarbeitung bei den einzelnen Menschen sehr<br />
unterschiedlich erfolgt und daher zu differenzieren ist und dass die Sinne bzw. die<br />
Eingangs- und Ausgangskanäle ein möglicher Denkansatz für diese Differenzierung<br />
sind, lässt man seine vierte, inkongruente Komponente außer Acht.<br />
Lerntypen nach Kolb<br />
Das ist das Modell eines amerikanischen Organisationspsychologen, das auch im<br />
deutschsprachigem Raum bekannt ist. Es ist dies ein prozessorientiertes Modell, das<br />
aus vier Aspekten besteht: konkrete Erfahrung (1), Beobachtung und Reflexion (2),<br />
abstrakte Konzeptualisierung (3) und aktives Experimentieren (4). Die Lerntypen<br />
ergeben sich aus einer jeweils spezifischen Kombination, wie Erfahrungen<br />
gesammelt und anschließend verarbeitet werden. Diese vier Fähigkeiten sind<br />
individuell unterschiedlich ausgebildet, was die vier Grundtypen charakterisiert. Mit<br />
jedem dieser vier Grundtypen sind eine Reihe von Eigenschaften sowie bestimmte<br />
Stärken und Schwächen assoziiert. Die Namen seiner Typen sind: Diverger,<br />
Assimilator, Converger, Akkomodator (vgl. Fatzer 1988).<br />
Lernstile nach Honey und Mumford<br />
Die verschiedenen Lerntypen beziehen sich auf einen vierstufigen, immer weiter<br />
fortschreitenden Lernprozess. Nach Honey und Mumford sind die vier Phasen des<br />
dgsl-Kongress 2011 – <strong>Feichtenberger</strong> „Lerntypen“<br />
4 Komponenten<br />
9