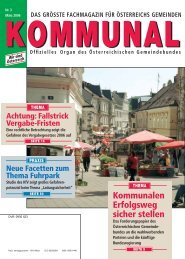Download Ausgabe 6 - Kommunal
Download Ausgabe 6 - Kommunal
Download Ausgabe 6 - Kommunal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5<br />
Nr. 6<br />
Juni 2004 DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN<br />
KOMMUNAL<br />
Offizielles Organ des Österreichischen Gemeindebundes<br />
Wir sind<br />
Österreich<br />
PRAXIS<br />
Verkehrssicherheit<br />
Gemeindebund startet mit zwei<br />
Kampagnen in den Sommer<br />
THEMA<br />
Finanzausgleich<br />
Start der Verhandlungen: Ziele und<br />
Vorstellungen klaffen auseinander Nachbars Bäume<br />
DVR: 0930 423<br />
SEITE 70<br />
SEITE 8<br />
P.b.b. Verlagspostamt · 1014 Wien 02 Z 032902M ISSN: 1605-1440<br />
THEMA<br />
sind ab sofort<br />
Gemeindesache!<br />
Neues Nachbarschaftsrecht<br />
macht Klagen wegen Bäumen,<br />
Licht und Luft möglich. Versuchte<br />
Beilegung des Streits ist<br />
zwingend und wird vermutlich<br />
massiv die Gemeinden<br />
beschäftigen.<br />
SEITE 10
25583_KK_HUEMER_A4 17.03.2004 16:08 Uhr Seite 1<br />
1.)<br />
SETZEN SIE BEI GEMEINDEFINANZIERUNGEN AUF<br />
DAS KNOW-HOW DER NR.1 TEL. 01/31 6 31<br />
www.kommunalkredit.at<br />
DIE SPEZIALBANK FÜR PUBLIC FINANCE<br />
1.) g.huemer@kommunalkredit.at
Gemeindepolitik<br />
6 Start der Finanzausgleichsverhandlungen:<br />
Erstes Abtasten zeigt Einigung weit entfernt<br />
8 FAG – Die Verhandlungen haben begonnen:<br />
Keine Investitionen, kein Aufschwung<br />
14 Teilpensionsgesetz: Erwerbseinkommen<br />
bestimmt die Pensionen<br />
12 Österreichischer Gemeindetag 2004<br />
17 Public Services / KOMMUNALMESSE und<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress 2004<br />
20 Entwicklung des Zentralismus in Österreich:<br />
Rutschen die Gemeinden in die Abhängigkeit?<br />
Recht & Verwaltung<br />
10 Neues Nachbarrecht gilt ab 1. Juli 2004:<br />
Wie weit betrifft es die Gemeinden<br />
22 Asyl & Caritas: Bekenntnis und Mut fehlen zur<br />
Umsetzung der § 15a-Vereinbarung<br />
26 Bäderhygienegesetz: Nach Vorschrift abgekühlt<br />
Gemeindefinanzen<br />
18 Gemeinschaftliche Bundesabgaben sinken:<br />
Ertragsanteile entwickeln sich schwach<br />
Europapolitik<br />
28 ICNW startet die inhaltliche Arbeit:<br />
Erste Sitzungen in Südtirol und Katalanien<br />
30 Weißbuch zur Daseinsvorsorge:<br />
Klare Absage an Rahmenrichtlinie<br />
KOMMUNAL<br />
PRAXIS<br />
Energie in der Gemeinde<br />
44 Einsatzmöglichkeiten für erneuerbare<br />
Energie in den Kommunen<br />
50 Lokale Energieversorgung:<br />
Die Möglichkeiten und die Grenzen<br />
66 Wohnbauförderung muss bleiben<br />
70 Verkehrssicherheit in Gemeinden:<br />
Zwei Kampagnen sollen helfen<br />
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
82 Frauen in der <strong>Kommunal</strong>politik:<br />
Bürgermeisterin Helga Hammerschmid<br />
84 <strong>Kommunal</strong>e Grenzüberschreitung:<br />
Die Wirtschaftsregion Eibiswald/Padlje<br />
86 Aus den Bundesländern<br />
90 Info-Mix<br />
Inhalt<br />
KOMMUNAL 3
SCHNELLER SCHALTEN!<br />
Richtig in Fahrt kommen zum Thema<br />
<strong>Kommunal</strong>fahrzeuge - auf der Messe für<br />
<strong>Kommunal</strong>wirtschaft und Umwelttechnik<br />
Internationale Fachmesse<br />
für Umwelttechnik<br />
Internationale Fachmesse für<br />
Öffentliche Verwaltung, Infrastruktur<br />
und kommunale Ausstattung<br />
10. – 12. November 2004 | Messezentrum Wien<br />
Informieren Sie sich unter Tel. (0)1 727 20-351<br />
public-services@messe.at, pollutec@messe.at<br />
www.public-services.at, www.pollutec.at
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Österreichischer Gemeindebund,<br />
Löwelstraße 6, 1010 Wien<br />
Medieninhaber:<br />
Österreichischer <strong>Kommunal</strong>-Verlag GmbH.,<br />
Löwelstr. 6/5, Pf. 201,1014 Wien,<br />
Tel. 01/532 23 88,<br />
Fax 01/532 23 77,<br />
e-mail:kommunalverlag@kommunal.at<br />
Geschäftsführung:<br />
Bgm. a.D. Prof. Walter Zimper<br />
Walter Zimper jun.<br />
Sekretariat: Patrizia Poropatits<br />
e-mail: patrizia.poropatits@kommunal.at<br />
www.kommunal.at<br />
Redaktion:<br />
Mag. Hans Braun - DW 16 (Leitung)<br />
Walter Grossmann - DW 15<br />
Tel.: 01/ 532 23 88<br />
e-mail: redaktion@kommunal.at<br />
Anzeigenberatung:<br />
Tel.: 01/532 23 88<br />
Johanna K. Ritter – DW 11 (Leitung)<br />
johanna.ritter@kommunal.at<br />
Mag. Sabine Brüggemann – DW 12<br />
sabine.brueggemann@kommunal.at<br />
Franz Krenn – DW 13<br />
franz.krenn@kommunal.at<br />
Gerhard Klodner – DW 14<br />
gerhard.klodner@kommunal.at<br />
Grafik:<br />
Österreichischer <strong>Kommunal</strong>-Verlag GmbH.,<br />
Ernst Horvath<br />
grafik@kommunal.at<br />
Fotos: Bilder-Box<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Mag. Ewald Buschenreiter (Verbandsdirektor<br />
der sozialdemokratischen Gemeindevertreter NÖ),<br />
Mag. Nicolaus Drimmel<br />
(Österreichischer Gemeindebund),<br />
Dr. Gustav Fischer (BM für Land- und Forstwirtschaft,<br />
Umwelt und Wasserwirtschaft),<br />
Mag. Michael Girardi (BM für Inneres),<br />
Mag. Gerald Grosz (BM für soziale Sicherheit<br />
und Generationen),<br />
Dr. Roman Häußl (Experte f. Gemeinderecht),<br />
Dr. Robert Hink (Generalsekretär des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Mag. Christoph Hörhan (BM für<br />
Gesundheit und Frauen),<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer (Präsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Dietmar Pilz (Finanzexperte des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Univ. Prof. Dr. Reinbert Schauer<br />
(Johannes Kepler-Universität Linz),<br />
Mag. Barbara Schüller (Bundeskanzleramt)<br />
Prof. Walter Zimper (Verleger),<br />
Walter Zimper jun. (Geschäftsführer).<br />
Hersteller:<br />
Leykam, Wr. Neustadt<br />
Persönlich gezeichnete Artikel fallen unter die<br />
Verantwortlichkeit des Autors und müssen sich<br />
nicht unbedingt mit der Meinung von<br />
KOMMUNAL decken. Mit E.E. gekennzeichnete<br />
Artikel sind bezahlte Wirtschaftsinfos und fallen<br />
nicht in die Verantwortlichkeit der Redaktion.<br />
Auflage: 35.083<br />
Teilen dieser <strong>Ausgabe</strong> liegen Informationen<br />
der Österreichischen Heraklith AG,<br />
des Fachverbands der Stein- und<br />
Keramischen Industrie und PowerGIS bei.<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Editorial<br />
Gerade rechtzeitig zu Beginn der Verhandlungen um einen neuen Finanzausgleich zwischen<br />
Bund, Ländern und Gemeinden veröffentlicht der wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
am Österreichischen Institut für Familienforschung, Josef Meichenitsch, in KOMMUNAL<br />
eine Studie, die die Einnahmen der Gebietskörperschaften in den Jahren 1985 bis 2000<br />
untersucht (Seite 20). Seine zentralen Erkenntnisse reichen weit über den aktuellen<br />
Verteilungskampf hinaus und gipfeln in der Feststellung, daß sich die Zentralstaatlichkeit<br />
in Österreich in diesen Jahren – ausgehend von einem international ohnehin sehr<br />
hohen Niveau – weiter erhöht hat.<br />
Damit wird eine Entwicklung aufgezeigt und objektiviert, die von Österreichs<br />
<strong>Kommunal</strong>politikern schon seit längerem sorgenvoll registriert wird und an vielen<br />
Details festgemacht werden kann.<br />
Abgesehen davon, daß durch etliche stille Änderungen des Verteilungsschlüssels den<br />
Ländern und Gemeinden Ertragsanteile entzogen und dem Bund zugeschlagen<br />
wurden, sind es die vielen kleinen Nadelstiche, die in ihrer Gesamtheit ein Loch in die<br />
kommunalen Budgets schlagen, mit denen außerdem noch vermehrte Aufgaben<br />
finanziert werden müssen.<br />
Die nicht abgegoltene Übernahme von Kompetenzen für das Paßwesen hat Österreichs<br />
Kommunen zum Beispiel nicht runiert, aber zusammen mit den Gemeinde-Leistungen<br />
für die bundesweiten Geodaten über die leise Zuordnung neuer Zuständigkeiten von A<br />
bis Z (von Asylanten bis Zwistigkeiten unter Nachbarn) bis zum deutlichen Minderersatz<br />
der Kosten für die Europawahlen (nur 3,6 statt 15 Millionen Euro) summieren<br />
sich die den Gemeinden zugeschobenen Bälle zu einer Lawine der Belastungen, die<br />
längst an die Grenzen der Zumutbarkeit gestoßen ist.<br />
Daß Österreichs Gemeinden unter solchen Umständen noch immer die Verpflichtungen<br />
aus dem Stabilitätspakt einhalten, grenzt bereits an ein Wunder. Daß in dieser Situation<br />
aber die Sparappelle des Finanzministers, ausgerechnet an die Adresse der Gemeinden,<br />
nur Kopfschütteln auslösen, ist allerdings nicht verwunderlich.<br />
In dieser kommunalpolitischen Großwetterlage beginnt also der Verteilungskampf der<br />
Gebietskörperschaften im Rahmen des Finanzausgleichs und man darf gespannt sind,<br />
wie sich das Spannungsfeld zwischen dem Diktat der leeren Taschen und dem Zwang<br />
zu konkreten Handlungen auflösen läßt.<br />
Als Silberstreif am Horizont erscheinen die jüngsten Wirtschaftsprognosen, die noch für<br />
heuer ein Wachstum zwischen zwei und drei Prozent und ab 2005 um noch ein<br />
bißchen mehr vorhersagen. Tritt das ein, kann man über Finanzmittel verhandeln, die<br />
noch niemand zugeordnet sind und deren Aufbringung ohne schmerzliche Abstriche<br />
vonstatten gehen kann. Allerdings: wer übernimmt die Garantie für diese Prognosen<br />
und wer übernimmt die Ausfallshaftung bei deren Fehldeutung?<br />
Österreichs <strong>Kommunal</strong>vertreter gehen in diese Verhandlungen in der Überzeugung,<br />
daß es besser werden muß, weil es nicht mehr schlechter werden kann. Und die<br />
Bundes- und Landesvertreter seien rechtzeitig daran erinnert, daß auch die befreienden<br />
Wirtschaftsprognosen nur eintreffen, wenn die Gemeinden als größter öffentlicher<br />
Investor ihren notwendigen Anteil daran auch leisten können.<br />
Kurz gesagt: nur wer JETZT den Gemeinden das notwendige Geld zugesteht, kann<br />
damit rechnen, daß auch er später zu seinen Einnahmen kommt. Ist doch eigentlich<br />
ganz einfach, oder?<br />
Prof. Walter Zimper<br />
Verleger und Vizepräsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
KOMMUNAL 5
Kommentar<br />
Start der Finanzausgleichsverhandlungen ein Abtasten<br />
Einigung weit entfernt<br />
Das Ritual hat wie üblich begonnen.<br />
Der Auftakt der Finanzausgleichsverhandlunden<br />
verlief fast<br />
programmgemäß. Die einzelnen<br />
Gebietskörperschaften haben ihre<br />
Forderungspakete am Tisch gelegt. Die<br />
Länder haben in ihrem Programm<br />
Wünsche im Ausmaß von über drei<br />
Milliarden eingefordert, der Bund hat<br />
demgegenüber von den Ländern die<br />
Kosten der Lehrer verlangt, und die<br />
Wohnbauförderung in Frage gestellt.<br />
Soweit zum gegenseitigen Aufrechnen<br />
oder zum üblichen Geplänkel.<br />
Demgegenüber haben die Gemeinden<br />
sich auf wenige, aber durchaus berechtigte<br />
Knackpunkte beschränkt.<br />
Uns geht es um mehr Gerechtigkeit in<br />
zweierlei Hinsicht: Zum einen waren<br />
die Gemeinden in den vergangenen<br />
Jahren die größten Verlierer bei<br />
zunehmenden Aufgaben. Selbst der<br />
Finanzminister hat mit seiner Statistik<br />
zugegeben, dass die Gemeinden seit<br />
1990 die relativ größten Einbussen bei<br />
der Verteilung des gemeinsamen<br />
Steuerkuchens hinnehmen mussten.<br />
Um rund zwei Prozent ist der Anteil der<br />
Gemeinden zurückgegangen. Wir<br />
wollen, dass diese ungleiche Behandlung,<br />
die zu Lasten der Investitionen auf<br />
regionaler Ebene geht und dazu geführt<br />
hat, dass rund ein Drittel aller österreichischen<br />
Gemeinden nicht mehr in<br />
der Lage ist, ein ausgeglichenes Budget<br />
zu erstellen, durch einen höheren<br />
Prozentsatz beendet wird. Zum anderen<br />
wollen wir in Zukunft sicherstellen,<br />
dass sich diese negative Schere für die<br />
Gemeinden nicht weiter öffnet, sondern<br />
durch einen einheitlichen Schlüssel<br />
gewährleistet ist, dass sich der Bund bei<br />
den Steuern die besten heraussucht und<br />
die wenig ertragreichen für den Anteil<br />
der Gemeinden heranzieht.<br />
Und schließlich geht es den<br />
Gemeinden darum, dass sie mit<br />
ihren explodierenden Kosten für<br />
Kinderbetreuung, Sozial- und Gesundheitswesen<br />
nicht als Lastesel der Nation<br />
übrigbleiben.<br />
Dem Bund ging es in der ersten Runde<br />
darum, den Ländern und Gemeinden<br />
die kalte Schulter zu zeigen. Nämlich,<br />
dass weder der Topf größer wird noch<br />
6 KOMMUNAL<br />
die Gewichtungen innerhalb des Topfes<br />
verschoben werden können.<br />
Die Länder haben signalisiert, dass sie<br />
bei einer Erleichterung im Spitalsbereich<br />
durchaus zu einer Verlängerung<br />
des bestehenden Finanzausgleiches<br />
bereit wären. Dies wiederum kann von<br />
uns Gemeinden keinesfalls akzeptiert<br />
werden. Weil damit unsere anderen<br />
Probleme wie die Pflege unserer älteren<br />
Mitbürger nicht gelöst wird. Geeinigt<br />
hat man sich nun lediglich darauf,<br />
dass in kleineren Gruppen weiterverhandelt<br />
wird und die realistischen Vorschläge<br />
aufgelistet werden. Dass der<br />
beabsichtige Zeitrahmen, nämlich bis<br />
Herbst ein Ergebnis zu erreichen, eingehalten<br />
wird, ist eher unwahrscheinlich.<br />
Eines ist aber den Gemeinden gelungen,<br />
nämlich Verständnis dafür zu finden,<br />
dass der Bogen der Belastbarkeit<br />
für die Gemeinden in manchen Bereichen<br />
bereits jetzt überspannt ist. Es ist<br />
einfach nicht möglich, bei stagnierenden<br />
Einnahmen, ständig neue und<br />
mehr Aufgaben zu erfüllen. Die Verhältnisse<br />
in den deutschen Kommunen<br />
sollten ein abschreckendes Beispiel<br />
sein. Dort müssen Freibäder und Bibliotheken<br />
geschlossen, die Straßenbeleuchtungen<br />
abgedreht, die Investitionen<br />
auf Null geschraubt und das<br />
Service für die Bürger massiv eingeschränkt<br />
werden.<br />
Österreichs Gemeinden und Bürgern<br />
soll ein derartiges Schicksal<br />
erspart werden. Unsere Gemeinden<br />
haben in den vergangenen Jahren<br />
gezeigt, dass sie mit Reformen und<br />
eisernem Sparwillen die gestellten Aufgaben<br />
auch erfüllen. Sie haben mit<br />
einem Jahresvolumen von 1,5 Milliarden<br />
Euro mehr gespart als jede andere<br />
Gebietskörperschaft. Aber jetzt sind sie<br />
an die Grenzen gestoßen. Das muss<br />
auch unseren Finanzausgleichspartnern<br />
bewußt sein.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Präsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
»<br />
Der Bogen der<br />
Belastbarkeit für<br />
die Gemeinden ist in<br />
mehreren Bereichen<br />
überspannt. Es ist<br />
nicht möglich, bei<br />
stagnierenden<br />
Einnahmen ständig<br />
neue und mehr<br />
Aufgaben zu erfüllen.<br />
«
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
FAG-Verhandlungen: Augenmaß und gegenseitiger Respekt gefordert<br />
Mehr Fairness beim Finanzausgleich<br />
„Die Verhandlungen zum<br />
Finanzausgleich (FAG) müssen<br />
mit Augenmass und<br />
Respekt geführt werden. Es<br />
nützt weder dem Bund noch<br />
den Ländern oder den<br />
Gemeinden, sich gegenseitig<br />
Ruten ins Fenster zu stellen“,<br />
sprach sich Anfang Juni der<br />
ÖVP-Abgeordnete Nikolaus<br />
Prinz wie vor ihm schon mehrere<br />
hochrangige Politiker<br />
ebenfalls für mehr Fairness<br />
beim Finanzausgleich aus.<br />
Um ein weiteres finanzielles<br />
Frühjahrsprognose<br />
Aufschwung<br />
festigt sich<br />
Wenige Tage vor Sommerbeginn<br />
hat die Österreichische<br />
Nationalbank ihre Frühjahrsprognose<br />
veröffentlicht.<br />
Wenig spektakuläre Aussage:<br />
Der Aufschwung festigt sich.<br />
„Das Wirtschaftswachstum<br />
wird im 4. Quartal mit knapp<br />
drei Prozent seinen Höhepunkt<br />
erreichen“, sagte<br />
OeNB-Direktoriumsmitglied<br />
Josef Christl Mitte Juni bei<br />
der Präsentation. Der größte<br />
Unsicherheitsfaktor dieser<br />
Prognose: der Ölpreis.<br />
Die Ansiedelung großer<br />
Konzerne in strukturschwachen<br />
Regionen der „alten“<br />
15 EU-Mitglieder soll nach<br />
Brüsseler Plänen ab 2006<br />
nicht mehr gefördert werden<br />
dürfen. Laut „Der Standard“<br />
warnen Experten,<br />
dass Österreich dann<br />
gegenüber den neuen Mitgliedern<br />
chancenlos wäre.<br />
Dieses derzeit heiß diskutierte<br />
Förderverbot würde<br />
in Österreich künftig fak-<br />
Aushungern der Gemeinden<br />
zu verhindern, ist es notwendig,<br />
mit behutsamen Schritten<br />
einander näher zu kommen.<br />
„Hier müssen wir die Fakten<br />
sprechen lassen und nicht die<br />
Taktik“, so Prinz. Als Bürgermeister<br />
der kleinen Gemeinde<br />
St. Nikola an der Donau (Bez.<br />
Perg/OÖ.) kennt Nikolaus<br />
Prinz die Fakten sehr genau.<br />
„Die Abgaben werden immer<br />
mehr, die Einnahmen aber<br />
immer weniger“, so der Abgeordnete.<br />
„Als größte öffentli-<br />
EU der 25: Verheugens Strategiepapier<br />
Keine neuen Trennlinien in Europa<br />
Mitte Mai schlug EU-Kommissar<br />
Verheugen konkrete<br />
Schritte vor, um zu gewährleisten,<br />
dass nach dem historischen<br />
1. Mai keine neuen<br />
Trennlinien zwischen der EU<br />
und ihren Nachbarn entstehen.<br />
Darum verabschiedete<br />
EU-Regionalförderung: Aus ab 2006 ?<br />
Keine Chance für „Alte EU“<br />
tisch sämtliche relevanten<br />
Investitionsprojekte in<br />
Grenzregionen treffen. Es<br />
käme zu einem extremen<br />
„Fördergefälle“ zu den<br />
neuen EU-Mitgliedern. Deswegen<br />
sind nicht nur viele<br />
Regionalpolitiker aufgebracht,<br />
auch die Landeshauptleute<br />
hätten bereits<br />
Front gegen diesen EU-Plan<br />
gemacht. Tenor: Österreich<br />
braucht nicht wie Frankreich<br />
„verlassene Dörfer“.<br />
che Investoren, als wesentliche<br />
Arbeitsplatzerhalter der<br />
ländlichen Regionen dürfen<br />
die Gemeinden nicht länger<br />
zu den Nettozahlern Österreichs<br />
gehören. Ein gerechter<br />
Finanzausgleich muss her“,<br />
fordert Prinz.<br />
Die Regierung aufzufordern,<br />
die notwendigen finanziellen<br />
Mitteln zur Verfügung zu stellen,<br />
ist richtig, allein der Weg<br />
über die Regierungsschelte sei<br />
unproduktiv. Mehr über FAG<br />
auf den Seiten 8 und 9.<br />
die Kommission nun ein „Strategiepapier“,<br />
in dem aufgezeigt<br />
wird, wie die Vorteile der<br />
Erweiterung auch den neuen<br />
Nachbarn zugute kommen<br />
können. Zufriedene Staaten<br />
wären auch im Interesse ganz<br />
Europas.<br />
Schnellere Infos<br />
für 75 Milllionen<br />
Jugendliche.<br />
Foto: © European Community, 2004<br />
Foto: Bernhard J. Holzner<br />
„Die Gemeinden dürfen nicht<br />
länger zu den Nettozahlern<br />
Österreichs gehören“, fordert<br />
NR Bgm. Nikolaus Prinz<br />
EU-Jugendportal: Schnelles Internet<br />
Neuer Schwung für die<br />
Jugend Europas<br />
Das Europäische Jugendportal<br />
http://<br />
europa.eu.int/youth/ ,<br />
das als Anlaufstelle für<br />
junge Menschen dienen<br />
soll, die Europa<br />
kennen lernen und<br />
sich engagieren wollen,<br />
ist von den Kommissionsmitgliedern<br />
Viviane Reding und<br />
Dalia Grybauskaite<br />
eröffnet worden. Das<br />
Europaregion Mitte<br />
Neue Impulse für<br />
„Centrope“<br />
Im September 2003 wurde im<br />
burgenländischen Kittsee<br />
(KOMMUNAL berichtete) der<br />
Startschuss für eine Europaregio<br />
Mitte gegeben. Über<br />
einen Schülerwettbewerb<br />
wurde der Name „Centrope“<br />
geboren. Während es im<br />
Schul-Bereich vorbildlich<br />
funktioniert, mangelt es vor<br />
allem im Bereich „Verkehr“.<br />
Vor allem die Projektfinanzierung<br />
durch den Bund scheint<br />
ein Schwachpunkt für die<br />
Europaregion zu sein.<br />
Jugendportal war im<br />
Weißbuch „Neuer<br />
Schwung für die<br />
Jugend Europas“<br />
angeregt worden und<br />
soll möglichst vielen<br />
der 75 Mio. jungen<br />
Menschen in Europa<br />
einen schnellen, problemlosen<br />
Zugang zu<br />
relevanten jugendbezogenenInformationen<br />
eröffnen.<br />
KOMMUNAL 7
Politik<br />
Finanzausgleich: Verhandlungen haben begonnen<br />
Keine Investitionen,<br />
kein Aufschwung<br />
Bund, Länder und Gemeinden haben ihre Positionen bezogen und bereits die<br />
erste Sitzung der Finanzausgleichsverhandlungen hat deutlich gemacht, dass die<br />
Zielvorstellungen weit auseinander klaffen. Ein KOMMUNAL-Bericht über die Position<br />
und die Vorstellungen der österreichischen Gemeinden.<br />
◆ Dr. Robert Hink<br />
Die verschiedenen Positionen und die<br />
Wirtschaftsprognosen lassen sehr harte<br />
und schwierige Gespräche erwarten.<br />
Umso wichtiger ist es, die Bürger ehrlich<br />
zu informieren,<br />
warum und in wessem<br />
Interesse die Gemein-<br />
den mehr Geld fordern.<br />
Also Überzeugungsarbeit<br />
zu leisten.<br />
Was das Vorgeplänkel<br />
über die Medien<br />
bereits erahnen ließ,<br />
ist nach der ersten offiziellen<br />
Sitzung am 21.<br />
Juni Gewißheit geworden:<br />
Vor den Finanzausgleichspartnern<br />
liegt ein langer und<br />
steiniger Weg mit hohen Hürden.<br />
Schließlich ist die Ausgangslage alles<br />
andere als rosig. Der Wirtschaftsaufschwung<br />
läßt weiter auf sich warten<br />
und die vom Nationalrat beschlossene<br />
Steuerreform – also die Senkung der<br />
◆ Hofrat Dr.<br />
Robert Hink ist Generalsekretär des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
8 KOMMUNAL<br />
Vor den Finanzausgleichspartnern<br />
liegt ein<br />
langer und steiniger Weg<br />
mit hohen Hürden. Die<br />
Ausgangslage ist alles<br />
andere als rosig.<br />
Steuerquote auf 42 und in der Folge<br />
auf 40 Prozent – muß verkraftet werden.<br />
Als Konsequenz sagen die Experten<br />
für das kommende Jahr 2005 ein<br />
Staatsdefizit von 1,9<br />
bis 2 Prozent des<br />
Bruttoinlandspro-<br />
duktes voraus.<br />
Uns ist durchaus<br />
klar: Nachdem es<br />
zusätzliche Steuern<br />
nicht geben können<br />
wird, muß jeder<br />
Euro, den die<br />
Gemeinden mehr<br />
erhalten, das Defizit<br />
des Bundes erhöhen.<br />
Ebenso klar ist aber auch: Die Gemeinden<br />
haben ihren Beitrag zur Budgetsanierung<br />
geleistet, sie haben 2002<br />
Maastricht-Überschüsse ausgewiesen<br />
und 2002 ausgeglichen budgetiert.<br />
Ähnlich sieht es bei den Ländern aus.<br />
Im Klartext: Das Defizit hat ausschließlich<br />
der Bund zu vertreten.<br />
Die Forderungen des<br />
Gemeindebundes<br />
Am 16. September wird der 51. Österreichische<br />
Gemeindetag in Linz unter<br />
dem Motto „Der gerechte Finanzausgleich<br />
– (k)eine Utopie?“ stehen. Und<br />
an diesem Ziel eines gerechten Finanzausgleiches<br />
orientieren sich auch die<br />
Forderungen, mit denen der Gemeindebund<br />
in die Verhandlungen geht.<br />
Wir fordern zunächst einen einheitlichen<br />
Anteil der Gemeinden an allen<br />
gemeinschaftlichen Bundesabgaben.<br />
Denn selbstverständlich kann es nicht<br />
gerecht sein, wenn jene Einnahmen, an<br />
denen die Gemeinden nur in geringem<br />
Ausmaß beteiligt sind – wie etwa die<br />
Mineralölsteuer – laufend steigen,<br />
während jene mit einem hohen<br />
Gemeindeanteil stagnieren oder sogar<br />
sinken.<br />
Wir fordern zweitens mehr Geld für<br />
alle Gemeinden. Der einheitliche Anteil<br />
an allen Bundesabgaben sollte 13,85<br />
Prozent betragen, das wäre ein Plus<br />
von einem Prozent und somit ein Ausgleich<br />
für das Steuerreform-Minus der<br />
Gemeinden.<br />
Und wir wollen im Sinn von mehr<br />
Gerechtigkeit drittens erreichen, dass<br />
vor allem die nach wie vor benachteiligen<br />
kleinen Gemeinden höhere finanzielle<br />
Mittel erhalten.<br />
Schlüssige Argumente<br />
Es wird angesichts der Ausgangslage<br />
sicher nicht einfach sein, mit diesen<br />
Forderungen durch zu dringen. Wir<br />
brauchen<br />
dazu auch<br />
die Unter-<br />
stützung<br />
einer breiten<br />
Öffentlichkeit.<br />
Die<br />
Bürger stellen<br />
zu Recht<br />
hohe Anforderungen<br />
an<br />
Bund, Länder<br />
und<br />
Die Bürger<br />
stellen zu Recht hohe<br />
Anforderungen ...<br />
Und es ist ihnen letztlich<br />
egal, aus welchen<br />
Budgets die dafür notwendigen<br />
finanziellen<br />
Mittel kommen.
Der Wirtschaftsaufschwung – von dem sich die Bundesregierung so viele<br />
Impulse aus der Steuerreform erhofft – wird sicher nicht kommen, wenn<br />
nicht die Gemeinden in ihrer Investitionskraft gestärkt werden!<br />
Gemeinden. Sie verlangen eine optimale<br />
Infrastruktur, Sicherheit, eine<br />
bestmögliche medizinische Versorgung,<br />
ein funktionierendes<br />
soziales Netz, Betreuungseinrichtungen<br />
für<br />
Kinder und ältere Menschen,<br />
ein zukunftsorientiertes<br />
Bildungswesen<br />
und vieles andere mehr.<br />
Und es ist ihnen letztlich<br />
egal, aus welchen<br />
Budgets die dafür notwendigen<br />
finanziellen<br />
Mittel kommen. Ich<br />
halte es daher für eine<br />
ganz wichtige Aufgabe<br />
aller kommunalen Verantwortungsträger,<br />
gerade in den nächsten<br />
Wochen und Monaten<br />
die Bürger umfassend<br />
zu informieren und zu überzeugen,<br />
dass ihre Steuergelder bei den Kommunen<br />
in den besten Händen sind. Gerade<br />
in der bürgernächsten Gebietskörperschaft<br />
bieten sich hier Möglichkeiten,<br />
die genützt werden müssen.<br />
Es ist unbestreitbar,<br />
dass die<br />
Gemeinden im<br />
Interesse des<br />
Staatsganzen in den<br />
letzten Jahren<br />
eisern gespart und<br />
ihre Investitionen<br />
deutlich zurück<br />
geschraubt haben.<br />
Vor allem, weil wir starke und<br />
schlüssige Argumente ins<br />
Treffen führen können!<br />
Es ist unbestreitbar,<br />
dass die<br />
Gemeinden im<br />
Interesse des<br />
Staatsganzen in<br />
den letzten Jahren<br />
eisern<br />
gespart und ihre<br />
Investitionen deutlich<br />
zurück geschraubt haben.<br />
Das bestätigt auch eine<br />
Studie des Finanzministeriums.<br />
Aber so kann es<br />
einfach nicht weiter<br />
gehen. Denn selbstverständlich<br />
ging dieser Sparkurs<br />
zu Lasten der Infrastruktur<br />
und der heimischen<br />
Wirtschaft.<br />
Die Kommunen sind in ihrer Gesamtheit<br />
nicht nur der größte öffentliche<br />
Investor. Sie investieren darüber hinaus<br />
flächendeckend, auch in den wirtschaftlich<br />
schwachen Randregionen.<br />
Und zum Unterschied von den<br />
So kann es<br />
einfach nicht<br />
weiter gehen.<br />
Denn selbstverständlich<br />
ging<br />
der Sparkurs<br />
der letzten Jahre<br />
zu Lasten der<br />
Infrastruktur und<br />
der heimischen<br />
Wirtschaft.<br />
Politik<br />
Großprojekten des Bundes<br />
und des Landes<br />
kommen die kommunalen<br />
Investitionen auch<br />
den Klein- und Mittelbetrieben<br />
zugute, die nach<br />
wie vor das Rückgrat<br />
der österreichischen<br />
Wirtschaft bilden.<br />
Wir müssen also den<br />
Menschen ganz klar<br />
sagen: Der Wirtschaftsaufschwung –<br />
von dem sich die Bundesregierung so<br />
viele Impulse aus der Steuerreform<br />
erhofft – wird sicher nicht kommen,<br />
wenn nicht die Gemeinden in ihrer<br />
Investitionskraft gestärkt werden!<br />
Unbestreitbar ist ebenso, dass große<br />
und aufwändige – und zwar personell<br />
und finanziell aufwändige – Herausforderungen<br />
gerade in jenen Bereichen<br />
auf uns zu kommen, die in besonderer<br />
Weise die Gemeinden betreffen: Sozialwesen,<br />
Geundheitswesen, Kinder- und<br />
Altenbetreuung. Die Gemeinden sind<br />
bereit, sich diesen Herausforderungen<br />
zu stellen. Aber sie brauchen dazu auch<br />
die entsprechenden finanziellen Mittel!<br />
KOMMUNAL 9
Recht & Verwaltung<br />
Neues Nachbarrecht gilt ab 1. Juli 2004<br />
Wie weit sind die<br />
Gemeinden betroffen?<br />
Um es gleich vorweg zu nehmen: Mit dem neuen Nachbarschaftsrecht sollte es nicht zu<br />
einer Flut von Klagen kommen. Vorgeschrieben wird zuallererst der „Versuch der<br />
außergerichtlichen Streitbeilegung“ mit oder ohne Schlichtungsstelle. Und da kommen<br />
die Gemeinden massiv ins Spiel. Der Bürgermeister ist nämlich immer noch die<br />
Respektsperson im Ort. Vor allem wird er als Vermittler gefragt sein.<br />
◆ Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Kerschner<br />
Das ab 1. Juli geltende neue Nachbarrecht<br />
betrifft in seinen wesentlichsten<br />
Neuerungen vor allem :<br />
◆ Beschattungsfälle durch Bäume und<br />
andere Pflanzen am Nachbargrund:<br />
Der betroffene Eigentümer (aber auch<br />
Mieter) kann bei unzumutbarer Beeinträchtigung<br />
durch die Beschattung<br />
beim Gericht auf Abhilfe klagen. Die<br />
maßgebliche Bestimmung des § 364<br />
Abs 3 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch<br />
lautet:<br />
„Ebenso kann der Grundstückseigentümer<br />
einem Nachbarn die von dessen Bäumen<br />
oder anderen Pflanzen ausgehenden<br />
Einwirkungen durch den Entzug von<br />
Licht oder Luft insoweit untersagen, als<br />
diese das Maß des Absatz 2 überschreiten<br />
und zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung<br />
der Benutzung des Grundstücks<br />
führen. Bundes- und landesgesetzliche<br />
Regelungen über den Schutz von oder vor<br />
Bäumen und anderen Pflanzen, insbe-<br />
◆ Univ. Prof.<br />
Dr. Ferdinand<br />
Kerschner ist Vorstand des Instituts<br />
für Zivil- und Umweltrecht an der<br />
Johannes Kepler Universität Linz<br />
10 KOMMUNAL<br />
sondere über den Wald-, Flur-, Feld-,<br />
Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben<br />
unberührt.“<br />
Vor der Klage muss aber eine<br />
außergerichtliche Streitbeilegung<br />
versucht werden.<br />
◆ Herüberwachsende Äste<br />
bzw Wurzeln darf der beeinträchtigte<br />
Nachbar<br />
(grundsätzlich aber auf<br />
eigene Kosten) weiterhin<br />
selbst entfernen, hat dabei<br />
aber fachgerecht und möglichst<br />
schonend vorzugehen. Ist durch<br />
die Wurzeln bzw Äste bereits ein Schaden<br />
entstanden oder droht ein solcher<br />
offenbar, muss der störende Nachbar<br />
die Hälfte der Kosten (aber auch nicht<br />
mehr) ersetzen (§ 422 ABGB).<br />
◆ Das (neue) allgemeine nachbarliche<br />
Rücksichtnahmegebot:<br />
„Im Besonderen haben die Eigentümer<br />
benachbarter Grundstücke bei der Ausübung<br />
ihrer Rechte aufeinander Rücksicht<br />
zu nehmen.“<br />
Bedeutung des neuen<br />
Rechts für Gemeinden<br />
Vom neuen Nachbarrecht kann eine<br />
Gemeinde in gleich mehrfacher Hinsicht<br />
betroffen sein:<br />
◆ Ist die Gemeinde Eigentümer von<br />
Liegenschaften (Grundstücken), kann<br />
sie selbst durch fremde Bäume (oder<br />
andere Pflanzen) beeinträchtigt sein<br />
oder als Eigentümer<br />
der Bäume (bzw<br />
anderer Pflanzen)<br />
selbst Störer sein.<br />
Praktisch wird es sich<br />
meist um gemeindeeigene<br />
Wohnanlagen,<br />
Parks oder auch<br />
Gemeindestraßen<br />
handeln. Das private<br />
Nachbarrecht gilt<br />
nämlich auch im Verhältnis<br />
zu öffentlichen Straßen, soweit<br />
es um Straßenverwaltung geht.<br />
Vor der<br />
Klage muss eine<br />
außergerichtliche<br />
Streitbeilegung<br />
versucht werden.<br />
◆ Die Gemeinde bzw der Bürgermeister<br />
werden gerade bei Nachbarschaftskonflikten<br />
oft als Vermittler angegangen.<br />
Soweit noch Gemeindevermittlungsämter<br />
bestehen, kämen diese<br />
auch als mögliche Schlichtungsstellen<br />
in Beschattungsfällen in Betracht.<br />
◆ Je nach Landesrecht kann die<br />
Gemeinde sogar unmittelbar als einschlägiger<br />
Verordnungsgeber in<br />
Betracht kommen. Keine gerichtliche<br />
Abwehr ist nämlich gegeben, wenn und<br />
soweit ein öffentlich-rechtlicher Baumschutz<br />
vorliegt. So können etwa<br />
Gemeinden in Niederösterreich gem.<br />
§ 15 Naturschutzgesetz 2000 Baumschutzverordnungen<br />
erlassen (Ziele des<br />
Gesetzes sind heimische Arbeitsvielfalt,<br />
das örtliche Kleinklima und eine
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben ...<br />
Zeichnung: Bruno Haberzettl<br />
Cartoon<br />
KOMMUNAL 11
Recht & Verwaltung<br />
gesunde Wohnwelt). Entsprechender<br />
Druck auf die Gemeinde ist natürlich<br />
von mehreren Seiten denkbar.<br />
Die neuen Regeln im<br />
Einzelnen<br />
Hier kann natürlich nur auf die wichtigsten<br />
Fragen und das auch nur ansatzweisehingewiesen<br />
werden (weiterführendeLite-<br />
ratur zum neuen<br />
Nachbarrecht:<br />
Kerschner, Neues<br />
Nachbarrecht :<br />
„Recht auf Licht“,<br />
RFG 2003, 182<br />
ff; Kathrein,<br />
Mehr Licht! ecolex<br />
2003, 894;<br />
Kerschner, Neues<br />
Nachbarrecht:<br />
Abwehr negativer<br />
Immissionen /<br />
Selbsthilferecht,<br />
RZ 2004, 9; P.<br />
Bydlinski, Neuerungen<br />
im Nachbarrecht, JBl 2004, 86.<br />
Vernünftige<br />
Nachbarn sollten<br />
sich stets um eine<br />
vernünftige<br />
Lösung bemühen<br />
und werden auch<br />
in der Regel eine<br />
solche bei gutem<br />
Willen beider<br />
finden.<br />
◆ Zum allgemeinen nachbarlichen<br />
Rücksichtnahmegebot:<br />
❲ Sollte nur dann verletzt sein, wenn der<br />
Nachbar (auch Mieter / Pächter) fast<br />
schikanös, rechtsmissbräuchlich handelt;<br />
zB Verbauen der Aussicht durch schnell<br />
wachsende Bäume ohne eigenen Nutzen.<br />
◆ Zu den Beschattungsfällen:<br />
➤ Wegen beschattender Gebäude kann<br />
nicht geklagt werden.<br />
➤ Abhilfe ist nur bei unzumutbarer<br />
Beeinträchtigung durch die Nachbarbäume<br />
möglich. Der Gesetzgeber hat<br />
dabei an folgende Fälle gedacht:<br />
☛Größere Teile des Grundstückes vermoosen,<br />
versumpfen oder werden sonst<br />
unbrauchbar.<br />
☛ Am helllichten Sommertag ist zu Mittag<br />
eine künstliche Beleuchtung<br />
notwendig.<br />
☛ Eine bereits<br />
bestehende Solaranlage<br />
wird völlig<br />
unbrauchbar.<br />
Es muss sich also<br />
jedenfalls um massive<br />
Fälle handeln.<br />
Bei der Beurteilung<br />
der Unzumutbarkeit<br />
solle es auf folgende<br />
Kriterien ankom-<br />
12 KOMMUNAL<br />
Die angerufene<br />
Gemeinde kann zu einer<br />
Streitschlichtung bzw.<br />
Streitvermeidung zwar<br />
beitragen, aber sicher<br />
auch nicht jeden<br />
Konflikt lösen.<br />
men: Art der benachbarten Grundstücke,<br />
Widmung, Benützung, Lage,<br />
Größe; zB industrielle Nutzung, Gartenbzw<br />
Fremdenverkehrsnutzung; Kleingartengebiet<br />
/ waldreiche Gegend /<br />
neben Straße mit Allee / Umgebung,<br />
wo Baumbestockung üblich ist.<br />
Am 1. Juli wird vom „Störer“ bezüglich<br />
älterer Bäume grundsätzlich nicht<br />
Ortsüblichkeit eingewendet werden<br />
können, weil bis dahin der Nachbar ja<br />
keine Abwehrmöglichkeit gehabt hat.<br />
◆ Der zwingend vor der Klage vorgesehene<br />
Einigungsversuch ist möglich:<br />
➤ bei Schlichtungsstellen der Rechtsanwalts-<br />
oder Notariatskammer<br />
➤ Schlichtungsstellen sonstiger Körperschaften<br />
des öffentlichen Rechts<br />
➤ als gerichtlicher Vergleich (hier ist<br />
Antrag auf Verfahrenshilfe möglich)<br />
➤ Beiziehung eines Mediators<br />
◆ Zum Entfernen herüberwachsender<br />
Äste und Wurzeln:<br />
➤ Da beim Abschneiden fachgerecht<br />
vorzugehen ist, wird unter Umständen<br />
auch ein Fachmann herangezogen werden<br />
müssen (zB Gärtner). Das Einschlagen<br />
von Kupfernägeln ist nunmehr eindeutig<br />
verboten.<br />
➤ Beim Abschneiden ist auch möglichst<br />
schonend vorzugehen, also ein Umstürzen<br />
des Nachbarbaumes möglichst zu<br />
verhindern.<br />
➤ Die Hälfte der Entfernungskosten<br />
(auch des Fachmannes, soweit erforderlich)<br />
muss der Nachbar nur bei bereits<br />
eingetretenem oder offenbar drohendem<br />
Schaden tragen.<br />
➤ Beispiele: Leitungen sind durch Wurzeln<br />
verstopft oder zerstört; Platten werden<br />
angehoben; Dächer oder Fassaden<br />
sind geschädigt.<br />
Schlussbemerkung<br />
Vernünftige Nachbarn sollten sich<br />
stets um eine vernünftige Lösung<br />
bemühen und werden<br />
auch in der Regel eine<br />
solche bei gutem Willen<br />
beider finden. Die allenfalls<br />
angerufene<br />
Gemeinde kann zu einer<br />
solchen Streitschlichtung<br />
bzw Streitvermeidung<br />
zwar beitragen,<br />
aber sicher auch nicht<br />
jeden Konflikt lösen.<br />
Gemeindetag 2004<br />
Ablauf und<br />
Programm<br />
16. September 2004<br />
ab 11.30 Uhr: Empfang beim<br />
Kunstmuseum Lentos in der freien,<br />
aber überbauten Fläche, die man<br />
Skulpturenhalle nennt<br />
Begrüßung durch den Präsidenten<br />
des Österreichischen Gemeindebundes,<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer<br />
sowie des Präsidenten des<br />
OÖ Gemeindebundes, Bgm. Franz<br />
Steininger.<br />
ab 13.00 Uhr: Boarding für Schifffahrt<br />
auf der Donau<br />
ab 17.00 Uhr: Anlegen der Schiffe<br />
in Ottensheim, anschließend<br />
Abendessen und Abendveranstaltung<br />
in der Donauhalle Ottensheim<br />
Rückfahrt der Schiffe nach Linz ab<br />
ca. 22.00 Uhr<br />
17. September 2004<br />
9.30 Uhr: Gemeindetag im<br />
Design-Center mit folgendem<br />
geplanten Ablauf:<br />
Eröffnung und Referat des<br />
Gemeindebundpräsident Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Grußworte des Herrn Bundespräsidenten<br />
Dr. Heinz Fischer<br />
Statements und Diskussion zum<br />
Thema „Finanzausgleich“ zwischen<br />
den Vertretern der Finanzausgleichspartner<br />
◆ Bundesminister für Finanzen<br />
Mag. Karl-Heinz Grasser<br />
◆ Landeshauptmann Dr. Josef<br />
Pühringer<br />
◆ Städtebund-Präsident Bgm. Dr.<br />
Michael Häupl<br />
◆ Gemeindebund-Präsident Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Informationen finden Sie auf<br />
www.gemeindetag2004.at oder<br />
beim Oberösterreichischen<br />
Gemeindebund, 4020 Linz, Coulinstraße<br />
1, Tel: 0732/656516-0,<br />
Fax: 0732/651151,<br />
post@ooegemeindebund.at
Fotos: Wurm & Köck<br />
Das Schiff „Donau“ wird die Delegierten des Gemeindetages<br />
nach Ottensheim bringen (oben) und die „Schlögener Schlinge“.<br />
So ‘ne Seefahrt, die<br />
ist lustig ...<br />
Das größte kommunalpolitische Ereignis<br />
2004 beginnt am 16. September<br />
„unter“ dem Linzer Kunstmuseum Lentos.<br />
Nach der Eröffnung fahren die<br />
Delegierten aus den 2359 österreichischen<br />
Gemeinden voraussichtlich mit<br />
Schiffen „MS Stadt Linz“, „MS Donau“<br />
und „MS Passau“ der Reederei Wurm &<br />
Köckes. Die Fahrt nach Ottensheim<br />
führt durch ältestes österreichisches<br />
Kulturland. Eine der beeindruckendsten<br />
Stellen ist die „Schlögener Schlinge“<br />
(an der die Fahrt allerdings nicht<br />
vorbeiführen wird, Red.): „Der Granit<br />
dieser Gegend südlich des Sauwaldes<br />
hat die Donau gezwungen, die Richtung<br />
um 180 Grad zu ändern. Fast hat es<br />
den Anschein, als hätte eine mächtige<br />
Hand dem Strom Halt geboten und<br />
wollte ihn zurück zum Schwarzwald<br />
schicken.“ (aus: Dieter Maier, „Die<br />
Donau“, S 84)<br />
Die Donauhalle<br />
Die Ottensheimer Donauhalle liegt am<br />
Donauufer entlang des Radweges Passau-<br />
Linz und inmitten des Sportareals der<br />
Marktgemeinde. Auf dem Gebiet der<br />
sogenannten Unteren Markt-Au erfolgten<br />
Auflandungen mit dem Zweck, dieses<br />
Gelände hochwassersicher zu machen.<br />
Mit der Verwertung von Aushubmengen<br />
im Zuge des Kraftwerkbaus hat sich für<br />
die Gemeinde die einmalige Gelegenheit<br />
geboten, einerseits einen Hochwasserschutz<br />
gegen Rückstau zu erhalten, und<br />
andererseits aus bisher nutzlosen<br />
Augrund wertvolles Nutzland zu gewinnen.<br />
1979 wurde ein beschränkter Architektenwettbewerb<br />
durchgeführt, bei welchem<br />
das Projekt des Architekten Karl<br />
Plötzl den ersten Preis erreichte. Die<br />
Errichtung der Donauhalle erfolgte in den<br />
Jahren 1981 bis 1985. Seit ihrer Eröffnung<br />
im Jahr 1985 wird die Donauhalle<br />
Gemeindetag<br />
Am Donnerstag geht’s mit dem Schiff von Linz nach Ottensheim<br />
Nach der Eröffnung des 51. Österreichischen Gemeindetags am 16. September „im<br />
Schatten des Lentos“ folgt ein Ausflug per Schiff nach Ottensheim. Die dortige<br />
Donauhalle ist Schauplatz eines Abendprogramms der Superlative.<br />
Seit ihrer Eröffnung 1985 wird die Donauhalle<br />
Ottensheim für Veranstaltungen jeglicher<br />
Art genützt.<br />
www.gemeindetag2004.at<br />
nicht nur für<br />
sportliche<br />
Zwecke, sondern<br />
auch für Veranstaltungenjeglicher<br />
Art genützt.<br />
Neben der Nutzung<br />
durch den<br />
örtlichen Turn- und Sportverein für Fußball<br />
und Tennis werden auch Meisterschaften<br />
in Tennis, Judo und Karate ausgetragen.<br />
Der Gemeindetag<br />
Alle Informationen, Anmeldungen,<br />
Änderungen, Fragen und Antworten zu<br />
Ablauf und Organisation des Gemeindetages<br />
2004 werden gebündelt auf der<br />
eigens dafür installierten Homepage<br />
www.gemeindetag2004.at präsentiert.<br />
Hier finden sich auch sehr gut aufbereitete<br />
Newsletter des Oberösterreichischen<br />
Gemeindebundes zu allen Aktivitäten<br />
und Möglichkeiten rund um<br />
einen Besuch in Linz. Die Gemeinden<br />
bekommen überdies sämtliche Informationen<br />
zum Gemeindetag per E-Mail.<br />
Mag. Hans Braun
Politik<br />
Bezüge der Gemeindemandatare und Teilpensionsgesetz<br />
Erwerbseinkommen<br />
bestimmt Pension<br />
Das Teilpensionsgesetz hat bewirkt, dass vorzeitige Alterspensionen wegfallen<br />
bzw. Beamtenpensionen gekürzt werden, wenn das gleichzeitig bezogene<br />
„Erwerbseinkommen“ aufgrund einer Tätigkeit als Bürgermeister oder<br />
Gemeindemandatar bestimmte Grenzen übersteigt1 .<br />
◆ Prof. Werner Sedlacek<br />
Nur „Erwerbseinkommen“ kann für<br />
Pensionen schädlich sein und dazu<br />
führen, dass sie entweder gekürzt werden<br />
oder zur Gänze wegfallen. Aufgrund<br />
des Teilpensionsgesetzes (TPG)<br />
gelten seit 1.1.2001 auch die Bezüge<br />
aller Bürgermeister und anderer<br />
Gemeinderäte der österreichischen<br />
Gemeinden als ein solches „Erwerbseinkommen“<br />
mit der Einschränkung, dass<br />
das Amt nach dem 31.12.2000 erstmals<br />
oder neuerlich angetreten wurde 2 .<br />
Wegfall von vorzeitigen<br />
Alterspensionen<br />
Während „normale“ Alterspensionen<br />
(ab Vollendung des 65. Lebensjahres<br />
bei Männern bzw. des 60. bei Frauen)<br />
weder gekürzt werden noch wegfallen<br />
können, muss auf eine vorzeitige<br />
Alterspension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung<br />
immer zur Gänze<br />
verzichtet werden, wenn und solange<br />
◆ Prof. Werner Sedlacek ist<br />
Steuerberater und Partner der TPA<br />
Treuhand Partner Austria<br />
14 KOMMUNAL<br />
die folgenden Voraussetzungen nicht<br />
gleichzeitig erfüllt sind:<br />
◆ Es darf keine Pensionspflichtversicherung<br />
nach dem ASVG, GSVG<br />
(FSVG) oder BSVG bestehen, dh., dass<br />
zB aus einer neben der Pension ausgeübtenASVG-pflichtigen<br />
Tätigkeit kein<br />
Erwerbseinkommen<br />
über der Geringfügigkeitsgrenze<br />
(Wert<br />
2004: Euro 316,19<br />
pM, ohne Einrechnung<br />
der Sonderzahlungen)<br />
bezogen werden<br />
darf.<br />
◆ Aus einer nicht<br />
pensionsversicherungspflichtigen<br />
Erwerbstätigkeit (zB<br />
als Gemeinderat) darf<br />
kein Erwerbseinkommen zufließen, das<br />
die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.<br />
◆ Im Falle von Einkünften aus Landund<br />
Forstwirtschaft darf der Einheitswert<br />
bzw. die Summe der Einheitswerte<br />
Euro 2400 nicht übersteigen.<br />
Nur „Erwerbseinkommen“<br />
kann für<br />
Pensionen schädlich<br />
sein und dazu führen,<br />
dass sie entweder<br />
gekürzt werden oder<br />
zur Gänze wegfallen.<br />
1 Siehe zu diesem Thema schon „Die Bürgermeister-Pension“,<br />
<strong>Ausgabe</strong> 2-2002 der<br />
Schriftenreihe des Österr. Gemeindebundes,<br />
S 100 ff.; Selacek/Treer/Höfle/ Pilz, „Das<br />
Steuer- und Sozialversicherungsverhältnis<br />
der Gemeindemandatare“, Linde-Verlag,<br />
Wien, 2002, S 157 ff.; KOMMUNAL 11-<br />
2003/November, „Wo die Gemeinden<br />
benachteiligt werden“, S 12 ff.<br />
2 §§ 1 Z 4 lit. c) und 6 Abs. 1 und 2 TPG,<br />
BGBl. Nr. I 1987/138 (Art. 13) in der aktuellen<br />
Fassung des BGBl. Nr. I 2003/130.<br />
Sind diese Voraussetzungen zum Pensionsstichtag<br />
(kumulativ) nicht erfüllt,<br />
besteht von Beginn an kein Anspruch<br />
auf die beantragte vorzeitige Alterspension,<br />
bei Nichterfüllung zu einem<br />
späteren Zeitpunkt fällt eine bereits<br />
bezogene vorzeitige<br />
Alterspension so lange<br />
zur Gänze weg, als das<br />
in diesem Sinne schädlicheErwerbseinkommen<br />
bezogen wird.<br />
Somit kann der Fall eintreten,<br />
dass ein die<br />
Geringfügigkeitsgrenze<br />
nur knapp übersteigender<br />
Gemeinderatsbezug<br />
dazu führt, dass eine<br />
möglicherweise viel<br />
höhere Pension wegfällt!<br />
Kürzung von<br />
Beamtenpensionen<br />
Das TPG bewirkt, dass alle Beamtenpensionen,<br />
die nach dem 31.12.2000<br />
und vor Vollendung des 65. Lebensjahres<br />
angetreten werden (worden sind),<br />
im Falle der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit<br />
neben der Pension stufenweise<br />
gekürzt werden, wenn das monatliche<br />
Gesamteinkommen (= Pension plus<br />
Erwerbseinkommen) bei Pensionierung<br />
vor Vollendung des 738. Lebensmonates<br />
(= 61 fi Jahre) Euro 894,96 und<br />
bei Pensionierung zwischen 61 fi Jahren<br />
und dem vollendeten 65. Lebensjahr<br />
Euro 1.342,39 übersteigt (Werte<br />
2004) 3 .
Es kann in vielen Fällen dazu kommen, dass der Gemeinderat de facto „unentgeltlich“<br />
tätig ist und auch noch die im Zusammenhang mit seiner Gemeinderatstätigkeit<br />
anfallenden Kosten aus seiner Pension tragen muss.<br />
Da die Kürzung zwar 50 Prozent der<br />
zustehenden vollen Pension nicht überschreiten<br />
darf, andererseits aber bis zur<br />
Höhe des Erwerbseinkommens zulässig<br />
ist, wird es in vielen Fällen, in denen<br />
im Ruhestand befindliche Beamte als<br />
Gemeinderäte tätig sind, dazu kommen,<br />
dass die Beamtenpension bis zur<br />
Höhe des Gemeinderatsbezuges<br />
gekürzt wird, sodass der Gemeinderat<br />
de facto „unentgeltlich“ tätig ist und<br />
auch noch die im Zusammenhang mit<br />
seiner Gemeinderatstätigkeit anfallenden<br />
Kosten aus seiner Pension tragen<br />
muss. Als verfügbares Nettoeinkommen<br />
bleibt ihm somit weniger übrig, als<br />
einem Beamten mit gleich hoher Pension,<br />
der sich nicht der kommunalen<br />
Aufgabe eines Gemeinderates widmet!<br />
Pensionsschädliches<br />
„Erwerbseinkommen“<br />
Es stellt sich nun die Frage, welcher<br />
Betrag als „Erwerbseinkommen“ mit<br />
den vorstehenden unschädlichen<br />
Grenzbeträgen (Geringfügigkeitsgrenze<br />
bei vorzeitigen Alterspensionen bzw.<br />
unschädliches Gesamteinkommen bei<br />
Beamtenpensionen) zu vergleichen ist<br />
um festzustellen, ob das „Erwerbseinkommen“<br />
den jeweils maßgebenden<br />
Grenzbetrag – pensionsschädlich –<br />
übersteigt oder nicht?<br />
Zur Beantwortung dieser Frage ist zwischen<br />
unselbständiger und selbständiger<br />
Erwerbstätigkeit wie folgt zu unterscheiden<br />
4 :<br />
Als „Erwerbseinkommen“ gilt bei<br />
◆ unselbständiger Erwerbstätigkeit das<br />
aus dieser Tätigkeit gebührende Entgelt<br />
(ohne Sonderzahlungen),<br />
◆ selbständiger Erwerbstätigkeit der<br />
3 Im Detail siehe dazu § 2 TPG und die in<br />
der FN 1 zitierten Literaturstellen.<br />
auf den Kalendermonat entfallende Teil<br />
der nachgewiesenen Einkünfte aus dieser<br />
Tätigkeit.<br />
Während im Falle<br />
selbständiger<br />
Erwerbstätigkeit<br />
die „Einkünfte“<br />
daraus heranzuziehen<br />
sind, also eine<br />
„Nettogröße“ nach<br />
Abzug der Betriebsausgaben,<br />
gilt im<br />
Falle unselbständigerErwerbstätigkeit<br />
mit (lohnsteuerpflichtigen)Einkünften<br />
aus nichtselbständiger<br />
Arbeit das „Entgelt“<br />
daraus als „Erwerbseinkommen“,<br />
also<br />
eine „Bruttogröße“<br />
vor Abzug von<br />
Werbungskosten<br />
(zum Beispiel auch<br />
Pflichtversicherungsbeiträgen) 5 .<br />
Als verfügbaresNettoeinkommen<br />
bleibt<br />
ihm somit weniger<br />
übrig, als einem<br />
Beamten mit gleich<br />
hoher Pension,<br />
der sich nicht der<br />
kommunalen<br />
Aufgabe eines<br />
Gemeinderates<br />
widmet!<br />
Das TPG definiert zwar das Erwerbseinkommen<br />
unter anderem der Gemeindemandatare<br />
als „Bezüge“ aus ihrer Tätigkeit,<br />
ordnet sie jedoch weder der selbständigen<br />
noch der unselbständigen<br />
Erwerbstätigkeit ausdrücklich zu 6 .<br />
Obwohl Gemeinderäte regelmäßig<br />
nicht in einem arbeitsrechtlichen<br />
Dienstverhältnis zur Gemeinde stehen,<br />
werden die Einkünfte der Gemeinde-<br />
4 § 3 iVm § 1 Z 4 TPG sowie §§ 91 Abs. 1<br />
ASVG, 60 Abs. 1 GSVG und 56 Abs. 1<br />
BSVG, jeweils letzter Satz.<br />
5 Zur möglichen Verfassungswidrigkeit der<br />
gesetzlich vorgegebenen unterschiedlichen<br />
Ermittlung des Erwerbseinkommens aus<br />
unselbständiger Erwerbstätigkeit einerseits<br />
und selbständiger Erwerbstätigkeit andererseits<br />
siehe Taucher, ASoK 2004/110 ff.<br />
Politik<br />
mandatare und aller anderen öffentlichen<br />
Funktionäre in der Praxis insbesondere<br />
deshalb der unselbständigen<br />
Erwerbstätigkeit – und damit zu Lasten<br />
der Betroffenen – zugeordnet, weil sie<br />
aufgrund steuerlicher Fiktion lohnsteuerpflichtige<br />
Einkünfte aus nicht-<br />
selbständiger Arbeit beziehen.<br />
Forderungen des<br />
Gemeindebundes<br />
Um die Bereitschaft zur kommunalpolitischen<br />
Tätigkeit, die durch die Neuregelungen<br />
des TPG empfindlich gestört<br />
wurde, weiterhin zu erhalten, hat der<br />
Österreichische Gemeindebund dem für<br />
diese Fragen zuständigen Bundesminister<br />
Haupt ua. die folgenden Forderungen<br />
überreicht:<br />
◆ Auslegung der Wortfolge „nach dem<br />
31.12.2000 erstmals oder neuerlich<br />
angetreten“ 7 in der Form,<br />
dass „neuerlich“ nur vorliegt,<br />
wenn das Amt in der am<br />
31.12.2000 gelaufenen Amtsperiode<br />
nicht ausgeübt wurde.<br />
◆ Ausdrückliche Zuordnung<br />
der Bezüge der Gemeindemandatare<br />
und der anderen öffentlichen<br />
Funktionäre zum „Erwerbseinkommen“<br />
aus selbständiger<br />
Erwerbstätigkeit, dh., Beurteilung<br />
als „Nettogröße“ nach<br />
Abzug der Werbungskosten.<br />
◆ Heranziehung dieser „Nettogröße“<br />
nur insoweit, als sie im<br />
Sinne der VwGH-Rechtsprechung<br />
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz<br />
(AlVG) einen<br />
angemessenen Beitrag zum<br />
Lebensunterhalt darstellen 8 .<br />
Das Bundesministerium für Soziale<br />
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz<br />
(BMSG) ist diesen Forderungen<br />
bisher nicht nähergetreten,<br />
sodass mit entsprechenden legistischen<br />
Änderungen oder zumindest<br />
gegenüber der <strong>Kommunal</strong>politik und<br />
den öffentlichen Funktionären freund-<br />
6 Im § 3 TPG fehlt die Berechnung des<br />
Erwerbseinkommens bei Bezügen gemäß §<br />
1 Z 4 lit. c) TPG, also auch für die Fälle des<br />
Vorliegens von Gemeinderatsbezügen,<br />
obwohl die Ermittlung des Erwerbseinkommens<br />
bei unselbständiger Erwerbstätigkeit<br />
gemäß § 1 Z 4 lit. a) oder selbständiger<br />
Erwerbstätigkeit gemäß § 1 Z 4 lit. b) TPB<br />
im § 3 TPG ausdrücklich definiert ist.<br />
7 § 25 Abs. 1 Z 4 EStG 1988.<br />
8 Siehe dazu KOMMUNAL 3-2003, „Zulagenrichtsatz<br />
nun 643,33 e monatlich“, S 14 f.<br />
KOMMUNAL 15
Politik<br />
Der Österreichische Gemeindebund hat überdies eine Beschwerde an den VwGH unterstützt, bei der es um den Fall eines Gemeindemandatars<br />
geht, dem seine Beamtenpension aufgrund der Bestimmungen des TPG gekürzt wurde. Das Erkenntnis des VwGH<br />
ist abzuwarten.<br />
licheren Auslegungen derzeit nicht zu<br />
rechnen ist.<br />
Hilft möglicherweise der<br />
Verwaltungsgerichtshof?<br />
Der Österreichische Gemeindebund hat<br />
überdies eine Beschwerde an den<br />
VwGH unterstützt, bei der es um den<br />
Fall eines Gemeindemandatars geht,<br />
dem seine Beamtenpension aufgrund<br />
der Bestimmungen des TPG gekürzt<br />
wurde, und zwar unter Berücksichtigung<br />
des Gemeinderatsbezuges als<br />
„Bruttogröße“ (= Bruttobezug vor<br />
Abzug der entstandenen Werbungskosten).<br />
Die Beschwerde wurde – im Sinne der<br />
vorstehenden Ausführungen – insbesondere<br />
damit begründet, dass<br />
◆ das TPG die Bezüge der Gemeindemandatare<br />
nicht ausdrücklich der<br />
unselbständigen Erwerbstätigkeit<br />
zuordnet und diese Bezüge daher aufgrund<br />
der Tatsache, dass<br />
Gemeindemandatare<br />
arbeitsrechtlich nicht<br />
Dienstnehmer der<br />
Gemeinde sind, von<br />
selbständiger Erwerbstätigkeit<br />
auszugehen sei,<br />
◆ „Erwerbseinkommen“<br />
bei Gemeindemandataren<br />
sowie auch bei allen<br />
anderen öffentlichen<br />
Funktionären aufgrund<br />
der Rechtsprechung zum<br />
AlVG nur jener Teil der<br />
„Netto“-Einkünfte sein<br />
kann, der als „angemessener<br />
Beitrag zum<br />
Lebensunterhalt“ anzusehen<br />
ist, und<br />
◆ es bei Zuordnung der<br />
Bezüge von Gemeindemandataren und<br />
anderer öffentlicher Funktionäre zum<br />
sicher nicht verfassungskonformen<br />
Effekt käme, dass einem im Ruhestand<br />
befindlichen Beamten mit zusätzlichen<br />
16 KOMMUNAL<br />
Bezügen als Gemeindemandatar weniger<br />
für den Lebensunterhalt verbleibt,<br />
als jenem pensionierten Beamten, der<br />
sich um die <strong>Kommunal</strong>politik nicht<br />
bemüht.<br />
Das Erkenntnis des VwGH ist abzuwarten,<br />
im Falle des positiven Ausganges<br />
könnte dieses vom Österreichischen<br />
Gemeindebund unterstützte Verfahren<br />
sowohl den „Gesetzgeber“ als auch die<br />
mit der Auslegung der auf dem TPG<br />
beruhenden Bestimmungen befassten<br />
Versicherungsträger und Behörden zum<br />
Umdenken bewegen und damit die<br />
Bereitschaft zur <strong>Kommunal</strong>politik fördern.<br />
Weitere Anregungen zur<br />
Problemlösung<br />
Abgesehen vom Hoffen auf ein positives<br />
VwGH-Erkenntnis sollten in jedem<br />
einzelnen Fall folgende Fragen geprüft<br />
werden:<br />
◆ Gemeindemandatare,<br />
deren<br />
Bezug fünf Prozent<br />
des Ausgangsbetrages<br />
(1.7.2003 bis<br />
30.6.2004: Euro<br />
376,89 pM, der ab<br />
1.7.2004 geltende<br />
angepasste Betrag<br />
steht noch nicht<br />
fest) nicht erreicht,<br />
können diesen<br />
Bezug in Form von<br />
Sitzungsgeldern<br />
und/oder Kommissionsgebühren<br />
erhalten. Diese gelten<br />
nicht als<br />
Erwerbseinkommen 9 und können daher<br />
– auch wenn sie die Geringfügigkeitsgrenze<br />
(Euro 316,19 pM) übersteigen –<br />
nicht zum Wegfall von vorzeitigen<br />
Wenn einmal<br />
ein Pensionsbescheid<br />
vorliegt, sollte dieser<br />
im ordentlichen<br />
Rechtsmittelverfahren<br />
bekämpft und<br />
die vorgenannte<br />
Aussetzung im Rahmen<br />
dieses Verfahrens<br />
beantragt werden.<br />
9 BMSG vom 7.10.1997, Zahl 23056/1-2/97.<br />
Alterspensionen oder zur Kürzung von<br />
Beamtenpensionen führen. Im übrigen<br />
zählen auch an Gemeindemandatare<br />
ausgezahlte Auslagenersätze wie insbesondere<br />
Reisekostenersätze (zB Kilometergelder)<br />
nicht zum „Erwerbseinkommen“<br />
und sind nicht pensionsschädlich.<br />
◆ Denkbar ist, dass der Gemeindemandatar<br />
auf seinen Bezug aus dieser<br />
Tätigkeit insoweit verzichtet, als er die<br />
für seine Pension schädliche Einkommensgrenze<br />
übersteigt: Dies ist allerdings<br />
nur in jenen Bundesländern (derzeit<br />
nur im Burgenland und in Niederösterreich)<br />
möglich, in denen das jeweils<br />
maßgebende Bezügegesetz kein uneingeschränktes<br />
Verzichtsverbot enthält.<br />
◆ Gemeindemandatare, die sich als<br />
Landesbeamte im Ruhestand befinden,<br />
sollten prüfen, ob das TPG in ihrem<br />
Bundesland bereits „umgesetzt“ wurde,<br />
solange dies nicht der Fall ist, kann es<br />
auch nicht zur Kürzung der Beamtenpension<br />
aufgrund der Bestimmungen<br />
des TPG kommen.<br />
Zu achten ist jedoch darauf, dass dies<br />
nur für Landesbeamte gilt, nicht zB<br />
auch für Lehrer, die diesbezüglich der<br />
bundesgesetzlichen Regelung unterliegen,<br />
sodass auf sie jedenfalls die<br />
Bestimmungen des TPG zur Anwendung<br />
gelangen. Gleiches gilt auch für<br />
Pensionen aufgrund des Bundesbahn-<br />
Pensionsgesetzes, weil auch in dieses<br />
die Bestimmungen des TPG übernommen<br />
worden sind.<br />
Aufhebung des Verzichtsverbotes<br />
in den Ländern?<br />
Besteht in einem Bundesland ein uneingeschränktes<br />
Verzichtsverbot, können die<br />
Gemeindemandatare und auch alle anderen<br />
öffentlichen Funktionäre nicht wirksam<br />
auf ihren Bezug bzw. auf einen Teil<br />
des Bezuges aus dieser Tätigkeit verzichten.<br />
Sowohl die BVA (hinsichtlich der<br />
Krankenversicherungsbeiträge) als auch
die PVA (im Hinblick auf den Wegfall von<br />
vorzeitigen Alterspensionen) halten sich<br />
streng an die bestehenden Verzichtsverbote.<br />
Im Gegensatz zu den Bundesländern Niederösterreich<br />
und Burgenland wird somit<br />
den Gemeindemandataren aller anderen<br />
Bundesländer mit dem uneingeschränkten<br />
Verzichtsverbot die Möglichkeit<br />
genommen, den Wegfall einer etwaigen<br />
vorzeitigen Alterspension oder die Kürzung<br />
einer Beamtenpension durch (Teil-)<br />
Verzicht auf den Gemeinderatsbezug zu<br />
vermeiden.<br />
Es sollte daher auf Landesebene überlegt<br />
werden, die uneingeschränkten Verzichtsverbote<br />
in die eingeschränkte„Verzichtsverbots-Klau-<br />
sel“Niederösterreichsumzuwandeln: Im NÖ Landes-<br />
und<br />
Gemeindebezügegesetz<br />
1997 ist zwar<br />
das Verzichtsverbot<br />
auch normiert,<br />
jedoch mit der Einschränkung,<br />
dass<br />
der gänzliche oder<br />
teilweise Verzicht<br />
zulässig ist, wenn<br />
das Organ nachweist,<br />
dass ihm<br />
durch die Annahme der Geldleistung<br />
unter Berücksichtigung seiner sonstigen<br />
Einkünfte und Ansprüche von Gesetzes<br />
wegen ein die Geldleistungen nach diesem<br />
Gesetz übersteigender Schaden<br />
erwachsen würde.<br />
Auch die PVA hat dies bereits mehrmals<br />
angeregt.<br />
Sollte die Aussetzung<br />
im ordentlichenRechtsmittelverfahren<br />
nicht<br />
erreicht werden<br />
können, bleibt nur<br />
die Möglichkeit,<br />
ebenfalls den<br />
VwGH anzurufen.<br />
Empfehlung<br />
Kann der Wegfall der vorzeitigen Alterspension<br />
oder die Kürzung der Beamtenpension<br />
im Einzelfall auch nach Prüfung<br />
aller aufgezeigten Gestaltungsmöglichkeiten<br />
nicht vermieden werden,<br />
so empfiehlt es sich derzeit, die pensionsauszahlende<br />
Stelle im Hinblick auf<br />
das anhängige VwGH-Verfahren (GZ<br />
2003/12/0225) zu ersuchen, die Ausstellung<br />
des Pensionsbescheides so<br />
lange auszusetzen, bis das Erkenntnis<br />
des VwGH ergangen ist.<br />
Wenn einmal ein Pensionsbescheid vorliegt,<br />
sollte dieser im ordentlichen<br />
Rechtsmittelverfahren bekämpft und die<br />
vorgenannte Aussetzung im Rahmen<br />
dieses Verfahrens beantragt werden.<br />
Sollte die Aussetzung auf diese Weise<br />
nicht erreicht werden können, bleibt<br />
nur die Möglichkeit, ebenfalls den<br />
VwGH anzurufen.<br />
Sie wirft ihren Schatten voraus: Die<br />
Public Services/KOMMUNALMESSE<br />
vom 10. bis 12. November 2004 auf dem<br />
Gelände<br />
der WienerMessen.Gemeinsam<br />
mit<br />
den Reed Exhibition Messen Wien veranstaltet<br />
KOMMUNAL wieder die größte<br />
Public Services Messe des deutschen<br />
Sprachraums. Anbieter aus ganz Europa<br />
stellen den kommunalen Entscheidungsträgern<br />
Österreichs und Mitteleuropas<br />
ihre neuesten Produkte aus Bereichen<br />
wie Wasser- und Abwasserbehandlung,<br />
Abfall und Recycling, Energiebereitstellung<br />
und -umwandlung, erneuerbare<br />
Energie, Energiedienstleistungen, Mess-,<br />
Steuer- und Regeltechnik, Finanzierung<br />
und Förderung, Beratung, Consulting –<br />
um nur ein paar zu nennen – vor.<br />
Der <strong>Kommunal</strong>e-Kongress<br />
Im Rahmen dieser größten europäischen<br />
<strong>Kommunal</strong>en Messe findet auch heuer –<br />
am 11. November – der <strong>Kommunal</strong>-<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
<strong>Kommunal</strong>er Pflichttermin November 2004<br />
Messe und Kongress<br />
krönen das Jahr 2004<br />
Kongress statt. Die Themen diesmal:<br />
„Immobilieninvestitionen der Gemeinden“<br />
und „Katastrophenschutz – Katastrophenbewältigung“.<br />
Der<br />
Vormittag des 11. November<br />
ist den Immobilien gewidmet.<br />
Von 10 00 bis 12 00 Uhr widmen<br />
sich namhafte österreichische<br />
Experten Themen wie<br />
„Betriebswirtschaftliche Machbarkeit“<br />
, „Steuerliche Aspekte“<br />
und „Rechtliche Aspekte“ und<br />
natürlich Finanzierungsfragen“.<br />
Ein heißer<br />
Nachmittag<br />
Der Nachmittag des 11.<br />
November wird richtig<br />
heiß: „Lebensminister“<br />
Dipl.-Ing. Josef Pröll eröffnet<br />
um 14 00 Uhr mit einem<br />
Impulsreferat die Podiumsdiskussion.<br />
Die beiden<br />
Referate „Behördliches<br />
Krisenmanagement“ und<br />
„Einsatzorganisationen“ leiten ein, um<br />
15 00 ist eine Diskussionsrunde geplant.<br />
„Haftung und Folgeschäden“, „Grundzüge<br />
der Krisenkommunikation“ und die<br />
„Rolle des Bürgermeisters“ sollten ausreichend<br />
Stoff für die anschließend<br />
geplante Diskussion liefern.<br />
Beschließen wird den <strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
„Gemeindeminister“ Dr. Ernst<br />
Strasser, der gegen 18 00 Uhr ein<br />
abschließendes Referat halten wird.<br />
Nähere Informationen zur Public Services<br />
/ KOMMUNALMESSE und zum<br />
<strong>Kommunal</strong> Kongress bei Reed- Messeleiter<br />
Ing. Wolfgang Ambrosch,<br />
0043/1/72720-351 oder bei<br />
Johanna K. Ritter, KOMMUNAL,<br />
0043/1/5322388-11<br />
(siehe auch Seite 79)
Finanzen<br />
Gemeinschaftliche Bundesabgaben sinken<br />
Ertragsanteile<br />
entwickeln<br />
sich schwach<br />
Die Entwicklung der Steuereinnahmen verläuft in den<br />
letzten Monaten sehr gedämpft. Sie werden heuer hinter<br />
dem Voranschlag und den ursprünglichen Prognosen<br />
zurückbleiben. KOMMUNAL berichtet, warum die<br />
Konjunktur im Jahre 2004 die Steuereinnahmen<br />
nicht stützt.<br />
◆ Prof. Dr. Gerhard Lehner<br />
Das WIFO rechnet in seiner Konjunkturprognose<br />
vom April für das laufende Jahr<br />
mit einem realen Zuwachs des BIP von<br />
1,5 Prozent, nominell wird ein Anstieg<br />
von 3,4 Prozent unterstellt. Für das nächste<br />
Jahr wird sich das Bild bessern. Das<br />
reale BIP wird nach der WIFO-Prognose<br />
im Jahre 2005 um 2,3 Prozent wachsen,<br />
nominell wird ein Anstieg um 3,5 Prozent<br />
unterstellt (siehe Übersicht 1, „Wirtschaftliche<br />
Rahmenbedingungen“).<br />
Zwei wichtige<br />
Komponenten<br />
Für die Steuereinnahmen sind zwei<br />
◆ Prof. Dr.<br />
Gerhard Lehner war WIFO-Finanzexperte<br />
und ist Konsulent des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
18 KOMMUNAL<br />
Komponenten der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
besonders wichtig. Zum einen<br />
die Löhne und Gehälter, weil sie<br />
zusammen mit den Pensionen die<br />
Lohnsteuer bestimmen und zum anderen<br />
der (nominelle) private Konsum,<br />
der für die Umsatzsteuer maßgeblich<br />
ist. Diese beiden<br />
Steuern (Lohnsteuer<br />
und Umsatzsteuer)<br />
bringen zusammen<br />
mehr als 70 Prozent<br />
des gesamten Aufkommens<br />
an gemeinschaftlichenBundesabgaben.<br />
Die Lohnsumme, die<br />
auch die <strong>Kommunal</strong>steuer<br />
bestimmt,<br />
wird heuer um 2,8<br />
Prozent und im nächsten<br />
Jahr um 3,5 Prozent<br />
steigen. Für den<br />
nominellen privaten<br />
Konsum wird für das<br />
laufende Jahr ein Anstieg von 3,3 Prozent<br />
und im nächsten Jahr von vier<br />
Prozent prognostiziert (Übersicht 2,<br />
„Steuereinnahmen“).<br />
Zu berücksichtigen ist, dass der (zeitliche)<br />
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher<br />
Entwicklung und den<br />
Die gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben<br />
werden nach der jüngsten<br />
Steuerprognose heuer rund<br />
50,26 Milliarden Euro<br />
erbringen. Das ist deutlich<br />
weniger als im Bundesvoranschlag<br />
2004 präliminiert<br />
war: 51,86 Milliarden.<br />
Steuereinnahmen im Laufe der Zeit<br />
schwächer geworden ist. Zeitliche Verzögerungen<br />
spielen eine wichtige Rolle.<br />
Die Gewerbesteuer bietet dafür ein<br />
gutes Beispiel, die noch Jahre nach<br />
ihrer Abschaffung nicht unerhebliche<br />
Erträge brachte. Die Anspruchsverzinsung<br />
hat für die<br />
Einkommensteuer<br />
und die Körper-<br />
schaftsteuer dieses<br />
Problem allerdings<br />
entschärft.<br />
Neben der wirtschaftlichenEntwicklungbeeinflussen<br />
die steuerpolitischenMaßnahmen<br />
das Steueraufkommen.<br />
Heuer sind es vor<br />
allem die Konjunkturpakete,insbesondere<br />
die Investitionszuwachsprämie,<br />
sowie die erste Etappe der<br />
Steuerreform. Im nächsten Jahr sind es<br />
primär die Maßnahmen zur steuerlichen<br />
Entlastung der nicht entnommenen<br />
Gewinne für die Einzelunternehmer<br />
und Personengesellschaften, die<br />
zwar bereits heuer in Kraft treten, aber
erst nächtes Jahr im Aufkommen an<br />
Einkommensteuer wirksam werden, die<br />
Senkung des Körperschaftsteuersatzes<br />
sowie der neue Einkommen(Lohn-)<br />
steuertarif, der die unteren und mittleren<br />
Einkommen entlastet. Schließlich<br />
dämpft auch die Erhöhung des Alleinverdienerabsetzbetrages<br />
mit Kindern<br />
die Steuereinnahmen. Insgesamt bringt<br />
die Steuerreform eine Entlastung von<br />
rund 3 Milliarden Euro, die sich großteils<br />
nächstes Jahr im Aufkommen spiegelt.<br />
Die gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
werden nach der jüngsten Steuerprognose<br />
heuer rund 50,26 Milliarden Euro<br />
erbringen. Das ist deutlich weniger als<br />
im Bundesvoranschlag 2004 präliminiert<br />
war (51,86<br />
Milliarden Euro).<br />
Diese Abweichung<br />
ist vor allem auf die<br />
Umsatzsteuer, die<br />
Kapitalertragsteuer<br />
auf Zinsen, die Einkommensteuer<br />
sowie die Körperschaftsteuerzurückzuführen.<br />
Die geringren Einnahmen<br />
an Einkommensteuer<br />
und Kör-<br />
Die Ertragsanteile der<br />
Gemeinden (mit Wien)<br />
werden nach der jüngsten<br />
Steuerprognose heuer mit<br />
6,17 Milliarden Euro um<br />
0,9 Prozent höher sein als<br />
im Vorjahr, also praktisch<br />
stagnieren.<br />
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
perschaftsteuer sind einerseits auf die<br />
stärkere Inanspruchnahme der Investitionszuwachsprämie,<br />
andererseits auf<br />
schwächere Gewinne insbesondere<br />
auch der Notenbank zurückzuführen.<br />
Die geringeren Einnahmen aus der<br />
Kapitalertragsteuer auf Zinsen gehen<br />
auf das sinkende Zinsniveau zurück.<br />
Die Abweichungen in der Umsatzsteuer<br />
bedürfen noch einer eingehenden Analyse.<br />
Sie sind nur schwer erklärbar.<br />
2004 stagnieren die<br />
Bundesabgaben<br />
Die Steuerreform dämpft die Einnahmen<br />
aus der Lohnsteuer, Einkommensteuer<br />
und Körperschaftsteuer.<br />
Die<br />
Mehreinnahmen bei<br />
den anderen<br />
gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben<br />
können diese Ausfälle<br />
gerade noch<br />
kompensieren.<br />
Die Ertragsanteile<br />
der Gemeinden (mit<br />
Wien) werden nach<br />
der jüngsten Steuerprognose<br />
heuer mit<br />
Veränderungen gegen<br />
das Vorjahr in %<br />
2004 2005<br />
Bruttoinlandsprodukt real 1,5 2,3<br />
Bruttoinlandsprodukt nominell 3,4 3,8<br />
privater Konsum nominell 3,3 4,0<br />
Lohnsumme 2,8 3,5<br />
Quelle: WIFO, Prognose April 2004<br />
Steuereinnahmen<br />
Finanzen<br />
2004 2005 Veränderung gegen<br />
Millionen Euro Vorjahr in %<br />
Gemeinschaftliche Bundesabgaben brutto 50.255 50.525 0,5<br />
Ertragsanteile der Gemeinden (mit Wien) 6.172 6.245 1,2<br />
Quelle: Steuerschätzung Juni 2004<br />
6,17 Milliarden Euro um 0,9 Prozent<br />
höher sein als im Vorjahr, also praktisch<br />
stagnieren. Für das nächste Jahr ist<br />
ebenfalls nur mit einer Zunahme von<br />
etwa einem Prozent auf 6,24 Milliarden<br />
Euro zu rechnen. Diese schwache Einnahmenentwicklung<br />
wird die<br />
Gemeindehaus-<br />
halte heuer und<br />
im nächsten Jahr<br />
vor große Herausforderungenstellen.<br />
Im Hinblick auf<br />
die kommenden<br />
Finanzausgleichsverhandlungen<br />
hat<br />
das Finanzministerium<br />
eine Steuerschätzung<br />
bis<br />
2008 erstellt. Sie<br />
zeigt, dass die<br />
Die schwache<br />
Einnahmenentwicklung<br />
wird die<br />
Gemeindehaushalte<br />
heuer und<br />
im nächsten<br />
Jahr vor große<br />
Herausforderungen<br />
stellen.<br />
Steuerreform bei Einkommensteuer<br />
und Körperschaftsteuer im Jahre 2006<br />
noch dämpfend wirkt. Die Ertragsanteile<br />
der Gemeinden werden daher in<br />
diesem Jahr nur um etwa zwei Prozent<br />
zunehmen. Erst 2007/08 wachsen die<br />
Ertragsanteile wieder stärker, weil die<br />
Steuerreform die Einnahmenentwicklung<br />
nicht mehr beeinflusst.<br />
KOMMUNAL 19
Wissenschaft<br />
Entwicklung des Zentralismus in Österreich von 1985 bis 2000<br />
Rutschen Gemeinden<br />
in die Abhängigkeit ?<br />
Gegenstand dieser Diplomarbeit an der WU Wien ist eine Analyse der Frage, ob das<br />
österreichische System der Verteilung von Steuereinnahmen auf die Ebenen der<br />
Gebietskörperschaften im Zeitablauf zentralistischer wurde oder ob dem<br />
Subsidiaritätsprinzip vermehrt Rechnung getragen wurde.<br />
◆ Josef Meichenitsch<br />
Bei dieser Betrachtung werden die Einnahmen<br />
der Gebietskörperschaften hinsichtlich<br />
ihrer Zusammensetzung im Zeitablauf<br />
von 1985 bis 2000 untersucht. Von<br />
besonderem Interesse ist dabei der Anteil,<br />
den die gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
einnehmen, da über sie ein Großteil<br />
des Steueraufkommens verteilt wird. Diesem<br />
Vorgehen liegt die Annahme<br />
zugrunde, dass über die Entwicklung der<br />
Einnahmen ein Rückschluss auf die Veränderung<br />
der Abhängigkeit gegenüber<br />
dem Bund gezogen werden kann. Für<br />
diese Fragestellung wird der Untersuchung<br />
von Bös/Genser/Holzmann 1<br />
gefolgt, die eine vergleichbare Analyse für<br />
den Zeitraum von 1958 bis 1979 durchgeführt<br />
hatten. Die Autoren kamen im<br />
Zuge ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis,<br />
dass seit 1958 eine Zunahme des<br />
Zentralismus in Österreich zu verzeichnen<br />
war, wobei Zentralismus, wie auch in<br />
diesem Beitrag, nicht über die Gesetzgebungshoheit,<br />
sondern über die Einnahmenanteile<br />
definiert wurde. Die Begrün-<br />
◆ Josef<br />
Meichenitsch ist wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Österreichischen<br />
Institut für Familienforschung<br />
20 KOMMUNAL<br />
dung für ihr Ergebnis sahen Bös/Genser/Holzmann<br />
demnach hauptsächlich in<br />
der starken Zunahme der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben zu Lasten der übrigen<br />
Abgabenarten. Dieser Beitrag bildet<br />
quasi eine Fortsetzung der Arbeit von<br />
Bös/Genser/Holzmann für die Periode<br />
von 1985 bis 2000 und stellt die Frage,<br />
ob sich der Trend zu mehr Zentralismus<br />
seither fortsetzte oder dem Subsidiaritätsprinzip<br />
vermehrt Rechnung getragen<br />
wurde.<br />
Ungeachtet der Tatsache, dass der Finanzausgleich<br />
aus mehr als nur der Mittelverteilung<br />
besteht, bleiben die Verteilung<br />
der Aufgaben (passiver Finanzausgleich)<br />
sowie die Thematik der Transfers in diesem<br />
Beitrag weitgehend unberücksichtigt.<br />
Gegenstand ist schwerpunktmäßig<br />
der aktive Finanzausgleich, der in einer<br />
ersten Stufe die Finanzmittel vertikal zwischen<br />
den einzelnen Ebenen aufteilt und<br />
in einem weiteren Verteilungsprozess<br />
eine horizontale Verteilung vornimmt.<br />
Zur Gänze unberücksichtigt bleiben all<br />
jene Finanzströme, die außerhalb des<br />
Finanzausgleichsgesetzes geregelt sind,<br />
wie zum Beispiel die Wohnbauförderung.<br />
Anteile am Abgabenertrag<br />
bleiben konstant<br />
Die Anteile der einzelnen Gebietskörperschaften<br />
am Gesamtabgabenertrag setzen<br />
sich aus den ausschließlichen Bundes-,<br />
Landes- und Gemeindeabgaben und den<br />
1 BÖS/GENSER/HOLZMANN (1983); Österreich,<br />
in: Handbuch der Finanzwissenschaft<br />
gemeinschaftlichenBundesabgaben,<br />
sowie den<br />
Zuschlagsabgaben<br />
und<br />
den Abgaben<br />
vom selben<br />
Besteuerungsgegenstand<br />
zusammen.<br />
Hierbei lässt sich auf Basis der Gebarungsübersichten<br />
feststellen, dass sich<br />
die Anteile am Gesamtabgabenertrag für<br />
alle Gebietskörperschaften konstant entwickelt<br />
haben. Der Anteil des Bundes am<br />
Gesamtabgabenertrag beträgt relativ konstant<br />
ca. 71 Prozent, jener der Länder ca.<br />
10 Prozent und jener der Gemeinden ca.<br />
11 Prozent. Wien als Land und Gemeinde<br />
zieht ca. 8 Prozent des Gesamtabgabenertrages<br />
auf sich.<br />
Eine Veränderung der Anteile würde<br />
bedeuten, dass eine Gebietskörperschaft<br />
einen größeren bzw. geringeren Anteil<br />
am Gesamtabgabenertrag erhalten hätte.<br />
Eine Veränderung dieser Art könnte nur<br />
aus einer Neuregelung der Kompetenzverteilung<br />
oder durch massive Eingriffe in<br />
die Schlüssel der Ertragsanteile ausgelöst<br />
werden. Eine solche Veränderung ist<br />
jedoch im Beobachtungszeitraum nicht<br />
eingetreten.<br />
Struktur der Anteile<br />
ändert sich massiv<br />
Dem Bund sind im<br />
Beobachtungszeitraum<br />
mehr Anteile aus den<br />
gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben zugeflossen<br />
als den übrigen<br />
Gebietskörperschaften.<br />
Zur Beantwortung der Frage, ob sich die<br />
Zentralisierungstendenz fortsetzte, ist es
Anteile der Abgabenarten am Gesamtabgabenertrag<br />
Quelle: Gebarungsübersichten, eigene Berechnungen<br />
in einem weiteren vertiefenden Schritt<br />
erforderlich die Struktur der Abgaben zu<br />
analysieren. Die Grafik „Anteile der Abgabenarten<br />
am Gesamtabgabenertrag“ zeigt<br />
den im Beobachtungszeitraum von 1985<br />
bis 2000 eindeutigen Anstieg der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben. Im Jahr<br />
1985 betrugen diese 62,42 Prozent des<br />
Gesamtabgabenertrages. Im Jahr 2000<br />
hat sich der Anteil der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben am Gesamtabgabenertrag<br />
bereits auf 76,97 Prozent<br />
erhöht. Das entspricht bezogen auf das<br />
Basisjahr 1985 einem Gesamtanstieg von<br />
ca. 23 Prozent. Für die Jahre 1985 bis<br />
1997 lässt sich ein nahezu konstantes<br />
jährliches Wachstum der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben in der Höhe von<br />
durchschnittlich 0,62 Prozent feststellen.<br />
Diesem Trend wird erst im Jahre 1998<br />
durch einen deutlich stärkeren Anstieg<br />
von 5,67 Prozent ein Ende gesetzt.<br />
Im selben Zeitraum haben sich die ausschließlichen<br />
Bundesabgaben von 30,64<br />
Prozent im Jahr 1985 auf 16,64 Prozent<br />
reduziert. Diese Veränderung entspricht –<br />
bezogen auf das Basisjahr 1985 – einem<br />
Rückgang von ca. 47 Prozent. Die ausschließlichen<br />
Landes- und Gemeindeabgaben<br />
haben sich hingegen kontinuierlich<br />
zwischen 6 Prozent und 8 Prozent am<br />
Gesamtabgabenertrag bewegt.<br />
Der Anstieg der gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
im Jahr 1988 ist hauptsächlich<br />
auf die Einführung der Kapitalertragssteuer<br />
auf Zinsen (KESt II) zurückzuführen.<br />
Diese erbrachte im ersten Jahr<br />
ein Steueraufkommen von 243 Mio.<br />
Euro. Für das Jahr 1994 kann der Anstieg<br />
der gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
über den fallenden Anteil der ausschließlichen<br />
Bundesabgaben<br />
erklärt werden. Im Zuge der<br />
Steuerreform 1994 kam es<br />
zur Abschaffung der Vermögenssteuer,<br />
des Erbschaftssteueräquivalents<br />
und der<br />
Bundesgewerbesteuer. Da es<br />
sich bei diesen Steuern<br />
durchwegs um ausschließliche<br />
Bundesabgaben han-<br />
In absoluten<br />
Zahlen stiegen<br />
die Einnahmen<br />
des Bundes von<br />
elf auf 27,5<br />
Milliarden Euro.<br />
delte, stieg der Anteil der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben am Gesamtabgabenertrag<br />
an. Der Grund für den signifikanten<br />
Zuwachs der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben im Jahr 1998 liegt in der<br />
Umwandlung der Körperschaftssteuer<br />
von einer ausschließlichen in eine<br />
gemeinschaftliche Bundesabgabe. Diese<br />
Entscheidung wurde durch die hohe Aufkommensdynamik<br />
der Körperschaftssteuer<br />
ausgelöst, an der die Ebenen der<br />
Länder und Gemeinden beteiligt werden<br />
sollten. Im Gegenzug zur Beteiligung der<br />
Länder und Gemeinden an der KöSt wurden<br />
die Aufteilungsschlüssel zwischen<br />
den Gebietskörperschaften bei den einkommensabhängigen<br />
Steuern vereinheitlicht.<br />
Diese Veränderung der Schlüssel hat<br />
den Ländern und Gemeinden Ertragsanteile<br />
entzogen und dem Bund zugeschlagen.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Die Analyse der finanziellen Ströme im<br />
Rahmen des Finanzausgleichs zeigt, dass<br />
sich die Anteile der Gebietskörperschaften<br />
am Gesamtabgabenertrag über den<br />
Beobachtungszeitraum nicht entscheidend<br />
verändert haben. Zu Veränderungen<br />
kam es jedoch in der Struktur der<br />
Abgaben. Die gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
haben kontinuierlich an<br />
Bedeutung gewonnen. Diese Zunahme<br />
ging hauptsächlich zu Lasten der ausschließlichen<br />
Bundesabgaben. Aus diesem<br />
Sachverhalt darf jedoch nicht geschlossen<br />
werden, dass es zu einer Verringerung<br />
des Zentralismus, im Sinne der Einnahmenhoheit,<br />
gekommen ist. Dem Bund<br />
sind nämlich im Beobachtungszeitraum<br />
mehr Anteile aus den<br />
gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
zugeflossen als<br />
den übrigen Gebietskörperschaften.<br />
In absoluten Zahlen<br />
stiegen die Einnahmen<br />
des Bundes von 11 auf 27,5<br />
Mrd. Euro. Dies lässt sich<br />
hauptsächlich durch die<br />
mehrfache Schlüsselände-<br />
Wissenschaft<br />
rung der einkommensabhängigen Steuern<br />
zugunsten des Bundes erklären. Der<br />
Anstieg an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben<br />
hat den Ausfall an den ausschließlichen<br />
Bundesabgaben<br />
also mehr als<br />
kompensiert,<br />
weshalb man von<br />
einer Zunahme<br />
des Zentralismus<br />
sprechen kann.<br />
Zusammenfassend<br />
kann gesagt<br />
werden, dass ausgehend<br />
vom<br />
international sehr<br />
hohen Niveau an<br />
Zentralstaatlichkeit<br />
in Österreich<br />
sich dieses im<br />
Beobachtungszeitraum<br />
1985<br />
bis 2000 weiter<br />
erhöht hat.<br />
Obwohl die ausschließlichen<br />
Bundesabgaben zurückgegangen sind,<br />
konnte sich der Bund durch den daraus<br />
folgenden Anstieg der gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben Ertragsanteile sichern.<br />
Verstärkt wurde dieser Trend durch<br />
mehrfache Schlüsseländerungen zugunsten<br />
des Bundes. Dadurch verringerte<br />
sich zwar prinzipiell die Finanzmittelausstattung<br />
der nachgeordneten Gebietskörperschaften<br />
nicht, es erhöhte sich jedoch<br />
der Grad der Abhängigkeit, was zu einer<br />
weiteren Aushöhlung des Subsidiaritätsprinzips<br />
führte.<br />
Auswahlbibliographie<br />
Zusammenfassend<br />
kann gesagt<br />
werden, dass ausgehend<br />
vom international<br />
sehr hohen<br />
Niveau an Zentralstaatlichkeit<br />
in<br />
Österreich sich dieses<br />
im Beobachtungszeitraum<br />
1985<br />
bis 2000 weiter<br />
erhöht hat.<br />
BÖS, Dieter/Genser, Bernd/Holzmann, Robert;<br />
Österreich, in: Handbuch der Finanzwissenschaft;<br />
Gerloff, Wilhelm (Hrsg.), 3. Auflage, Tübingen<br />
1983<br />
HÜTTNER, Bertram; Der Finanzausgleich: Grundlagen,<br />
Entwicklung, Finanzausgleichsgesetz 2001,<br />
in: Österreichischer Gemeindebund/Österreichischer<br />
Städtebund (Hrsg.): Finanzausgleich 2001 -<br />
Das Handbuch für die Praxis, Wien 2001<br />
INSTITUT FÜR FÖDERALISMUSFORSCHUNG;<br />
Berichte über die Lage des Föderalismus in Österreich,<br />
Innsbruck, Verlag Braumüller<br />
LEHNER, Gerhard; Finanzausgleich als Instrument<br />
der Budgetpolitik, in: WIFO Monatsbericht 8/2001<br />
MATZINGER, Anton; Finanzausgleich, in: Steger,<br />
G. (Hrsg.), Öffentliche Haushalte in Österreich,<br />
Verlag Österreich GmbH, Wien 2001<br />
KOMMUNAL 21
Asyl<br />
In Neudörfl leben seit<br />
Jahren AsylwerberInnen<br />
in integrierter Weise mit<br />
der Bevölkerung zusammen.<br />
Dies Dank der vielen<br />
Anstrengungen des<br />
Bürgermeisters und der<br />
Vizebürgermeisterin.<br />
§ 15a-Vereinbarung ist Schritt in Richtung „Humanisierung“<br />
Bekenntnis und Mut<br />
– allein ihr fehlt<br />
Das Thema Asyl wird seit der 15a-Vereinbarung – Betreuung und Versorgung von<br />
Flüchtlingen ist Länder- und damit Gemeindesache – immer emotionaler diskutiert.<br />
In KOMMUNAL haben im April der Bund und im Mai die Gemeinden zur Asylthematik<br />
Stellung genommen. In dieser <strong>Ausgabe</strong> berichtet die Caritas über ihre Sicht des<br />
Asylgesetzes und den Stand der Unterbringungen.<br />
◆ Dr. Werner Binnenstein-Bachstein<br />
Nicht einmal 60 Tage alt ist die neue<br />
§15a-Vereinbarung zwischen Bund und<br />
Ländern, die eigentlich ein Meilenstein<br />
in der Versorgung von Flüchtlingen in<br />
Österreich bedeuten sollte. Und ich bin<br />
nach wie vor überzeugt davon, dass sie<br />
ein sehr großer Schritt in Richtung<br />
„Humanisierung“ unseres Landes ist.<br />
Denn ein Dach über dem Kopf, Verpflegung<br />
und medizinische Versorgung sind<br />
◆ Dr. Werner<br />
Binnenstein-<br />
Bachstein ist Bereichsleiter „Soziale<br />
Arbeit & In- und AusländerInnenhilfe“<br />
der Caritas der Erzdiözese Wien<br />
22 KOMMUNAL<br />
wohl die Mindest-Voraussetzungen für<br />
ein faires Asylverfahren. In Wahrheit für<br />
jedes rechtsstaatliche Verfahren.<br />
Bereits vor Jahren war klar, dass eine<br />
neue EU-Richtlinie mit spätestens<br />
Februar 2005 dem unhaltbaren Zustand<br />
der obdachlosen AsylwerberInnen ein<br />
Ende setzen wird und die Zuständigkeit<br />
ein für allemal eindeutig festlegt. Mindestens<br />
vor einem Jahr wussten also<br />
Bund und Länder, dass<br />
sie in geteilter Weise für<br />
diese soziale Dienstlei-<br />
stung zuständig und verantwortlich<br />
sein werden<br />
– also geteilte Unterbringung<br />
von AsylwerberInnen<br />
nach Bevölkerungsquoten<br />
zwischen den<br />
Bundesländern. Zwei<br />
Monate nach Inkrafttreten<br />
dieser Regelung fehlen<br />
noch immer Plätze!<br />
Resultat aus einem ständigen Hick-Hack<br />
um die tatsächlichen Zuständigkeiten<br />
Die §15a-<br />
Vereinbarung ist<br />
ein sehr großer<br />
Schritt in Richtung<br />
„Humanisierung“<br />
unseres Landes.<br />
zwischen Bund und Ländern. Die Leidtragenden<br />
sind Männer, Frauen und<br />
Kinder.<br />
Die „Schwierigkeiten“<br />
der Unterbringung<br />
Wer mit Flüchtlingen arbeitet, kennt die<br />
„Schwierigkeiten“ rundum deren Unterbringung.<br />
Immerhin versorgen<br />
NGOs seit Jahren<br />
ausfallhaftend für den<br />
Bund – der seit Jahren<br />
seine Verantwortung stets<br />
negierte – einige tausend<br />
AsylwerberInnen mit einigem<br />
Erfolg: human, sozialarbeiterisch,integrierend.<br />
Wir kennen auch<br />
die Ängste und Sorgen<br />
der Nachbarschaft unserer<br />
Flüchtlingshäuser, die<br />
selbstverständlich ernstgenommen werden<br />
müssen. Dabei gilt es möglichst<br />
Fotos: Caritas
Ohne sozialarbeiterische<br />
Betreuung<br />
kann eine Integration<br />
der BewohnerInnen<br />
eines Flüchtlingshauses<br />
in eine<br />
Gemeinde nicht<br />
gelingen.<br />
transparent vorzugehen<br />
und durchaus mit der<br />
unmittelbaren Wohnbevölkerungzusammenzuarbeitend,<br />
ohne den Schutz<br />
und die Privatsphäre von<br />
AsylwerberInnen zu vernachlässigen:<br />
Tage der<br />
offenen Tür, Diskussionsveranstaltungen,gemeinsame<br />
Feste - persönliche<br />
Begegnungen - können Ängste abbauen<br />
und führen meistens zu einem differenzierteren<br />
Bild von Menschen auf der<br />
Flucht.<br />
Das erfordert jedoch professionelles<br />
Vorgehen mit sozialem Fingerspitzengefühl.<br />
Es ist jedoch traurig mitansehen<br />
zu müssen, wie<br />
mit diesem – von<br />
den beim Bund<br />
und in den LändernVerantwortlichen<br />
– unterfertigten<br />
Vertrag<br />
vielfach umgegangen<br />
wird.<br />
Wie mutlos und<br />
angstbesetzt teils<br />
an die Umsetzung<br />
konkreter<br />
Grundrechte in<br />
Österreich heran-<br />
Es ist traurig mitansehen<br />
zu müssen, ...<br />
wie mutlos und<br />
angstbesetzt an<br />
die Umsetzung<br />
konkreter Grundrechte<br />
in Österreich<br />
herangegangen wird.<br />
Wir kennen<br />
auch die Ängste<br />
und Sorgen der<br />
Nachbarschaft<br />
unserer Flüchtlingshäuser,<br />
die selbstverständlich<br />
ernstgenommen<br />
werden müssen.<br />
gegangen wird. Die<br />
Angst der Bevölkerung<br />
vor AusländerInnen,<br />
vor einem<br />
„Minderheitenthema“<br />
ist vorherrschend.<br />
Und die<br />
alleinige Verantwortung<br />
für oder gegen<br />
eine Unterkunft wird<br />
den Bürgermeistern<br />
aufgebürdet, die damit ihre Wiederwahl<br />
gefährdet sehen.<br />
Eine Kursänderung<br />
Eine Änderung dieses Kurses tut not:<br />
◆ Mehr innerösterreichische Solidarität<br />
und damit ein klares Bekenntnis<br />
aller Bundesländer zur „Grundversorgung<br />
neu“: es können nicht<br />
nur einige (vor allem östliche)<br />
Bundesländer zur Vereinbarung<br />
stehen.<br />
◆ Die Bürgermeister müssen von<br />
der alleinigen Entscheidungslast<br />
befreit werden. Hier sind vor<br />
allem die Verantwortlichen in den<br />
Ländern gefragt (gute Beispiele<br />
dafür sind sicherlich Oberösterreich<br />
und Wien).<br />
◆ Abgestimmte Vorgangsweise<br />
beziehungsweise gemeinsames<br />
Handbuch<br />
Asyl<br />
Überblick über Rechtsbereiche<br />
Asylberatung von<br />
Praktikern für Praktiker<br />
Aktuell zum In-Kraft-Treten der Asylgesetz-Novelle<br />
2003 am 1. Mai 2004 bietet<br />
das soeben bei MANZ erschienene Handbuch<br />
Asylrecht eine übersichtliche Darstellung<br />
aller für die Asylberatung relevanten<br />
Rechtsbereiche. Enthaltene Bereiche<br />
sind völker- und europarechtliche<br />
Rahmenbedingungen, Asylverfahren und<br />
Bundesbetreuung, aufenthaltsbeendende<br />
Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen und<br />
Schubhaft und Verwaltungsverfahren<br />
und gerichtliches<br />
Strafverfahren.<br />
Inhalt und<br />
Gestaltung orientieren<br />
sich dabei<br />
an der täglichen<br />
Praxis der Asylberatung.Geboten<br />
werden<br />
Tipps für den<br />
Umgang mit<br />
Behörden und<br />
Asylwerbern,<br />
Musterformulierungen<br />
für<br />
Behördeneingaben,Adressen<br />
und weitere Informationsquellen,<br />
relevante Judikatur von<br />
UBAS, VwGH, VfGH und EGMR und das<br />
AsylG, BundesbetreuungsG, FremdenG<br />
und andere im Wortlaut. „Das vorliegende<br />
Handbuch soll all jenen, die mit<br />
AsylwerberInnen und Flüchtlingen arbeiten,<br />
sie betreuen, beraten, vertreten oder<br />
über ihre Anträge und Anliegen entscheiden,<br />
einen umfangreichen und übersichtlichen<br />
Überblick praktischer Art bieten.“<br />
Soweit die Autoren Mag. Andrea Huber,<br />
amnesty international Österreich, Mag.<br />
Robert Öllinger, Leiter des Asylzentrums<br />
der Caritas Wien und Mag. Manuela Steiner-Pauls,<br />
jahrelang Mitglied von amnesty<br />
international im Vorwort.<br />
Das Buch<br />
Huber/Öllinger/Steiner-Pauls,<br />
„Handbuch Asylrecht. Das Recht<br />
in der Asylberatung“, MANZ<br />
2004, Brosch., 312 Seiten, 24,80<br />
Euro, ISBN: 3-214-00163-9<br />
Kundenbestellungen telefonisch<br />
unter (01) 531 61-100 oder per E-<br />
Mail an bestellen@manz.at<br />
KOMMUNAL 23
Asyl<br />
Auftreten von Land, Gemeinde und<br />
Betreiber der Unterkunft.<br />
◆ Möglichst frühe Integration der<br />
„betroffenen“ Wohnbevölkerung nach<br />
dem Motto: „Soviel<br />
Information für AnrainerInnen<br />
wie möglich<br />
und so viel Diskretion<br />
für AsylwerberInnen<br />
wie nötig“.<br />
◆ Klare Qualitätsstandards<br />
bei der Versorgung<br />
der Flüchtlinge:<br />
Ohne sozialarbeiterische<br />
Betreuung kann eine<br />
Integration der BewohnerInnen<br />
eines Flüchtlingshauses<br />
in eine Gemeinde nicht<br />
gelingen.<br />
Dies alles bedingt einiges Engagement,<br />
dafür muss man „laufen“. Es ist sicherlich<br />
eine spannungsgeladene, aber eben<br />
auch eine spannende Herausforderung.<br />
Gut gelungene Beispiele dafür gibt es<br />
zur Genüge.<br />
Das Caritas-Flüchtlingshaus<br />
Neudörfl<br />
Etwa das Caritas-Flüchtlingshaus Neu-<br />
Handbuch<br />
Mit 1. Mai 2004 ist die viel diskutierte<br />
AsylG-Novelle 2003 in Kraft getreten,<br />
die weitreichende Änderungen im Asylverfahrensrecht<br />
vorsieht. So wurde<br />
dem mediatorischen<br />
Verfahren<br />
ein Zulassungsverfahrenvorgeschaltet,<br />
das<br />
Familienverfahren<br />
wurde neu<br />
konzipiert und<br />
der subsidiäre<br />
Schutz ausgebaut.Tiefgreifend<br />
geändert<br />
wurde auch<br />
das Berufungsverfahren<br />
und<br />
Ausweisungen,<br />
die bisher von<br />
den Fremdenpoliziebehörden nach<br />
Abschluss des Asylverfahrens erlassen<br />
wurden, werden nunmehr von den<br />
Asylbehörden ausgesprochen.<br />
Diese und weitere Neuerungen werfen<br />
24 KOMMUNAL<br />
In Neudörfl gibt es<br />
das klare Bekenntnis,<br />
den politischen<br />
Willen und damit ein<br />
sichtbares Zeichen<br />
gelebter Solidarität.<br />
AsylG (Asylgesetz) in der Fassung der Novelle 2003<br />
dörfl in der gleichnamigen kleinen<br />
burgenländischen Gemeinde. Dort<br />
leben seit Jahren AsylwerberInnen in<br />
integrierter Weise mit der Bevölkerung<br />
zusammen. Dank<br />
der vielen Anstrengungen<br />
des Bürgermei-<br />
sters, der Vizebürgermeisterin,<br />
des Bezirkshauptmannes,<br />
den Verantwortlichen<br />
bei den<br />
Behörden und viel<br />
sozial engagierter Menschen<br />
in Neudörfl. Dort<br />
gibt es das klare<br />
Bekenntnis, den politischen<br />
Willen und<br />
damit ein sichtbares Zeichen gelebter<br />
Solidarität.<br />
Gerne würde man Neudörfl auf Österreich<br />
ausgeweitet und als Staatsbürger/in<br />
die rechtsstaatlichen und humanitären<br />
Verpflichtungen in einem reichen<br />
europäischen Land als selbstverständlich<br />
erfüllt sehen. Es geht dabei<br />
um nicht weniger als die Erfüllung von<br />
Grundrechten! Um eine minimale<br />
Grundversorgung, die es schlicht einzuhalten<br />
gilt. Dafür braucht es in diesem<br />
Land noch viel Mut und noch viel<br />
mehr Kraftanstrengung!<br />
Kommentierung und Materialien<br />
zahlreiche Auslegungsfragen auf, die<br />
alle mit dem AsylG befassten Menschen<br />
und Institutionen vor schwierig zu<br />
lösende Aufgaben stellt. Das vorliegende<br />
Werk bietet eine umfangreiche<br />
Kommentierung des novellierten AsylG<br />
samt Gesetzesmaterialien und einer<br />
umfassenden Judikatesammlung.<br />
Exkurse zum Dubliner Übereinkommen,<br />
Eurodac und zur Dublin-II-Verordnung<br />
sowie ein Anhang mit sämtlichen<br />
für das Asylrecht relevanten Rechtsnormen<br />
formen den Kommentar zu einem<br />
unverzichtbaren Nachschlagewerk für<br />
alle mit dem Asylrecht Befassten.<br />
Das Buch<br />
Schmid/Frank/Anerinhof, „AsylG<br />
– Asylgesetz in der Fassung der<br />
Novelle 2003“, (Stand 1. Mai<br />
2004), Neuer Wissenschaftlicher<br />
Verlag, 2004, Brosch., 716 Seiten,<br />
68 Euro, ISBN: 3-7083-0201-X<br />
Tel: 01/5356103 DW 21-23 oder<br />
per E-Mail an office@nwv.at<br />
Auch die Qualität der Erstbefüllung auf<br />
Gemeindeebene kann bis Oktober noch<br />
geprüft werden.<br />
Nach intensiven Abstimmgesprächen<br />
bezüglich:<br />
◆ Adressmerkmale laut § 9a<br />
VermG<br />
◆ Vollständigkeit und Qualität bei Erstbefüllung<br />
des AdrReg und des GWR<br />
und<br />
◆ Schnittstellen zum ZMR – im besonderen<br />
zum Projekt ZMR II – wurde als<br />
neuer Termin für den Echteinsatz der<br />
Meldeschiene Adress-GWR-Online (lt.<br />
GWR-Gesetz der 1.7.2004 ursprünglich<br />
vorgesehen) und damit für die Wirksamkeit<br />
für die Gemeinden der 1.<br />
Oktober 2004 festgelegt.<br />
Das bedeutet, dass<br />
◆ der Vollbetrieb Adress-GWR-Online<br />
ab 1.10.2004 läuft,<br />
◆ alle neuen Adressen (auch für das<br />
Meldewesen – ZMR) ab 1.10.2004 über<br />
das Adress-GWR-Online erfasst werden<br />
müssen und<br />
◆ mit 1.10.2004 auch der Umstieg auf<br />
ZMR 2 erfolgt.<br />
Zeitplan bis zum<br />
Vollbetrieb 1.10.2004<br />
Es sind verschiedenste Aktivitäten von<br />
der Statistik Österreich (StAT; GWR)<br />
und dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen<br />
(BEV; AdrReg) zu setzen.<br />
Städte und Gemeinden werden<br />
dabei jeweils entsprechend einbezogen<br />
bzw. informiert.<br />
◆ Definition der Adressattribute in der<br />
Adressregister Verordnung (AdrReg-<br />
VO) zum VermG erfolgt noch im Juni
Adressregister-Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)-Online<br />
Neuer Start-Termin<br />
ist der 1. Oktober<br />
◆ Dipl.-Ing. Johann Mittheisz<br />
2004 durch das BEV. Es wird dabei auf<br />
den Sitzungsergebnissen der Arbeitsgruppe<br />
Q-AR, zuletzt am 1.6.2004, aufgebaut.<br />
◆ Erstbefüllung mit den Daten aus<br />
Großzählungen 2001, ZMR und BEV-<br />
Grundstücksdatenbank.<br />
◆ Aussendung des AdrReg VO-Entwurfs<br />
zur Begutachtung wird seitens<br />
BMWA mit Anfang Juli 2004 angestrebt.<br />
◆ Inkrafttreten der AdrReg VO ist für<br />
Anfang September 2004 geplant.<br />
◆ Fertigstellung der fehlenden Applikationsteile<br />
Adress-GWR-Online, insbe-<br />
sondere Geocodierungsclient und die<br />
Prüfroutinen mit der Grundstücksdatenbank<br />
(GDB).<br />
◆ Abschließende Abstimmung der<br />
technischen Inhalte<br />
(Schlüssel, Wertevorrat<br />
etc.) ist am<br />
17.6.2004 mit Vertretern<br />
des Gemeindeund<br />
Städtebunds geplant.<br />
◆ Veröffentlichung der XML-Schnittstelle<br />
zum Adress-GWR-Online ist noch<br />
im Juni 2004 vorgesehen.<br />
◆ Ab Juli 2004 soll Testbetrieb für alle<br />
Gemeinden möglich sein, um mit dem<br />
neuen Meldesystem Erfahrungen in<br />
den tatsächlich betroffenen Stellen der<br />
Gemeinden zu erhalten und auch die<br />
Qualität der Erstbefüllung auf Gemeindeebene<br />
prüfen zu können. Ab September<br />
2004 stehen dann im Testbetrieb<br />
auch der Geocodierungsclient und die<br />
Prüfroutinen zur GDB zur Verfügung.<br />
◆ Im Testbetrieb wird durch StAT<br />
Verwaltung<br />
In den <strong>Ausgabe</strong>n Februar bis April 2004 berichtete KOMMUNAL jeweils ausführlich zum<br />
Thema Adress-GWR-Online, Adressregister (AdrReg) und Gebäude- und Wohnungsregister<br />
(GWR). In dieser <strong>Ausgabe</strong> zeigen wir den aktuellen Stand der Aktivitäten zu<br />
GWR, AdrReg und der gemeinsamen Meldeschiene Adress-GWR-Online auf.<br />
* pro Nutzungseinheit Anzahl der Haupt- und Nebenwohnsitze<br />
Ein Schaubild zeigt den Zusammenhang<br />
zwischen Gemeinden, Meldeschiene und<br />
den Registern auf Bundesseite auf.<br />
Ab Juli 2004 soll<br />
Testbetrieb für alle<br />
Gemeinden möglich sein,<br />
um mit dem neuen Meldesystem<br />
Erfahrungen in<br />
den tatsächlich betroffenen<br />
Stellen der Gemeinden<br />
zu erhalten.<br />
schon mit einer Hotline unterstützt.<br />
◆ Mit 1.10.2004 ist definitiv Übergang<br />
in den Vollbetrieb (mit allen Prüfroutinen<br />
und auch dem Geocodierungsclient), ein<br />
Schulungssystem wird auch weiterhin<br />
zum Üben verfügbar sein.<br />
Informationen für die<br />
Gemeinden<br />
In den nächsten Monaten wird<br />
seitens StAT zum GWR und seitens<br />
BEV zum AdrReg entsprechend<br />
informiert werden. Die<br />
Information zu der für die<br />
Gemeinde einheitlichen Schnittstelle<br />
Adress-GWR-Online, die für<br />
beide Register die relevante<br />
Datenpflege über HTML und XML<br />
erlauben wird, erfolgt gemeinsam<br />
durch StAT und BEV. Informationen<br />
sind z.B. unter<br />
http://www.statistik.at/adress-gwronline/index.shtml<br />
verfügbar.<br />
◆ SR Dipl.-Ing.<br />
Johann Mittheisz ist Leiter der<br />
E-Government-Roadmap-Arbeitsgruppe<br />
„Adressregister“ (Q-AR) der Stadt Wien<br />
KOMMUNAL 25
Recht & Verwaltung<br />
Im Freibad nach Vorschrift abgekühlt<br />
Die Badesaison<br />
hat begonnen<br />
Obwohl nicht unbedingt eine kommunale Pflichtaufgabe,<br />
werden doch von vielen Gemeinden Bäder errichtet<br />
und betrieben. Dass dabei neben baurechtlichen<br />
Bestimmungen auch das Bäderhygienegesetz zu<br />
beachten ist, erinnern wir in KOMMUNAL.<br />
◆ Dr. Roman Häußl<br />
Als Richtlinien für die Errichtung und<br />
den Betrieb von Bädern sind aber nicht<br />
nur allfällige baurechtliche Bestimmungen,<br />
sondern vor allem das Bäderhygienegesetz,<br />
BGBl.Nr. 254/1976 i.d.F.<br />
BGBl. I Nr. 98/2001, maßgebend.<br />
Gemäss § 1 Abs.3 leg.cit. sind Bäder<br />
(Hallenbäder, künstliche Freibäder,<br />
Warmsprudelbecken-Whirlpools und<br />
Bäder an Oberflächengewässern), die<br />
im Rahmen einer der Gewerbeordnung<br />
unterliegenden Tätigkeit betrieben werden,<br />
genehmigungspflichtige Betriebsanlagen<br />
im Sinne des § 74 der Gewerbeordnung<br />
1994. Für die Errichtung<br />
und den Betrieb von Bädern ist daher<br />
einiges zu beachten.<br />
Die Vorschriften<br />
◆ Die Errichtung von Hallenbädern,<br />
künstlichen Freibädern, Warmsprudel-<br />
◆ Dr. Roman<br />
Häußl ist Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei<br />
Dr. Franz Nistelberger<br />
26 KOMMUNAL<br />
becken und Kleinbadeteichen bedarf<br />
gemäss § 3 Abs.1 Bäderhygienegesetz<br />
einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde.<br />
Hallenbäder, künstlichen Freibäder,<br />
Warmsprudelbecken und Kleinbadeteiche<br />
dürfen erst aufgrund einer Betriebsbewilligung<br />
der Bezirksverwaltungsbehörde<br />
in Betrieb genommen werden.<br />
◆ Jede Änderung oder Erweiterung<br />
von Bädern, Sauna-Anlagen, Warmluftoder<br />
Dampfbädern oder Kleinbadeteichen,<br />
durch die sich Gefährdungen für<br />
die Gesundheit der Badegäste oder der<br />
Gäste der Sauna-Anlagen, Warmluftoder<br />
Dampfbäder, insbesondere in<br />
hygienischer Hinsicht ergeben können,<br />
bedarf einer Bewilligung im Sinne der<br />
vorstehenden Bestimmungen.<br />
◆ Ergibt sich nach rechtskräftiger Erteilung<br />
einer Bewilligung gemäss §§ 4<br />
oder 5 Bäderhygienegesetz,<br />
dass trotz<br />
Einhaltung der<br />
bescheidmäßig vorgeschriebenenAuflagen<br />
der Schutz der<br />
Gesundheit der<br />
Badegäste oder der<br />
Gäste der Sauna-<br />
Anlagen, Warmluftoder<br />
Dampfbäder –<br />
insbesondere in<br />
hygienischer Hinsicht<br />
– nicht hinreichend<br />
gewährleistet<br />
ist, so hat die<br />
Bezirksverwaltungs-<br />
Gemäss § 14 Abs.2<br />
leg.cit. hat die ein Bad<br />
betreibende Gemeinde<br />
einmal jährlich ein<br />
wasserhygienisches<br />
Gutachten über die<br />
Beschaffenheit des<br />
Beckenwassers ... durch<br />
einen Sachverständigen<br />
der Hygiene einzuholen.<br />
behörde andere oder zusätzliche Auflagen<br />
vorzuschreiben. Die Bezirksverwaltungsbehörde<br />
hat gemäss § 9a Abs.1<br />
leg.cit. die Qualität der Badewässer (§ 2<br />
Abs.5) während der Badesaison zu<br />
überwachen und zu diesem Zweck die<br />
Wasserqualität von Badestellen (§ 2<br />
Abs.11) durch Besichtigung und Messungen<br />
an Ort und Stelle sowie durch<br />
die Entnahme und Untersuchung von<br />
Wasserproben zu überprüfen. Hiebei<br />
sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde<br />
sowie die von dieser herangezogenen<br />
Sachverständigen berechtigt,<br />
die den Badestellen anliegenden<br />
Grundstücke zu betreten und die zur<br />
Überprüfung der Wasserqualität erforderlichen<br />
Maßnahmen vorzunehmen.<br />
Gemäss § 14 Abs.1 Bäderhygienegesetz<br />
hat der Inhaber eines Bades – in unserem<br />
Fall also die jeweilige Gemeinde –<br />
dafür zu sorgen, dass<br />
während der Betriebszeiten<br />
eine Person<br />
erreichbar ist, die mit<br />
der Wahrnehmung des<br />
Schutzes der Gesundheit<br />
der Badegäste oder<br />
der Gäste der Sauna-<br />
Anlagen oder Warmluft-<br />
oder Dampfbäder<br />
– insbesondere in<br />
hygienischer Hinsicht –<br />
betraut ist und die entsprechendenKenntnisse<br />
aufweist.<br />
◆ Gemäss § 14 Abs.2<br />
leg.cit. hat die ein Bad
etreibende Gemeinde einmal jährlich<br />
ein wasserhygienisches Gutachten über<br />
die Beschaffenheit des Beckenwassers<br />
bzw. Wassers des Kleinbadeteiches<br />
sowie über die Beschaffenheit des<br />
Wasch- und Brausewassers, wenn dieses<br />
nicht aus einer öffentlichen Trinkwasserversorgung<br />
entnommen wird, durch<br />
einen Sachverständigen der Hygiene<br />
einzuholen.<br />
◆ Die ein Bad betreibende Gemeinde<br />
hat ferner dafür zu sorgen, dass hinsichtlich<br />
der hygienischen Betriebsführung<br />
innerbetriebliche Kontrollen<br />
vorgenommen und hierüber Aufzeichnungen<br />
geführt werden. Gutachten<br />
gemäss § 14 Abs.2 und 5 sind diesen<br />
Aufzeichnungen anzuschließen und<br />
zumindest durch drei Jahre hindurch<br />
aufzubewahren.<br />
Empfehlung<br />
Die sich aus der vorstehenden Aufzählung<br />
für den Betrieb von Badeanlagen<br />
ergebenden Verpflichtungen sind bei<br />
Nichtbeachtung mit Strafsanktionen<br />
bedroht und wird den Gemeinden<br />
daher empfohlen, die vorgenannten<br />
Bestimmungen striktest einzuhalten.<br />
Bezüglich der Haftung für die in Badeanlagen<br />
aufgestellten Spiel- und Sportgeräte<br />
siehe KOMMUNAL Nr. 6 aus<br />
2000 „Wer haftet bei schadhafter Einrichtung<br />
für Spielgeräte auf öffentlichen<br />
Kinderspielplätzen?“. Die dort gemachten<br />
Aussagen gelten auch für Badeanlagen.<br />
KOMMUNAL-Leserservice<br />
Auf Österreichs größter Medien-Datenbank findet der User mehr als neun Millionen<br />
Dokumente, täglich kommen ca. 7000 dazu. Der Links dorthin ist auf<br />
www.kommunal.at/archiv zu finden.<br />
KOMMUNAL eröffnet Zugang zur DeFacto-Suchmaschine<br />
<strong>Kommunal</strong>e Infoquelle<br />
sprudelt weiter<br />
Seit mehr als 10 Jahren zählt KOMMU-<br />
NAL, das größte Fachmagazin für<br />
Österreichs Gemeinden und offizielles<br />
Organ des Österreichischen Gemeindebundes,<br />
für kommunale Entscheidungsträger<br />
zur monatlichen Pflichtlektüre.<br />
Die gemeindepolitisch elitäre Leserschaft<br />
verfügt über eine Jahresinvestitionssumme<br />
von mehr als 13,3 Mrd.<br />
Euro und ist damit der größte öffentliche<br />
Investor in Österreich.<br />
KOMMUNAL steht dabei als Mittler<br />
zwischen Wirtschaft und Gemeinden.<br />
„Wir sehen uns als Wegbereiter zu<br />
einer ungeheuren öffentlichen Investitionssumme.<br />
Mit mehr als 35.800 Beziehern<br />
auf Bundes- Länder- und <strong>Kommunal</strong>ebene<br />
decken wir genau jene Bereiche<br />
ab, in denen kommunale Investitions-,<br />
Wirtschafts-, Finanz- und Förderfragen<br />
diskutiert und entschieden werden“,<br />
hebt Johanna Ritter,<br />
Verkaufsleiterin von KOMMUNAL, die<br />
Vorteile des Magazins heraus.<br />
Um seine Zielgruppe noch intensiver zu<br />
informieren, hat der <strong>Kommunal</strong>-Verlag<br />
sich nun entschlossen, für seine Online-<br />
User einen Zugang zur DeFacto-Suchmaschine,<br />
der größten Mediendatenbank<br />
im deutschsprachigen Raum, einzurichten.<br />
Unter www.kommunal.at<br />
gelangt der interessierte User über die<br />
Navigationsleiste „Archiv“ zum umfassenden<br />
APA-DeFacto-Medienpool, in<br />
dem sich neben nationalen und internationalen<br />
Medien auch Fach- und<br />
Firmendatenbanken und rückwirkend<br />
mit 1.1.2003 auch die Inhalte des<br />
KOMMUNAL selbst wiederfinden.<br />
„Unsere Inhalte in die DeFacto-Suchmaschine<br />
zu integrieren, ist für uns ein<br />
Schritt, die TOP-Fachinformationen des<br />
KOMMUNAL einer noch breiteren Nutzerschicht<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Andererseits freuen wir uns, dass wir<br />
mit dem Online-Zugang dem informationsbewussten<br />
Nutzer Mittel und Wege<br />
zur Verfügung stellen zu können, um<br />
sein Informationsbedürfnis auch über<br />
die für die Kommunen wichtigen Produkte<br />
und Dienstleistungen vollständig<br />
abzudecken“, so Ritter weiter.<br />
Die DeFacto-Suchmaschine<br />
Die kostenpflichtige Mediendatenbank<br />
der APA-DeFacto GmbH umfasst sämtliche<br />
österreichische Tageszeitungen,<br />
Zeitschriften und Magazine, relevante<br />
internationale Medien, Fach- und Firmendatenbanken<br />
sowie das APA OTS<br />
Originaltext-Service und beinhaltet derzeit<br />
mehr als neun Millionen Dokumente,<br />
täglich kommen ca. 7.000 dazu.<br />
KOMMUNAL 27
Europa<br />
Erste Sitzungen in Südtirol und Katalonien<br />
ICNW startet die<br />
inhaltliche Arbeit<br />
Nachdem das Internationale <strong>Kommunal</strong>e Netzwerk Ende April seine Konstituierung<br />
in Klosterneuburg vorgenommen hat, mussten im Mai und Juni noch alle drei<br />
Komponenten die inhaltliche Arbeit aufnehmen. KOMMUNAL berichtet von den<br />
Arbeitsgruppen für Klein und Mittelbetriebe und für Strategien und örtliche<br />
Raumplanung aus Südtirol und in Katalonien.<br />
◆ Mag. Nicolaus Drimmel<br />
Für die Themenfelder „Klein- und Mittelunternehmen<br />
(KMU)“, „Strategische<br />
Planung und Flächenwidmung“ und<br />
„Infrastruktur“ mussten daher konkrete<br />
Termine für die Start-Arbeitsgruppen<br />
noch im ersten Halbjahr gefunden werden,<br />
um die Vorgaben der konkreten<br />
Planung und des eingereichten Budgets<br />
des Netzwerkes einzuhalten. Trotz der<br />
knappen Zeitvorgaben fanden sich bald<br />
drei Netzwerkpartner, die sich für die<br />
Abhaltung dieser „Europäischen Werkstätten“<br />
bereit erklärten.<br />
Sand organisiert<br />
KMU-Arbeitsgruppe<br />
Gastgeber der ersten Arbeitsgruppensitzung<br />
am 23. und 24. Mai war der Südtiroler<br />
Gemeindenverband mit Bürgermeister<br />
Toni Innerhofer aus Sand in<br />
Taufers im Südtiroler Ahrntal. Die The-<br />
◆ Reg. Rat Mag. Nicolaus Drimmel<br />
ist Jurist beim Österreichischen<br />
Gemeindebund<br />
28 KOMMUNAL<br />
matik der Klein- und Mittelbetriebe war<br />
gut gewählt, da sich mit dem Ort der<br />
Sitzung auch eine äußerst erfolgreiche<br />
ländliche Gemeinde mit einem besonderen<br />
Ansiedlungskonzept für Kleinund<br />
Mittelunternehmen präsentieren<br />
konnte.<br />
Toni Innerhofer, der als<br />
langjähriges Mitglied des<br />
Vorstands des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes<br />
auch dem Österreichischen<br />
Gemeindebund<br />
kein unbekannter ist,<br />
konnte nicht ohne Stolz<br />
über die erfolgreiche Entwicklung<br />
seiner Heimatgemeinde<br />
berichten.<br />
Allein die schöne Lage<br />
südlich des Alpenhauptkammes<br />
mit Blick auf die<br />
Zillertaler Alpen lässt<br />
Sand in Taufers<br />
unschwer als Fremdenverkehrsgemeindeerkennen,<br />
jedoch hat sich die aus fünf Katastralgemeinden<br />
(Fraktionen) beste-<br />
hende Kommune mit 5000 Einwohnern<br />
(und 1682 Haushalten) zum Ziel<br />
gesetzt, einen richtigen Mix aus Landwirtschaft,<br />
Tourismus, Gewerbe bzw.<br />
Handwerk und Industrie zu beherbergen,<br />
um die Stärken der Region richtig<br />
auszuspielen und auch entsprechend<br />
viele Arbeitsplätze im eigenen Tal zu<br />
erhalten.<br />
Das schöne Erbe der Natur allerdings<br />
fällt nicht nur für den Fremdenverkehr<br />
In Sand wurde<br />
primär der<br />
Informationsbedarf<br />
der ländlichen<br />
Gemeinden<br />
vor allem in den<br />
mittel- und osteuropäischen<br />
Ländern<br />
umrissen.<br />
als Stärke ins Gewicht, sondern birgt<br />
auch Veranwtortung und eine nicht<br />
unerhebliche Belastung. Durch die Zahlen<br />
über die flächenmäßige<br />
Erstreckung der Gemeinde wird dies<br />
dokumentiert, sie umfasst eine Fläche<br />
von mehr als 164 Quadratkilometern,<br />
fast 50 Quadratkilometer<br />
davon sind<br />
Waldfläche. Der stetige<br />
Zuwachs an Bewohnern<br />
bestätigt die nachhaltige<br />
Entwicklung dieser Landgemeinde,<br />
meinte Toni Innerhofer,<br />
in seinem Statement<br />
legte er den Gästen des<br />
Netzwerkes nahe , die eigenen<br />
Stärken zu nutzen und<br />
auszubauen.<br />
Über Bespiele verfügte der<br />
Bürgermeister genug. Die<br />
Vorstellung des Gewerbeparkes<br />
und anderer Einrichtungen<br />
illustrierten, wie<br />
die Gemeinde mit dem<br />
„Argument Lebensqualität“ die Bevölkerung<br />
im ländlichen Raum zu halten<br />
vermochte. Dies wäre allein schon<br />
Grund genug gewesen, Sand in Taufers<br />
zu besuchen. Die einladenden Sitzungsräumlichkeiten<br />
erleichterten der<br />
Arbeitsgruppe, für diese Komponente<br />
den Informationsbedarf der ländlichen<br />
Gemeinden vor allem in den mittelund<br />
osteuropäischen Ländern zu<br />
umreißen und damit auch den Rahmen<br />
für die Themenstellung für die Erarbeitung<br />
von positiven Beispielen (Best
Die ICNW-Tagungen<br />
Nach der konstituierenden Sitzung<br />
in Klosterneuburg mussten Termine<br />
für die Arbeitssitzungen<br />
gefunden werden.<br />
Toni Innerhofer (stehend), Bürgermeister<br />
von Sand in Taufers/Südtirol,<br />
begrüßt die Teilnehmer an der<br />
ersten ICNW-Tagung.<br />
Gastgeber der zweiten ICNW-Sitzung<br />
war die katalanische<br />
Gemeinde Granollers unweit von<br />
Barcelona. Die Arbeitsgruppe<br />
wurde aufgrund der dichten Tagesordnung<br />
schon am Abend vor der<br />
Sitzung zusammengerufen, um die<br />
ersten Aufgaben abzuarbeiten.<br />
(unten)<br />
Practice Modellen) zu einer nachhaltigen<br />
Sicherung einer kleinwirtschaftlichen<br />
Struktur festzulegen. Die Ergebnisse<br />
werden ab Sommer 2004 auf der<br />
Internet-Präsentation<br />
des<br />
ICNW<br />
www.icnw.org<br />
abrufbar sein.<br />
Auf Wunsch der<br />
Teilnehmer der<br />
Arbeitsgruppe<br />
wurde schließlich<br />
der Gewerbepark<br />
mit einigen<br />
Betrieben<br />
besucht, auch die Kompostierungsanlage<br />
und die getrennte Altstoffsammlung<br />
wurde<br />
besichtigt. Schließlich<br />
konnte eine weitere Gruppe<br />
auch eine Landwirtschaft<br />
mit Direktvermarktung der<br />
eigenen Produkte besuchen.<br />
Auch wenn diese Sitzung<br />
erst der Bestandsaufnahme<br />
des Informationsbedarfes<br />
und dem Umreißen der<br />
ersten möglichen Praxisbeispielen<br />
dienen konnte, rei-<br />
Europa<br />
sten einige der Teilnehmer auch schon<br />
mit konkreten Antworten aus Sand in<br />
Taufers nach Hause.<br />
Raumplanung in<br />
Katalonien<br />
Eine Woche später, am 1. und 2. Juni,<br />
tagte das ICNW erneut mit seiner zweite<br />
Arbeitsgruppensitzung zur Erarbeitung<br />
von Strategieplänen und einer nachhaltigen<br />
Flächenwidmung. Gastgeber war<br />
diesmal die katalanische Gemeinde Granollers<br />
unweit von Barcelona. Die<br />
Arbeitsgruppe wurde aufgrund der dichten<br />
Tagesordnung schon am Abend vor<br />
der Sitzung zusammengerufen, um die<br />
ersten Aufgaben abzuarbeiten.<br />
Am Folgetag beeindruckte Bürgermeister<br />
Josep Mayoral (nomen est omen)<br />
mit seinen fundierten Ausführungen<br />
über die sich laufend ändernden Rahmenbedingungen<br />
für die kommunale<br />
Planung. Besonders in Industriegebieten<br />
seien die Gemeinden auch durch die<br />
geänderten Rahmenbedingungen der<br />
Produktion abhängig, gerade Granollers<br />
ist mit einer ehemals florierenden Textilindustrie<br />
vor große Probleme gestellt<br />
worden. Die Gemeinde hat es nun<br />
geschafft, vor allem dem Handel und<br />
dem Gewerbe Raum zu bieten, der auch<br />
angenommen wurde. Trotz vieler verfügbarer<br />
Flächen sei eine strategische<br />
Planung erforderlich,<br />
die den Menschen<br />
nicht nur<br />
Arbeit, sondern<br />
auch Erholungsräume<br />
und<br />
Lebensqualität<br />
sichert. Eine verantwortungsvolle<br />
Haushalten mit<br />
den Ressourcen<br />
sei auch in Katalonien<br />
ein wichtiger<br />
Maßstab für Entwicklungsstrategien,<br />
und schließlich<br />
müsse bei längerfristigen Planungen<br />
auch mit Nachbargemeinden kooperiert<br />
werden, obwohl das nicht immer leicht<br />
sei, meinte Mayoral.<br />
Ergänzt wurde dieser Vortrag durch den<br />
Leiter der städtischen Abteilung für strategische<br />
Prozesse, Partizipation und<br />
Wirtschaftsförderung, die sich einerseits<br />
mit den sozialen und technologischen<br />
Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung<br />
der Gemeinde befasst, schließlich<br />
aber auch noch den Bereich der Bildung<br />
und ökonomischen Entwicklung<br />
mitumfasst.<br />
Die Arbeitsgruppe wurde von Mag.<br />
In Granollers musste<br />
aus einer Fülle von<br />
möglichen Schwerpunktsetzungen<br />
eine<br />
engere Auswahl getroffen<br />
werden, um die<br />
Kräfte nicht allzu stark<br />
zu verschleißen.<br />
KOMMUNAL 29
Europa<br />
Drimmel als Vertreter des Lead-Partners<br />
und Mag. Eva Bogensberger als Netzwerk-Managerin<br />
geführt und<br />
inhaltlich von<br />
der Expertin<br />
Hofrätin Dr. Ilse<br />
Wollansky von<br />
der NÖ Landesregierungbegleitet.<br />
Aus einer<br />
Fülle von möglichenSchwerpunktsetzungen<br />
wurde schließlich<br />
eine engere<br />
Auswahl getroffen,<br />
um die<br />
Kräfte nicht allzu<br />
stark zu verschleißen,<br />
und<br />
die Fristen zur<br />
Einbringung von konkreten Inhalten<br />
wurden gesetzt.<br />
Das ICNW soll<br />
für den inhaltlichen<br />
Input in den<br />
Arbeitsgruppen als<br />
Ideenpool fungieren<br />
und Hilfestellungen<br />
für Netzwerkteilnehmer<br />
und<br />
informationssuchende<br />
Gemeinden geben.<br />
Strategie und<br />
Zielsetzung des ICNW<br />
Auch in dieser Arbeitsgruppe wurden<br />
neben dem Abstecken des Informationsbedarfes<br />
die Aufgaben für die kommenden<br />
drei Jahre definiert und Fristen zur<br />
Umsetzung der inhaltlichen Inputs<br />
gesetzt. Das ICNW soll dabei für den<br />
inhaltlichen Input in dieser Arbeitsgruppe<br />
◆ als Ideenpool fungieren,<br />
◆ Hilfestellungen für Netzwerkteilnehmer<br />
und informationssuchende<br />
Gemeinden geben,<br />
◆ Plattform für mögliche Kooperationen<br />
◆ und schließlich Initiator für innovative<br />
Lösungen im Bereich der verschiedenen<br />
Handlungsfelder einer<br />
Gemeinde sein.<br />
Ankündigung<br />
Die Arbeitsgruppe zur dritten inhaltlichen<br />
Säule des ICNW „<strong>Kommunal</strong>e<br />
Infrastruktur“ fand am 14. und 15.<br />
Juni in der Region Kaschau (Kosice,<br />
SK) statt. Als Vertreter des Lead-Partners<br />
fungierte der 2. Vizepräsident<br />
des Gemeindebundes, Bgm. Bernd<br />
Vögerle, die inhaltliche Betreuung<br />
übernahmen Hofrat Bruno Saurer<br />
und Landesrat a.D. Herbert Schiller.<br />
Zu Redaktionsschluss lag noch kein<br />
Bericht der Sitzung vor.<br />
KOMMUNAL wird in der Folgenummer<br />
darüber sowie über den Web-<br />
Auftritt des ICNW berichten.<br />
30 KOMMUNAL<br />
Weißbuch zu Dienstleistungen<br />
Klare Absage<br />
an Rahmenrichtlinie<br />
Am 12. Mai hat die Europäische Kommission das lang<br />
erwartete Weißbuch zu Dienstleistungen von<br />
allgemeinem Interesse angenommen. Dieses enthält die<br />
Schlussfolgerungen aus der öffentlichen Konsultation zu<br />
dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Grünbuch.<br />
◆ Mag. Daniela Fraiss<br />
Im Rahmen der europaweiten Konsultation<br />
waren ca. 300 Stellungnahmen<br />
eingelangt, welche die Basis für die im<br />
Weißbuch gezogenen Schlussfolgerungen<br />
bildeten.<br />
Das wichtigste Ergebnis der Konsultation<br />
ist die klare Absage an eine Rahmenrichtlinie,<br />
diese wird zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt als wenig sinnvoll<br />
angesehen.<br />
Die Kommission verlegt sich im Weißbuch<br />
darauf, die Vorgehensweise der<br />
Europäischen Union bei der Förderung<br />
der Entwicklung hochwertigerDienstleistungen<br />
von allgemeinem<br />
Interesse darzustellen<br />
und den status quo zu<br />
beschreiben. Herausgestellt<br />
wird etwa die<br />
gemeinsame Verantwortung<br />
von Union und<br />
Mitgliedstaaten bei der<br />
Gewährleistung dieser<br />
Dienste sowie die<br />
bedeutende Rolle der<br />
nationalen, regionalen<br />
und lokalen Behörden<br />
bei der Festlegung von<br />
Gemeinwohlaufgaben<br />
sowie deren organisatorischer<br />
Abwicklung,<br />
Finanzierung und Kontrolle.<br />
Dargestellt werden auch die Hauptbe-<br />
Herausgestellt<br />
wird im Weißbuch<br />
die gemeinsame Verantwortung<br />
von<br />
Union und Mitgliedstaaten<br />
bei der<br />
Gewährleistung von<br />
„Dienstleistungen<br />
von allgemeinem<br />
Interesse“.<br />
standteile einer EU-Strategie, die langfristig<br />
jedem Bürger und jedem Unternehmen<br />
den Zugang zu einem umfassenden<br />
Dienstleistungsangebot ermöglichen<br />
soll.<br />
Der sektorale Ansatz<br />
Das Absehen von einer horizontalen<br />
Regelung steht dem Fortsetzen der bisherigen<br />
Politik nicht im Wege. Die<br />
Kommission will daher ihren bisherigen<br />
sektoralen Ansatz weiterverfolgen und<br />
in den großen, netzgebundenen<br />
Sektoren<br />
spezifische Regelungen<br />
vorschlagen bzw. bestehende<br />
Richtlinien<br />
novellieren. Zu nennen<br />
sind hier: Elektronische<br />
Kommunikation, Postdienste,<br />
Elektrizität,<br />
Gas, Wasser, Verkehr<br />
und Rundfunk.<br />
In dem für Österreich<br />
heiklen Wassersektor<br />
kündigt die Kommission<br />
eine Bewertung bis<br />
Ende des Jahres an.<br />
Diese geht auf die im<br />
Mai 2003 veröffentlichteBinnenmarktstrategie<br />
2003 - 2006 zurück, wo der Wassersektor<br />
einem direkten Vergleich mit
Die Grünbuchkonsultationen und Stellungnahmen<br />
des Europäischen Parlaments<br />
erteilten den Liberalisierungs- und<br />
Regulierungstendenzen im Wassermarkt<br />
eine klare Absage. Trotzdem lässt sich die<br />
Kommission aber alle Türen offen. Der zukünftige Hauptsitz der EU-Kom-<br />
dem liberalisierten Strom- und Telekommunikationssektor<br />
unterzogen<br />
wurde und gesetzgeberische Maßnahmen<br />
nicht ausgeschlossen wurden. Die<br />
Grünbuchkonsultation und die<br />
Stellungnahmen des Europäischen Parlaments<br />
zur Binnenmarktstrategie und<br />
zum Grünbuch erteilten den Liberalisierungs-<br />
und Regulierungstendenzen im<br />
Wassermarkt jedoch eine klare Absage.<br />
Grundsätzlich lässt sich die Kommission<br />
aber alle Türen offen und schließt<br />
nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt<br />
die Frage der Rahmenrichtlinie wieder<br />
aufzunehmen. Nach In-Kraft-Treten der<br />
Europäischen Verfassung würde etwa<br />
der derzeitige Art. III-6 des Verfassungsentwurfs<br />
eine Rahmenrichtlinie<br />
zur Definition der wirtschaftlichen und<br />
finanziellen Grundsätze und Bedingungen<br />
für die Erfüllung öffentlicher Dienste<br />
erlauben.<br />
http://europa.eu.int/comm/<br />
secretariat_general/services_<br />
general_interest/index_de.htm<br />
◆ Mag. Daniela Fraiss leitet das<br />
Brüsseler Büro des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
Neues aus Brüssel<br />
Brüssel Berlaymont<br />
Vom Asbestmonster<br />
zum Musterbeispiel<br />
mission, das Berlaymontgebäude im<br />
Herzen des Brüsseler Europaviertels<br />
machte in den letzten Jahren eine<br />
Wandlung vom Saulus zum Paulus<br />
durch.<br />
Das 1991 aufgrund des flächendeckenden<br />
Einsatzes von Asbest evakuierte<br />
Gebäude wird seit beinahe 10 Jahren<br />
saniert und renoviert. Als erster Schritt<br />
mussten Tonnen von Asbest, das die<br />
Stahlstruktur vor Feuer schützen sollte<br />
und letztlich an allen Ecken und Enden<br />
des Gebäudes gefunden wurde, entfernt<br />
werden. Danach begannen Ende der<br />
Neunzigerjahre die tatsächlichen Renovierungsarbeiten.<br />
Diese kommen nun<br />
langsam aber sicher zu einem Ende. Das<br />
in diesem Jahr anvisierte Einzugsdatum<br />
30. Juni dürfte zwar nicht gehalten werden,<br />
ein Einzug bis Jahresende scheint<br />
aber realistisch.<br />
Wenn ungefähr 3000 Kommissionsbeamte<br />
in den neuen alten Hauptsitz<br />
zurückkehren, wird dieser ein Musterbeispiel<br />
nachhaltigen Bauens darstellen.<br />
Die Renovierungsarbeiten wurden nämlich<br />
unter anderem für einige wichtige<br />
Neuerungen genutzt. Eine im Keller des<br />
Gebäudes installierte Kraft-Wärme-<br />
Anlage wird den Gesamtenergiekonsum<br />
des Berlaymont um die Hälfte reduzieren,<br />
der Ausstoß von Treibhausgasen<br />
wird mit Hilfe dieser Anlage um vier<br />
Fünftel verringert. An der Fassade angebrachte<br />
Jalousien reduzieren die<br />
Absorption von Sonnenstrahlen an warmen<br />
Tagen um 89 Prozent, während sie<br />
in den dunkleren Monaten die Reflexion<br />
von natürlichem Licht um 300 Prozent<br />
erhöhen. Ein Regenwasserauffang-<br />
Österreichs Badeseen<br />
Im europäischen<br />
Spitzenfeld<br />
Europa<br />
becken am Dach wird Wasser für die<br />
Toilettenspülungen sammeln.<br />
Mit diesen Neuerungen wird das<br />
ursprünglich aus den 60er-Jahren stammende<br />
Gebäude einer der umwelttechnisch<br />
innovativsten Arbeitsplätze in<br />
Brüssel, wenn nicht in ganz Europa.<br />
Die EU-Kommission bescheinigt Österreichs<br />
Badegewässern in ihrem jährlichen<br />
Qualitätsbericht eine überaus hohe<br />
Wasserqualität. 97,4 Prozent der österreichischen<br />
Seen entsprachen im Jahr<br />
2003 den in der Badegewässer-Richtlinie<br />
(76/160/EEC) geforderten Standards,<br />
immerhin 80 Prozent entsprechen<br />
noch strengeren freiwilligen Vorgaben.<br />
Europaweit fallen über 13.000<br />
Küstenbadegebiete und über 5.700 Süßwasserseen<br />
unter die Richtlinie, wobei<br />
jeder Mitgliedstaat die zu überprüfenden<br />
Gebiete festlegt. Wird – aus welchen<br />
Gründen auch immer – ein Badeverbot<br />
ausgesprochen, muss der entsprechende<br />
Küstenabschnitt oder See nicht untersucht<br />
werden und fällt daher auch nicht<br />
unter die jährliche Statistik.<br />
In Österreich wurden im Vorjahr 266<br />
Badeseen überwacht, lediglich sechs entsprachen<br />
nicht den EU-Standards.<br />
Die Ergebnisse des Badegewässerberichts<br />
stammen übrigens nicht von der<br />
Kommission selbst. Geprüft wird in<br />
Österreich von unabhängigen Instituten,<br />
welche dezentral durch die Bezirksverwaltungsbehörden<br />
beauftragt werden.<br />
Erst die Endergebnisse eines jeden Mitgliedstaates<br />
werden gesammelt nach<br />
Brüssel übermittelt und dort im EU-<br />
Gesamtbericht zusammengefasst.<br />
◆ http://www.europa.eu.int/water/<br />
water-bathing/report.html<br />
◆ http://www.bmgf.gv.at/cms/site/<br />
detail.htm?thema=CH0009&doc=<br />
CMS1038840319710<br />
KOMMUNAL 31
Europa<br />
Europe Direct<br />
Mehr Bürgernähe<br />
für die Union<br />
Während der Konvent zur Zukunft<br />
Europas Mitte Juni seine Arbeit abgeschlossen<br />
hat, weitete die Kommission<br />
ihr Angebot „Europe Direkt“ aus, um<br />
die Bürger besser über die Vorgänge zu<br />
informieren.<br />
„Europe Direct“ beantwortet die Fragen<br />
von Bürgern aus allem EU-Mitgliedsländern<br />
in allen Amtssprrachen unter<br />
der gebührenfreien Rufnummer<br />
00800-67 89 10 11 oder per E-Mail<br />
unter der Adresse<br />
http://europa.eu.int/europedirect<br />
Seit Mai wurde dieser Dienst so erweitert,<br />
dass sich alle Besucher des<br />
Webservers „Europa“ im direkten Austausch<br />
mit einer Person des Callcenters<br />
von „EUrope Direct“ bei ihrer Online-<br />
Suche beraten lassen können.<br />
Diese neue Online Unterstützung kann<br />
während der Öffnungszeiten des Callcenters<br />
(Montag bis Freitag von 9 00 bis<br />
18 30 Uhr MEZ) in englischer und französischer<br />
Sprache in Anspruch genommen<br />
werden.<br />
Angeboten wird praktische Hilfe bei<br />
der Suche nach<br />
◆ allgemeinen Informationen von öffnetlichem<br />
Interesse über die einzelnen<br />
Politikbereiche der EU (Informationsblätter,<br />
Berichte, Statistiken,<br />
Arbeitspapiere etc.)<br />
◆ spezifischen EU-Dokumente auf dem<br />
Server „Europa“ (Rechtsvorschriften,<br />
Veröffentlichungen, Pressemitteilungen)<br />
◆ Informationen über die europäische<br />
Integration (Geschichte, Symbole,<br />
Anlaufstellen usw.)<br />
32 KOMMUNAL<br />
Ohne Kommunen ist in Europa kein Staat zu machen<br />
Bürger-Ängste ernst nehmen –<br />
Erweiterungs-Chancen nutzen<br />
Der europäische Integrationsprozess<br />
wird nur gelingen, wenn die Europäische<br />
Union von unten, von den Bürgerinnen<br />
und Bürgern und damit von den<br />
Kommunen her konsequent weiter entwickelt<br />
wird. „Ohne die Kommunen ist<br />
im wahrsten Sinne des Wortes<br />
in Europa kein Staat zu<br />
machen“, erklärte Ende Mai in<br />
Celle Christian Schramm, Präsident<br />
des Deutschen Städteund<br />
Gemeindebundes (DStGb)<br />
und Oberbürgermeister der<br />
Stadt Bauzen.<br />
Das werde aber nur gelingen,<br />
wenn die Ängste der Bürger<br />
vor einer Superbürokratie in Brüssel<br />
ernst genommen werden. Und wenn in<br />
der zukünftigen europäischen Verfassung<br />
des Erfolgsmodell der kommunalen<br />
Selbstverwaltung dauerhaft verankert<br />
wird. „Die Menschen in den Städten und<br />
Gemeinden wollen ihre Angelegenheiten<br />
soweit wie möglich selbst regeln und<br />
deswegen brauchen wir eine konse-<br />
Steuerschätzung: Keine Entlastung der Kommunen in Sicht!<br />
Investitionen und Schuldenausbau<br />
wichtiger als Steuersenkungen<br />
Nach den Ergebnissen der deutschen Steuerschätzung<br />
(Stand Ende Mai) wird das<br />
Steueraufkommen der Städte und<br />
Gemeinden in Deutschland 2004 gegenüber<br />
den letzten Schätzungen aus Mai 2003<br />
leicht ansteigen. Aber: „Die Finanzsituation<br />
bleibt weiterhin dramatisch“, wie Dr.<br />
Gerd Landsberg, geschäftsführendes Präsidialmitglied<br />
des DStGb., dazu in Berlin<br />
sagte. Ein sofortiges Handeln der Gesetzgebers<br />
sei nötig. Die Steuereinnahmen der<br />
Städte und Gemeinden lägen noch immer<br />
um über drei Milliarden Euro unter denen<br />
des Jahres 2000.<br />
„Und auch die Zuweisungen brechen<br />
weiter weg“, so Landsberg. Die Gemeinden<br />
erhielten 2004 um gut 2,5 Milliarden<br />
Euro weniger Geld von Bund und<br />
Ländern als 2000. Und diese Entwicklung<br />
werde sich wegen der zu erwartenden<br />
Steuerausfälle weiter zuspitzen. Dies<br />
führe zwangsläufig zu weiteren Kürzungen<br />
bei kommunalen Investitionen in<br />
Straßen, Schulen, Sportanlagen und zu<br />
Einschnitten bei freiwilligen Leistungen<br />
wie Büchereien, Beratungs- und Betreuungsleistungen<br />
oder der Vereinsförderung.<br />
So hätten allein die die kommuna-<br />
Christian Schramm<br />
quente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips<br />
in Europa. Eine Superbürokratie,<br />
die von Brüssel aus die Vorgaben bis<br />
ins kleinste Dorf formuliert, will niemand<br />
und würde nur dazu führen, dass<br />
die Menschen sich aus dem europäischenEinigungsprozess<br />
verabschieden<br />
und ein bürgernahes<br />
Europa politischer<br />
Wunschtraum<br />
bleibt“, so<br />
Schramm.<br />
Und gleichzeitig<br />
müsse man den<br />
Menschen die<br />
immer noch vorhandenen Ängste vor<br />
den Folgen der EU-Erweiterung nehmen.<br />
Man müsse ihnen klarmachen, welche<br />
enormen – auch wirtschaftlichen – Chancen<br />
die Erweiterung mit sich bringt. Und<br />
Befürchtungen von gewaltigen Wanderungsbewegungen<br />
aus den neuen EU-<br />
Ländern „seien nach unseren Einschätzungen<br />
nicht gerechtfertigt.“<br />
len Bauinvestitionen 2003 um gut ein<br />
Drittel (etwa zehn Milliarden Euro)<br />
unter denen des Jahres 1992 gelegen.<br />
Naturkatastrophen<br />
Netzwerk von<br />
Bürgermeistern<br />
Auf dem Kongress der Gemeinden<br />
und Regionen beim Europarat<br />
konnte in Erfahrung gebracht<br />
werden, dass sich ein Netzwerk<br />
von Bürgermeistern, die in ihrer<br />
Gemeinde von Katastrophen<br />
heimgesucht worden sind, bilden<br />
soll. Die Bürgermeister von Wels,<br />
Lassing, Galtür und Kaprun<br />
haben sich bereits diesem Netzwerk<br />
angeschlossen.<br />
Bürgermeister, die Interesse an<br />
einer Mitwirkung an diesem<br />
Netzwerk haben, werden ersucht,<br />
dies bis spätestens 5. August dem<br />
Österreichischen Gemeindebund<br />
bekannt zu geben.
Gespräch unter Freunden - Österreicher beim Europarat in Strassburg. Der abtretende Präsident<br />
des KGRE, LH Dr. van Staa und die beiden Vertreter im ständischen Ausschuss, Mag.<br />
Freibauer und Prof. Zimper im Gespräch mit Generalsekretär Dr. Walter Schwimmer.<br />
Italiener Di Stasi als Nachfolger von van Staa gewählt<br />
Europarat: Neue Weichen<br />
Routinemäßige Wachablöse beim „Kongress<br />
der Gemeinden und Regionen im<br />
Europarat“ (KGRE) in Strassburg: bei<br />
der Sessionssitzung Ende Mai wurde<br />
der 54jährige Giovanni Di Stasi aus<br />
Casacalenda als Nachfolger des Tiroler<br />
Landeshauptmannes DDr. Herwig van<br />
Staa zum neuen Präsidenten des KGRE<br />
gewählt.<br />
Österreich wird künftig im Ständigen<br />
Im Dezember des Vorjahres präsentierte<br />
die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag<br />
zur Endenergieeffizienz und zu<br />
Energiedienstleistungen, welcher die<br />
Umsetzung der Vorgaben des Kyoto-Protokolls<br />
unterstützen soll.<br />
Durch die Entwicklung und Förderung<br />
eines Marktes für Energiedienstleistungen<br />
soll Energieeffizienz zu<br />
einem integralen Bestandteil<br />
des Energiebinnenmarktes<br />
werden. Verpflichtende Energieeinsparungsziele<br />
für alle<br />
Mitgliedstaaten sowie eine<br />
staatliche Versorgungsgarantie<br />
für Energiedienstleistungen<br />
sollen nach dem Willen<br />
der Kommission zur Umsetzung<br />
der Richtlinie beitragen.<br />
Grundsätzlich ist dieser<br />
Ansatz mehr als begrüßenswert.<br />
Durch die von der Kommission<br />
vorgeschlagenen Zwangsmaßnahmen<br />
könnte jedoch ein gegenteiliger Effekt<br />
eintreten. Der Ausschuss der Regionen<br />
Ausschuss des Kongresses durch den<br />
NÖ Landtagspräsidenten Mag. Ewald<br />
Freibauer und dem Vizepräsidenten<br />
des Gemeindebundes, Prof. Walter<br />
Zimper, vertreten sein.<br />
An der Jahrestagung in der französischen<br />
Grenzstadt nahmen außerdem<br />
LH-Stv. Dr. Haider aus OÖ und die<br />
Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde<br />
Zach teil.<br />
Umweltfreundliche Initiativen der EU-Kommission<br />
Richtlinie zur Energieeffizienz<br />
<strong>Kommunal</strong>e<br />
Bewusstseinsbildung<br />
sorgt auch<br />
hier für verstärktes<br />
Interesse bei<br />
den Endnutzern.<br />
sprach sich daher in seiner letzten Plenarsitzung<br />
für eine grundlegende Überarbeitung<br />
des Richtlinienvorschlags aus.<br />
Insbesondere sollte nicht mit Zwängen<br />
und marktfremden Maßnahmen operiert<br />
werden, Verbraucher und Konsumenten<br />
sollten vielmehr durch Beratung und<br />
gezielte Fördermaßnahmen zu einer verstärkten<br />
Nachfrage nach<br />
erneuerbaren Energien<br />
und effizienteren Ener-<br />
gieformen angeregt werden.<br />
Die Vorreiterrolle<br />
der regionalen und lokalenGebietskörperschaften<br />
bei Energiesparmaßnahmen<br />
darf in diesem<br />
Zusammenhang nicht<br />
vergessen werden. Viele<br />
Kommunen verpflichten<br />
sich beispielsweise freiwillig<br />
zur Umsetzung der Einsparungsziele<br />
von Kyoto, kommunale Bewusstseinsbildung<br />
sorgt auch hier für verstärktes<br />
Interesse bei den Endnutzern.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Förderung<br />
Europa<br />
In einer neuen Mitteilung mit dem Titel<br />
„Der Anteil erneuerbarer Energien in der<br />
EU“ bewertet die EU-Kommission die<br />
Fortschritte der EU-15 im Hinblick auf<br />
das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien<br />
am Elektrizitätsverbrauch bis 2010<br />
auf 22 Prozent zu erhöhen sowie den<br />
Anteil erneuerbarer Energien insgesamt<br />
auf 12 Prozent zu erhöhen.<br />
Bis zum Jahr 2001 betrug der Anteil<br />
erneuerbarer Energien in der gesamten<br />
EU sechs Prozent, womit<br />
diese weit hinter Öl (40<br />
Prozent), Erdgas (23),<br />
festen Brennstoffen (15)<br />
und Kernkraft (16 Prozent)<br />
liegt. Das Potential<br />
ist, wie jüngste Studien<br />
zeigen, um ein vielfaches<br />
höher.<br />
Vorreiter beim Einsatz<br />
erneuerbarer Energiequellen<br />
sind Deutschland,<br />
Dänemark, Spanien und<br />
Finnland, Österreich<br />
befindet sich unter jenen<br />
Ländern, die durch Steuerbefreiungen<br />
für Biokraftstoffe<br />
einen Beitrag<br />
im Rahmen des Verkehrssektors<br />
leisten.<br />
Um den Gesamteinsatz<br />
von erneuerbaren Energiequellen zu steigern,<br />
müssen mehrere Faktoren gleichermaßen<br />
berücksichtigt werden: Stromproduktion,<br />
Verkehr, Heizung und Energieeffizienzmaßnahmen<br />
sind in diesem<br />
Zusammenhang von besonderer Bedeutung.<br />
Mehrere einschlägige Richtlinien,<br />
wie zum Beispiel die Richtlinie zur<br />
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,<br />
jene zur Förderung von Biokraftstoffen<br />
und die RL zur Förderung der Kraft-<br />
Wärme-Kopplung, wurden bereits verabschiedet,<br />
doch selbst bei Umsetzung all<br />
dieser Rechtsvorschriften ist das Ziel von<br />
12 Prozent nicht zu erreichen.<br />
Zusätzliche Maßnahmen sind also nötig.<br />
Um die Attraktivität erneuerbarer Energiequellen<br />
zu erhöhen, spricht sich die<br />
Kommission daher für deren Förderung<br />
durch den Struktur- und Kohäsionsfonds<br />
aus. Auch die internationalen Programme<br />
zur Zusammenarbeit sollen<br />
erneuerbare Energiequellen berücksichtigen<br />
und den Aufbau ebensolcher Anlagen<br />
fördern.<br />
http://europa.eu.int/comm/energy/<br />
res/legislation/doc/country_profiles/<br />
com_2004_366_de.pdf<br />
KOMMUNAL 33
Erweiterung<br />
Der Schlägler Maibaum stand exakt auf<br />
der Grenze: Bgm. Hans Peter (Aigen),<br />
Willi Patri, Bgm. Josef Moser (Schlägl),<br />
Bgm. Paul Mathe (St. Oswald), Bgm. Jan<br />
Voldrich (Cerna), Altbgm. Böck (Lichtenau)<br />
feierten den historischen Tag.<br />
Begegnungsfeste des 1. Mai 2004<br />
Maibaum, Grenz-Radler<br />
und Friedenstauben<br />
Der Platz war uns ausgegangen in der Mai-<strong>Ausgabe</strong> von KOMMUNAL. Beim besten<br />
Willen konnten wir nicht alle Gemeindefeiern vorstellen. Deswegen präsentieren wir<br />
in dieser <strong>Ausgabe</strong> nochmal einige der Veranstaltungen im Zeichen des 1. Mai.<br />
Das Begegnungsfest am Grenzübergang<br />
Diendorf/Kyselov (Gemeinde Schlägl)<br />
wurde ein voller Erfolg. Mehr als 1000<br />
Besucher waren beim Maibaumaufstellen<br />
dabei. Erstmals in der Geschichte der<br />
Nachbargemeinden Cerna (CS) und<br />
Schlägl (Ö) wurde an der Grenze zwischen<br />
den Gemeinden anlässlich des EU<br />
Beitrittes ein Maibaum gesetzt. Aufgestellt<br />
wurde er von den Feuerwehren aus Cerna<br />
und aus Schlägl. Die Bürgermeister der<br />
Nachbargemeinden Aigen Bgm. Hans<br />
Peter, St. Oswald Bgm. Paul Mathe, Lichtenau<br />
Bgm. Albrecht Neidhart und Cerna<br />
Bgm. Jan Voldrich, sowie Bgm. Ing. Josef<br />
Moser halfen tatkräftig mit. Musikalisch<br />
wurde das Fest von der Musikkapelle<br />
Aigen-Schlägl und einer Band aus Cerna<br />
umrahmt, zu späterer Stunde spielten sie<br />
gemeinsam. Das Bier für alle Gäste kam<br />
aus Budweis (Budweiser Bier), Limonaden<br />
kamen aus Schlägl, (Stiftsbrauerei<br />
Schlägl), Bratwürstel wurden in Aigen<br />
erzeugt, Semmel und Gebäck kamen aus<br />
Südböhmen. Kaffee und Mehlspeisen<br />
kamen aus Schlägl sowie von Frauen aus<br />
Südböhmen.<br />
Die Grenz-Radler aus<br />
Bruck an der Leitha<br />
Prominente Gäste trafen sich in Bruck an<br />
der Leitha, um den 1. Mai als Grenz-Radler<br />
zu feiern: LAbg. Friedrich Hensler,<br />
Brucks Bgm. Franz Perger und sein Vize<br />
Felix Böhm und BH Dr. Martin Steinhau-<br />
34 KOMMUNAL<br />
Auf der Fähre: Gendarmerie_Hauptmann<br />
Leopold Holzbauer, GIZ GF Ursula<br />
Gerstbauer, LAbg. Hensler, BH Dr. Steinhauser,<br />
Bgm. Perger.<br />
ser, um nur ein paar zu nennen. Über den<br />
Alten Hainburgerweg (Römerweg) ging<br />
es von Bruck zum Heidentor in Petronell,<br />
wo eine Labstation vorbereitet war.<br />
Anschließend ging’s zur Donaufähre in<br />
Hainburg, die die Radfahrer ins slowakische<br />
Devin übersetzte, wo bereits eine<br />
Delegation aus Stupava die fleißigen Radler<br />
erwartete. In Stupava war ein überaus<br />
freundlicher Empfang vorbereitet.<br />
Schweigen für den Frieden<br />
und Friedenstauben<br />
Sankt Martin an der Raab (Bgld.) feierte<br />
den 1. Mai gemeinsam mit den Gemeinden<br />
Kuzma (SLO) und Oberzeming (H)<br />
am Dreiländereck. Um 0 Uhr Samstag, 1.<br />
Mai überreichte St. Martins Bürgermeister<br />
Franz Kern EU-Fahnen an die Bürger-<br />
meister von Kuzma und Oberzeming.<br />
Danach wurden diese EU-Fahnen zu den<br />
Klängen der Europa-Hymne gehisst. Der<br />
eigentliche Festtag direkt am Grenzstein<br />
begann dann mit einem Wortgottesdienst<br />
in den drei Sprachen dieses Dreiländer-<br />
Der dreiseitige<br />
Pyramidenstumpf<br />
markiert die – ehemalige<br />
– Grenze<br />
(oben). Franz Kern<br />
begrüßt seine<br />
Amtskollegen in<br />
der EU.<br />
ecks. Gegen Mittag<br />
hielten die Besucher eine Schweigeminute<br />
für den Frieden mit anschließender<br />
Freilassung von Friedenstauben. Das<br />
Fest klang mit einer Reihe musikalischer<br />
Darbietungen erst gegen Abend stimmungsvoll<br />
aus.<br />
Alles über die Feiern zum 1. Mai 2004 ist<br />
auf der Homepage www.euro-info.net/<br />
Gemeinde-Plattform zu finden.
Die Weiterführung eines erfolgreichen Weges<br />
Das Zentrale<br />
Melderegister II<br />
Mit der Anpassung des ZMR wird ein<br />
erfolgreicher Weg weiter beschritten,<br />
denn es gilt, neue technische Anforderungen<br />
und verbesserte organisatorische Rahmenbedingungen<br />
umzusetzen und<br />
zugleich die Anwenderfreundlichkeit zu<br />
erhöhen.<br />
Das BM.I musste den technischen Aufbau<br />
des ZMR restrukturieren, damit es alle<br />
Anforderungen als zentrales Service-Werkzeug<br />
für die E-Government-Dienste erfüllt<br />
- wie es z.B. die Umsetzung der Projekte<br />
Bürgerkarte und Dokumentenregister vorgeben<br />
und damit auch die Vorgaben des<br />
E-Government-Gesetzes eingehalten werden.<br />
Die meisten Änderungen dazu laufen<br />
im Hintergrund ab und sind<br />
für den Benutzer nicht<br />
wahrnehmbar.<br />
Der technische Umbau<br />
ermöglicht künftig ein<br />
rascheres Eingehen auf die<br />
Bedürfnisse der ZMR-Nutzer:<br />
Das System wird flexibler<br />
und Änderungen können<br />
leichter vorgenommen<br />
werden. Zur Verbesserung<br />
des Bedienungskomforts<br />
galt es, die Benutzeroberfläche zu vereinfachen<br />
– wobei eine neuerliche Schulung<br />
der Benutzer nicht nötig sein wird. Insgesamt<br />
bilden die neue Oberfläche und die<br />
flexiblere Applikation damit Arbeitserleichterungen<br />
und ein Einsparungspotenzial<br />
bei Österreichs Kommunen.<br />
Auch die Qualität der Daten konnte<br />
gesteigert werden. Das ZMR ist künftig an<br />
das Gebäude- und Wohnungsregister<br />
angebunden und es können nachträgliche<br />
Änderungen gegenüber dem derzeitgen<br />
System wesentlich einfacher vorgenommen<br />
werden.<br />
Das ZMR wird zusammen mit der Bürgerkarte<br />
künftig dem Bürger ermöglichen,<br />
selbst seine Bürgerkartenabfragen<br />
(gem. § 18, Abs. 1a<br />
MeldeG) durchführen zu können.<br />
Auf längere Sicht gese-<br />
hen wird auch ins Auge<br />
gefasst, Ummeldungen mittels<br />
Bürgerkarte zu ermöglichen.<br />
Damit wird nicht nur eine Entlastung<br />
für die Gemeinden<br />
bzw. Städte erreicht, sondern<br />
es entfallen auch Amtswege<br />
der Bürger.<br />
Verwaltung<br />
Das Zentrale Melderegister (ZMR) ist ein wesentliches Grundelement im Rahmen des<br />
E-Government-Vorhabens der Bundesregierung.<br />
ZMR II: Das<br />
System wird<br />
flexibler und<br />
Änderungen<br />
können leichter<br />
vorgenommen<br />
werden.<br />
Für Gemeinden, die nicht direkt auf das<br />
ZMR zugreifen, sondern ein eigenes örtliches<br />
Melderegister (OMR) führen, ist eine<br />
Investition für die Anpassung der Schnittstellen<br />
notwendig. Diese <strong>Ausgabe</strong> wird<br />
sich aber rasch bezahlt machen.<br />
Erweiterungen, die durch neue Rechtsmaterien<br />
notwendig sind (z.B. durch das<br />
Dokumentenregister, das ab Jänner 2005<br />
zu führen ist), werden nur mehr in den<br />
neuen Schnittstellen umgesetzt. Um den<br />
Gemeinden, die das Direkt-Service des<br />
ZMR nicht beanspruchen, Zeit für den<br />
Umstieg zu geben, werden die alten<br />
Schnittstellen noch bis zu sechs Monate<br />
nach Inbetriebnahme des Zentralen Melderegisters<br />
II (im Oktober 2004) weiter in<br />
Betrieb bleiben.<br />
Information<br />
Insgesamt bilden die<br />
neue Oberfläche und<br />
die flexiblere ApplikationArbeitserleichterungen<br />
und ein Einsparungspotenzial<br />
bei<br />
Österreichs Kommunen.<br />
Bundesministerium für Inneres, Abt. I/5<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdienst- und<br />
Auskunftsstelle, Herrengasse 7, A-1014<br />
Wien, Telefon +43-(0)1-531 26 - 3100<br />
infomaster@bmi.gv.at<br />
KOMMUNAL 35
Ortszentren<br />
Gegen die Verödung der Innenstädte fordert der Handel:<br />
Widmungsstopp für<br />
Einkaufszentren<br />
Die derzeitige Raumordnungs-Rechtslage ist in Sachen „Verkaufsflächen“ mangelhaft.<br />
Daher fordern die Händler einen Widmungsstopp für Einkaufszentren und Fachmärkte<br />
an der Peripherie um der Verödung der Ortszentren Einhalt zu gebieten.<br />
15,2 Mio. m 2 Verkaufsfläche<br />
im österreichischen<br />
Handel, also fast<br />
zwei m 2 pro Einwohner,<br />
sind genug. Der „Umsatzkuchen“<br />
ist nicht beliebig<br />
vermehrbar und dem<br />
Geschäftesterben in den<br />
Ortszentren müssen endlich<br />
Gegenmaßnahmen<br />
folgen. Die Genehmigung<br />
zum Bau von Einkaufszentren<br />
unterliegt der<br />
Raumordnung, ist also<br />
Länder- und Gemeindensache<br />
und damit nicht<br />
einheitlich und auch<br />
nicht nachhaltig steuerbar.<br />
Zukünftig soll verhindert<br />
werden, dass sich Gemeinden – in<br />
der Hoffnung auf Mehreinnahmen<br />
durch die Genehmigung von Einkaufszentren<br />
– konkurrenzieren und sich<br />
einen ruinösen Standort-Wettbewerb liefern.<br />
Nachbargemeinden soll bei Genehmigungsverfahren<br />
für neue Shoppingcenter<br />
Parteienstellung eingeräumt werden.<br />
Verödung der<br />
Innenstädte<br />
In dieselbe Kerbe wie die Händlervertretung<br />
schlagen auch renommierte Fachleute,<br />
so z.B. Univ. Prof. Dr. Joachim<br />
Zentes von der Universität des Saarlandes<br />
in Saarbrücken, ein anerkannter<br />
Experte für Handelsforschung und -entwicklung.<br />
Verkaufsflächenexplosion und<br />
Handelskonzentration habe massive<br />
Auswirkungen auf die mittelständischen<br />
Handelsstrukturen der Innenstädte.<br />
Durch die Ansiedlung großer Verkaufsflächen<br />
am Stadtrand komme es zu<br />
36 KOMMUNAL<br />
Dr. Fritz Aichinger, Landtagsabgeordneter<br />
und<br />
Sportartikelhändler in Wien.<br />
einer Verödung und Erosion<br />
traditioneller Standorte<br />
in der Innenstadt<br />
sowie zu einer Verdrängung<br />
des mittelständischen<br />
Handels, was letztendlich<br />
in einer Uniformität<br />
des Stadtbildes<br />
resultiere. Als Ausweg aus<br />
dieser einseitigen Entwicklung<br />
schlagen die Experten<br />
die Einbindung des<br />
Handels in die Ziele der<br />
Stadtentwicklung (sowohl<br />
städtebaulich und sozialpolitisch<br />
als auch arbeitsmarkt-<br />
und verkehrspolitisch)<br />
und eine Belebung<br />
von Stadtteilkernen als<br />
Nahversorgungs- und Kommunikationszentren<br />
vor.<br />
Lebt der Handel, dann<br />
lebt auch die Stadt<br />
Für die innerstädtischen Händler ist es<br />
viel vernünftiger und wirtschaftlich nachhaltiger,<br />
wenn in die Attraktivierung der<br />
Innenstädte und Einkaufstraßen investiert<br />
würde, anstatt Milliarden in Einkaufszentren<br />
auf der grünen Wiese zu<br />
verpulvern. Es geht primär um unser aller<br />
Lebensqualität in den Städten. Denn ist<br />
der innerstädtische Handel erst kaputt<br />
gemacht, kann er nur mit enormem Aufwand<br />
wieder belebt werden Ein Schaden,<br />
der Städte und Ortskerne sehr hart träfe!<br />
Vorbild Wien<br />
Wie ein Engagement für Handelsstrukturen<br />
in Städten funktionieren könnte, hat<br />
man in den letzten Jahren in Wien<br />
gezeigt. Hier gibt es das weltweit wohl<br />
am besten funktionierende und in seiner<br />
Art einzigartige Modell eines Managements<br />
für Einkaufsstraßen. Die „Wiener<br />
Einkaufsstraßen“ wurden 1992 von der<br />
Wirtschaftskammer ins Leben gerufen<br />
und bilden mit den bisher gegründeten<br />
rund 100 Einkaufsstraßen- und Grätzlvereinen<br />
und ihren 8.200 Mitgliedern<br />
den Kern der Aktivitäten rund um die<br />
Themenbereiche „Nahversorgung“ und<br />
„Erhaltung der innerstädtischen Kaufkraft“.<br />
Seit Beginn der Aktion wurden<br />
insgesamt 75 Mio. Euro in den Bereich<br />
Qualitätssicherung, Vermarktung und<br />
Lobbying investiert und dies nicht nur<br />
von der Wirtschaftskammer und der<br />
Stadt Wien, sondern vor allem von den<br />
Betrieben in den Einkaufsstraßen selbst.<br />
Der Erfolg gibt dem Wiener Projekt<br />
recht: Studien zeigen, dass trotz<br />
erschwerter Rahmenbedingungen der<br />
Marktanteil der Wiener Einkaufsstraßen,<br />
gemessen an den <strong>Ausgabe</strong>n<br />
der Bewohner, gehalten werden<br />
konnte. Nur: der Umsatzkuchen ist<br />
nicht beliebig vermehrbar. Ohne strukturpolitische<br />
Maßnahmen der<br />
Raumordnung können diese Aktivitäten<br />
nicht ihre volle Wirkung langfristig<br />
entfalten! Für Wien hat der Handel<br />
daher einen Widmungsstopp für Einkaufzentren<br />
an der Peripherie gefordert,<br />
zumindest bis zur Erstellung des<br />
neuen Stadtentwicklungsplanes.<br />
Informationen:<br />
Wirtschaftskammer Wien<br />
Sparte Handel<br />
Schwarzenbergplatz 14<br />
1041 Wien<br />
Tel.: 01/ 514 50 - 3241<br />
Fax: 01/ 514 50 - 3454<br />
E.E.
eco : facility – Neues Programm zur Gebäudesanierung<br />
Klimaschutz als<br />
Wirtschaftsmotor<br />
Ziel des Programms ist es, die Gebäudequalität<br />
im Dienstleistungssektor zu verbessern<br />
und die Betriebskosten in diesen<br />
Gebäuden nachhaltig zu senken: Potenzialabschätzungen<br />
zeigen aber auch<br />
deutlich, dass eco:facility einen äußerst<br />
wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz<br />
leisten kann. Das Management des Programms<br />
hat die Energieverwertungsagentur<br />
(E.V.A.) übernommen. Bei der<br />
eco:facility Auftakt-Veranstaltung, die im<br />
Februar in Wien stattfand, wurden nun<br />
Gebäudeeigentümer erstmals detailliert<br />
über die Möglichkeiten und Vorteile der<br />
thermisch-energetischen Sanierung ihrer<br />
Gebäude informiert.<br />
Untersuchungen und<br />
Analysen<br />
Eine Vielzahl von Untersuchungen<br />
zeigt, dass die Betriebskosten eines<br />
Gebäudes während des gesamten<br />
Lebenszyklus die Errichtungs- und<br />
Sanierungskosten meist bei weitem<br />
übersteigen. Der Anteil der Energiekosten<br />
an den Betriebskosten<br />
beträgt dabei üblicherweise<br />
zwischen 40<br />
und 60 %. Die Analysen<br />
belegen auch,<br />
dass in Dienstleistungsgebäuden,<br />
wie Bürogebäuden,Geschäftsobjekten,<br />
Schulen,<br />
Krankenhäusern<br />
u.ä., beträchtliche<br />
rentable<br />
Energieeinsparpoten-<br />
ziale vorhanden sind: Kosteneinsparungen<br />
von 15 bis 20 % bei einer durchschnittlichen<br />
Amortisationszeit von<br />
3 bis 7 Jahren sind durchaus die Regel.<br />
Obwohl ein großer Teil der Dienstleistungsgebäude<br />
bzw. der energietechnischen<br />
Anlagen in diesen Gebäuden<br />
ohnehin sanierungsbedürftig ist, werden<br />
die Verbesserungsmöglichkeiten in der<br />
Praxis nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft:<br />
Häufig überwiegen andere<br />
Investitionsprioritäten und die knappen<br />
Budgets werden entsprechend gelenkt.<br />
In vielen Fällen mangelt es auch an<br />
internen Kapazitäten und dem Knowhow,<br />
die Einsparpotentiale zu analysieren<br />
und umzusetzen. Und nicht selten<br />
möchte der Gebäudeeigentümer das<br />
Investitionsrisiko nicht selbst tragen.<br />
Hier setzt das neue eco:facility Programm<br />
an: Um private Gebäudeeigentümer<br />
davon zu überzeugen, dass<br />
die thermisch-energetisch Optimierung<br />
ihrer Dienstleistungsgebäude Sinn<br />
macht, werden im Rahmen von<br />
eco:facility folgende Umsetzungsmodelle<br />
verbreitet:<br />
◆ Bessere Planungen bei konventionellen<br />
Sanierungen<br />
◆ Einspar-Contracting<br />
◆ Garantiemodelle bei Generalsanierungen<br />
Überzeugende<br />
Argumente<br />
Dass das eco:facility-Konzept<br />
blendend funktioniert, beweisen<br />
einige äußerst erfolgreiche Best<br />
Practice Projekte: So konnte etwa<br />
das Modegroßhandelscenter (MGC)<br />
Wien durch eine über Contracting<br />
durchgeführte umfassende Sanierung<br />
seine jährlichen Energiekosten um<br />
90.986 Euro reduzieren. Die Investiti-<br />
Lebensministerium<br />
Das neue Programm eco:facility, eine Initiative des Lebensministeriums im Rahmen der<br />
österreichischen Klimastrategie, propagiert und unterstützt die thermisch-energetische<br />
Modernisierung und Optimierung von privaten Dienstleistungsgebäuden.<br />
eco : facility –<br />
Das Programm für<br />
Gebäudeverantwortliche<br />
onskosten des Contractors, der eine<br />
Kostenreduktion von 90.120 Euro<br />
garantiert hatte, beliefen sich auf<br />
305.226 Euro. Die Vertragslaufzeit<br />
erstreckte sich über 6,5 Jahre. Da der<br />
Vertrag bereits ausgelaufen ist, kommen<br />
die Einsparungen mittlerweile voll dem<br />
Modegroßhandelscenter zugute.<br />
Einsparungspotential<br />
Bei einem Bürogebäude des Joanneum<br />
Research in Graz konnten durch eine<br />
umfassende Sanierung die Wärmekosten<br />
um 45 % - von 42.700 auf 23.600<br />
Euro - gesenkt werden. Gleichzeitig<br />
konnten die Stromkosten um 5 % reduziert<br />
werden. Bei den Wasser- und<br />
Abwasserkosten gab es Einsparungen<br />
von 56 %.<br />
Eine breitangelegte Gebäudeoptimierung<br />
nach dem eco:facility-Konzept<br />
kann allerdings nicht nur deutliche<br />
Betriebskostenreduktionen bringen,<br />
sondern auch beachtliche positive Auswirkungen<br />
auf Klimaschutz und<br />
Arbeitsmarkt haben, wie die folgende<br />
Potenzialabschätzung der E.V.A. belegt:<br />
Bis zum Ende der Kyoto-Verpflichtungsperiode<br />
könnten die CO 2 -Emissionen<br />
um rund 520.000 Tonnen/Jahr gesenkt<br />
und gleichzeitig rd. 2.500 Dauerarbeitsplätze<br />
geschaffen werden.<br />
Informationen:<br />
zum Programm eco:facility unter<br />
http://www.eva.ac.at/projekte/eco<br />
_facility.htm<br />
Rückfragehinweis:<br />
Elisabeth Amann, Energieverwertungsagentur<br />
– The Austrian<br />
Energy Agency (E.V.A.),<br />
Otto-Bauer-G. 6, 1060 Wien, Tel.:<br />
01/586 15 24-36, 01/586 15 24-<br />
40, E-Mail: amann@eva.ac.at<br />
KOMMUNAL 37
BMLFUW-Gemeindeservice<br />
Internationale Konferenz zur Erneuerbaren Energie<br />
Energie für die Zukunft<br />
Die Bonner Konferenz zum Thema „Erneuerbare Energien“ war ein großer Erfolg.<br />
134 Staaten sowie internationale Organisationen und NGOs (insgesamt ca. 3600<br />
Delegierte) haben ein starkes Zeichen für die verstärkte Nutzung von erneuerbaren<br />
Energieträgern weltweit gesetzt, um so das Klima zu schützen und die weltweite<br />
Armut zu bekämpfen.<br />
Allein die Tatsache, dass über 80 Minister<br />
aus Industrie- und Entwicklungsländern<br />
(Umwelt, Energie, Infrastruktur,<br />
Entwicklung etc.) teilnahmen, zeigt das<br />
gestiegene internationale Interesse an<br />
der Nutzung erneuerbarer Energieträger.<br />
Für die österreichische Wirtschaft bieten<br />
sich durch eine weltweit vermehrte Nutzung<br />
von Erneuerbaren gute Exportchancen<br />
für heimische Technologien.<br />
Neben der politischen Erklärung und<br />
den Empfehlungen für Politikgestaltung<br />
ist das Internationale Aktionsprogramm<br />
das wichtigste Ergebnis der Konferenz.<br />
Internationales<br />
Aktionsprogramm<br />
Das Aktionsprogramm besteht aus freiwilligen<br />
aber konkreten Verpflichtungen<br />
zum Ausbau der erneuerbaren Energien<br />
durch diverse Akteure. Nach Berechnungen<br />
des Gastgeberlandes Deutschland<br />
wird sich durch die Umsetzung der<br />
freiwillig eingebrachten Aktionen im<br />
Jahr 2015 die zu erwartende CO2-Ein-<br />
38 KOMMUNAL<br />
sparung auf schätzungsweise 1,2 Mrd.<br />
Tonnen pro Jahr belaufen.<br />
Österreichs Beitrag<br />
Österreich hat folgende Aktivitäten für<br />
das internationale Aktionsprogramm<br />
eingebracht:<br />
◆ Programm klima:aktiv<br />
◆ Ausschreibungen für „Fabrik der<br />
Zukunft“, „Energiesysteme der<br />
Zukunft“ und „Haus der Zukunft“ des<br />
BMVIT<br />
◆ Aktivitäten der ÖEZA im Bereich der<br />
erneuerbaren Energieträger (inkl.<br />
Regionale Aktivitäten des Global Forum<br />
on Sustainable Energy)<br />
Insgesamt wurden ca. 165 freiwillige<br />
Aktionen und Verpflichtungen eingebracht.<br />
Einige Beispiele:<br />
◆ China plant die Steigerung des<br />
Anteils erneuerbarer Energien an der<br />
installierten Gesamtenergieleistung auf<br />
10 % bis 2010 (derzeit ca. 5-6 %).<br />
◆ GEF (Global Environment Facility -<br />
Umwelt-Finanzierungsfonds) hat zuge-<br />
e5-Programm für energiepolitisch engagierte Kommunen<br />
Unterstützungshilfe für Gemeinden<br />
Um die Energiepolitik der einzelnen<br />
Gemeinden messbar zu machen und zu<br />
würdigen, vergibt die e5-Kommision ein<br />
bis fünf „e“ an die Gemeinden. Der Programmträger<br />
strukturiert und begleitet die<br />
energiepolitische Gemeindearbeit, kontrolliert<br />
und würdigt die erbrachten Leistungen,<br />
vernetzt die Gemeinden und bietet<br />
ihnen Weiterbildungsprogramme an. In<br />
der Gemeinde wird ein e5-Team gebildet,<br />
das für die Umsetzung der Aktivitäten in<br />
der Gemeinde verantwortlich ist. Es folgt<br />
eine umfassende Erhebung des energiepolitischen<br />
Status quo. Auf Basis der Ist-Ana-<br />
lyse wird ein energiepolitisches Programm<br />
mit den Strategien und Zielsetzung der<br />
energiepolitischen Arbeit für die nächsten<br />
zwei bis drei Jahre erarbeitet. Der Stand<br />
der Umsetzung wird in den Folgejahren<br />
im Rahmen eines Workshops vom Team<br />
überprüft und darauf aufbauend das Aktivitätenprogramm<br />
festgelegt.<br />
Alle drei Jahre stellt sich die Gemeinde<br />
einer externen Zertifizierung, in der die<br />
Qualität der energiepolitischen Arbeit<br />
durch eine unabhängige Kommission<br />
beurteilt wird.<br />
Information: www.energieinstitut.at<br />
sagt jährlich 100 Mio. US-Dollar einzusetzen,<br />
um anspruchsvolle Erneuerbare-Energie-Projekte<br />
in Entwicklungsländern<br />
zu unterstützen.<br />
◆ Die Weltbankgruppe hat angekündigt,<br />
die Zusagen im Bereich erneuerbarer<br />
Energien und Energieeffizienz<br />
um jährlich 20 % in den nächsten 5<br />
Jahren zu erhöhen. Damit wird sich im<br />
Jahr 2010 die jährliche Unterstützung<br />
erneuerbarer Energien und Energieeffizienz<br />
auf 400 Mio. US-Dollar belaufen,<br />
was einer Verdoppelung der bisherigen<br />
Summe entspricht.<br />
Durch die politische Erklärung wurde<br />
sichergestellt, dass die Bonner Konferenz<br />
kein Schlusspunkt ist, sondern<br />
auch der politische Dialog weitergeht.<br />
Österreich wird eine aktive Rolle in der<br />
weiteren internationalen Behandlung<br />
des Themas und in der Verfolgung der<br />
Konferenzergebnisse einnehmen.<br />
Erneuerbare Energie:<br />
Hoher Anteil in Österreich<br />
Im Moment decken die erneuerbaren<br />
Energieträger nur einen Anteil von<br />
13,8 % des weltweiten Primärenergiebedarfs<br />
ab. In Österreich liegt dieser<br />
Prozentsatz schon seit Jahren über<br />
20 % und betrug im Jahr 2001 rund<br />
23 %. Damit hält Österreich im internationalen<br />
Vergleich nach Norwegen,<br />
Schweden und Finnland den vierthöchsten<br />
Anteil erneuerbarer Energien im<br />
Bruttoinlandsverbrauch.<br />
Dieser Anteil soll noch weiter gesteigert<br />
werden, wie Umweltminister Josef<br />
Pröll bereits vor seiner Abreise nach<br />
Bonn erklärt hatte. Er will den Prozentsatz<br />
der erneuerbaren Energien am<br />
Gesamtenergieverbrauch bis 2010 von<br />
23 auf 30 % steigern. Bei der Stromerzeugung<br />
soll der Anteil auf 78 % gehoben<br />
werden.<br />
Lebensministerium im Internet: http://www.lebensministerium.at
Junge Wege – sicher, gesund und umweltfreundlich<br />
Schülerinnen planen<br />
Mobilität für die Zukunft<br />
„Junge Wege – sicher,<br />
gesund und umweltfreundlich“<br />
– unter diesem Motto<br />
steht der europaweite<br />
Autofreie Tag 2004. Sicherheit<br />
und Umweltschutz<br />
beim täglichen Schulweg<br />
sind leider keine Selbstverständlichkeit,<br />
wie alarmierende<br />
Trends belegen.<br />
Immer mehr Kinder werden<br />
mit dem PKW zur<br />
Schule gebracht; Übergewicht<br />
und Bewegungsmangel<br />
nehmen zu. Jährlich<br />
sterben rund 6.500 Kinder unter 15 Jahren<br />
auf Europas Straßen. Mit dem europaweiten<br />
Autofreien Tag will das Lebensministerium<br />
verstärkt ins Bewusstsein<br />
rufen, dass Kinder und Jugendliche im<br />
Das Echo auf den Aufruf, am Fotowettbewerb<br />
teilzunehmen, war enorm. 1.638<br />
Waldfotos und 1.933 Zeichnungen von<br />
Baumhäusern bedeuteten für die Jury<br />
eine große Herausforderung. Besonders<br />
der Aufruf, ein<br />
Traum-Baumhaus zu<br />
zeichnen, hat Kinder<br />
von 5 bis 15 Jahren<br />
zu kreativen und<br />
anspruchsvollen Leistungen<br />
motiviert.<br />
Gewonnen hat ein 9jähriges<br />
Mädchen aus<br />
Salzburg, das die Jury<br />
mit ihrem Ideenreichtum<br />
beeindruckt hat.<br />
Das überwältigende<br />
Echo hat BM Pröll spontan dazu veranlasst,<br />
neben dem Hauptpreis – einem original<br />
gebauten Baumhaus – für die 10<br />
besten Zeichnungen Sachpreise zu stiften<br />
und zwei Sonderpreise an behinderte<br />
Kinder zu übergeben.<br />
Der Fotowettbewerb brachte als österreichweites<br />
Siegerbild ein stimmungsvolles<br />
Waldfoto hervor, das nach Meinung<br />
der Jury alle Waldleistungen zum Ausdruck<br />
bringt. Die Gewinnerin aus Wien<br />
darf sich über einen 5.000,- Euro Möbelgutschein,<br />
gesponsert von der Firma<br />
Grüne Erde freuen. Die Bundesland-Sie-<br />
Lebensminister Pröll zeichnet de Etappensieger 2003 der<br />
Aktion „grüne Meile“ aus.<br />
Woche des Waldes – Fotowettbewerb<br />
Enormes Echo<br />
Straßenverkehr die schwächsten Teilnehmer<br />
sind. Lebensminister Pröll appeliert<br />
daher an alle Gemeinden, am Autofreien<br />
Tag 2004, der am 22. September stattfindet,<br />
mitzuwirken.<br />
gerfotos spiegeln die gesamte Palette des<br />
Waldes wider - von Blättern, über den<br />
Holzstoß bis hin zur eindrucksvollen<br />
Wald Silouette ist alles vertreten. Jeder<br />
Bundeslandsieger darf eine Woche<br />
Die Siegerbilder des Wettbewerbes, der enormes Echo fand.<br />
Urlaub in einer originalen Waldhütte verbringen,<br />
zur Verfügung gestellt von der<br />
ÖBF AG, der MA 49 und dem HVLF.<br />
Die Preisübergabe fand im Rahmen<br />
eines beeindruckenden Events am 14.<br />
Juni abends im Naturhistorischen<br />
Museum statt. Lichtshow, Waldbäume<br />
und Großleinwandprojektion der vielen<br />
Waldbilder ließen echte Waldstimmung<br />
aufkommen. Die anwesenden Sieger<br />
und Einreicher genossen das Spektakel<br />
sichtlich. Mehr dazu im Internet unter<br />
http://lebenstraum.lebensministerium.at<br />
Lebensministerium im Internet: http://www.lebensministerium.at<br />
Klimabündnis koordiniert<br />
Autofreien Tag 2004<br />
Der europaweite<br />
Autofreie Tag 2004<br />
(am 22.9.) hat den<br />
Zweck, Lösungen für<br />
eine nachhaltige Verkehrsabwicklungauszuprobieren<br />
und diese<br />
dauerhaft zu realisieren.<br />
Durch das Erleben von autofreien<br />
Straßenräumen soll das Bewusstsein für<br />
Alternativen geweckt und Anregungen<br />
gegeben werden. Interessierte Gemeinden<br />
wenden sich bitte an:<br />
Klimabündnis Niederösterreich<br />
Tel.: 02742/ 26 967<br />
Klimabündnis Oberösterreich<br />
Tel.: 0732/ 772 652<br />
Klimabündnis Tirol<br />
Tel.: 0512/ 583 558<br />
Büro für Zukunftsfragen (Vorarlberg)<br />
Tel.: 05574/ 511 - 20 600<br />
Klimabündnis Kärnten<br />
Tel.: 04242/ 246 172<br />
Klimabündnis Salzburg<br />
Tel.: 0662/ 826 275<br />
Klimabündnis Steiermark<br />
Tel.: 0316/ 821 580<br />
Staatspreis für beispielhafte<br />
Waldwirtschaft<br />
Der Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft<br />
an heimische Waldbauern wurde<br />
1994 initiiert, um die Wald besitzenden<br />
Bauern einerseits dazu zu motivieren, die<br />
Ressource Wald aktiv und nachhaltig zu<br />
nutzen. Die erfolgreichsten bäuerlichen<br />
Waldbewirtschafter Österreichs werden ausgezeichnet,<br />
ihre Musterbeispiele für<br />
moderne, zukunftsorientierte Nutzung und<br />
Bewirtschaftung des Waldes vor den Vorhang<br />
gebeten. Die Staatspreisträger des Jahres<br />
2004 sind: Paul Imp aus dem Burgenland,<br />
Peter Ebenberger aus Kärnten, Franz<br />
Zöchling aus Niederösterreich, Inge Breitenberger<br />
aus Oberösterreich, Erwin Korbuly<br />
aus Salzburg, die Gutsverwaltung Brunnsee<br />
aus der Steiermark, Wolfgang Enzenberg<br />
aus Tirol, Familie Ilg aus Vorarlberg, die<br />
Forstverwaltung Birkenstein aus der Steiermark<br />
als Vertreter der Großbetriebe und die<br />
Waldwirtschaftsgemeinschaft Steyr-Nord in<br />
der Sonderkategorie Kooperationen.<br />
Mehr Informationen über die ausgezeichneten<br />
Waldbauern inklusive Kurzbeschreibungen<br />
der Betriebe im Internet:<br />
www.lebensministerium.at/forst<br />
Ausführlich porträtiert werden die Preisträger<br />
2004 in einer Publikation die ebenfalls<br />
im Internet www.lebensministerium.at/<br />
publikationen zum <strong>Download</strong> zur Verfügung<br />
steht.<br />
KOMMUNAL 39
Regelmäßige Nachtschichtarbeit ist<br />
gesundheitsgefährdend. Schätzungen<br />
zufolge verkürzt sich die Lebenserwartung<br />
von NachtschichtarbeiterInnen um<br />
fünf Jahre gegenüber ihren KollegInnen<br />
mit Normalarbeitszeiten.<br />
Schicht-Rythmus entscheidet über Wohlbefinden<br />
Gesundes „Schichteln“<br />
SchichtarbeiterInnen sind in besonders hohem Maße gesundheitsschädlichen<br />
Belastungen ausgesetzt. Im Chemiebetrieb AMI Agrolinz Melamine International<br />
wurde nun eine umfassende Schichtplanreform durchgeführt – mit anhaltendem<br />
gesundheitlichen Erfolg, wie die Evaluierung zeigt.<br />
Dass regelmäßige Nachtschichtarbeit<br />
gesundheitsgefährdend ist, belegen heute<br />
zahlreiche Forschungsergebnisse. Deutschen<br />
Schätzungen zufolge verkürzt sich<br />
die Lebenserwartung von NachtschichtarbeiterInnen<br />
um fünf Jahre gegenüber<br />
ihren KollegInnen mit Normalarbeitszeiten.<br />
Sie haben deutlich mehr Schlafstörungen,<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,<br />
Magen-Darm-Erkrankungen und psychische<br />
Störungen. Die Gründe für das<br />
erhöhte Gesundheitsrisiko: Nachtarbeit<br />
»<br />
Freude und Lebensqualität<br />
war wichtiger<br />
als mehr Geld.<br />
Dr. Manfred Lindorfer «<br />
ist physiologisch verausgabender als<br />
Tagesarbeit, die Schlafqualität ist verschlechtert<br />
und die Schlafdauer reduziert.<br />
Das Familienleben wird belastet und die<br />
private Lebensqualität sinkt.<br />
Der Chemiebetrieb AMI Agrolinz Melamine<br />
International hat sich daher entschlossen,<br />
seinen Schichtbetrieb umzustellen.<br />
Seit 2001 arbeiten die ChemiearbeiterInnen<br />
auch in Fünfer-Schichten.<br />
Das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung<br />
hat die gesundheitlichen<br />
Effekte der Reform mit finanzieller Unterstützung<br />
des Fonds Gesundes Österreich<br />
evaluiert. Projektleiter und ärztlicher Leiter<br />
des arbeitsmedizinischen Zentrums<br />
Worklab Chemiepark Linz Dr. Manfred<br />
Lindorfer: „ArbeiterInnen der Fünfer-<br />
Schicht haben nur noch sechs statt acht<br />
Nachtdienste und dann drei bis vier Tage<br />
nach einem Schichtzyklus frei statt früher<br />
40 KOMMUNAL<br />
nur zwei Tage. Dadurch haben die<br />
SchichtarbeiterInnen mehr Zeit, ihren<br />
Schlaf und ihre Erholung auch wirklich<br />
zu genießen.“ Das drückt sich auch in<br />
Zahlen aus: Nach der Umstellung des<br />
Schichtplans erhöhte sich die Schlafdauer<br />
für den einzelnen Schichtarbeiter von 6,6<br />
Stunden auf fast 7 Stunden, ein Zuwachs<br />
von immerhin 124 Stunden mehr Schlaf<br />
im Jahr.<br />
Eindeutig weniger Belastungen. Die<br />
Evaluierung des Projekts nach einem Jahr<br />
zeigte neben der höheren Schlafqualität<br />
auch eine eindeutige Verbesserung bei<br />
allen anderen Gesundheitsparametern<br />
wie Stress oder Zufriedenheit mit Arbeit<br />
und Privatleben. Die körperliche Arbeitsbewältigung<br />
bewerteten die Befragten<br />
mit der Schulnote 1,9 ( 2,35 ein Jahr<br />
davor), die psychische Arbeitsbewältigung<br />
mit Note 2 (1 Jahr davor: 2,3). Signifikant<br />
reduziert haben sich auch die<br />
gesundheitlichen Belastungen, erhöht hat<br />
sich das Gefühl der Freude. Und nur noch<br />
1,7 Prozent der MitarbeiterInnen hatten<br />
den festen Vorsatz mit der Schichtarbeit<br />
aufzuhören. Ein Jahr davor waren das<br />
immerhin noch 7,4 Prozent. Gab vor der<br />
Schichtplanreform jeder Zehnte an, die<br />
Schichtarbeit verhindere sein Privatleben,<br />
war nach einem Jahr kein einziger mehr<br />
dieser Meinung. Arbeitsmediziner Dr. Lindorfer:<br />
„Der Schichtarbeiter kann durch<br />
die Reform zwei von fünf Wochenenden<br />
bei der Familie verbringen, was für’s<br />
soziale Leben enorm wichtig ist. Viele<br />
MitarbeiterInnen haben außerdem neue<br />
Hobbys angefangen und insgesamt wieder<br />
mehr Sinn im Leben gefunden.“<br />
Geld ist nicht alles. Da mit der Reform<br />
auch eine Verkürzung der Arbeitszeit verbunden<br />
war, mussten die Schichtarbeiter-<br />
Innen auch eine Lohnreduktion hinnehmen.<br />
Die hohe Zustimmung für die<br />
Schichtplanumstellung war daher beeindruckend.<br />
Vor der Einführung stimmten<br />
mehr als zwei Drittel für die Umstellung,<br />
nach einem Jahr waren bereits fast 90<br />
Prozent dafür. „Die MitarbeiterInnen<br />
haben nach einiger Zeit gesehen, dass<br />
Freude und Lebensqualität mehr wert<br />
sind als ein bisschen Geld“, berichtet Dr.<br />
Lindorfer. „Interessant war auch, dass die<br />
größere Zustimmung von den Jüngeren<br />
kam, obwohl die Älteren gesundheitlich<br />
mehr unter der Schichtarbeit leiden. Jüngere<br />
schätzen den Wert von Lebensqualität<br />
offenbar noch höher ein.“ Ältere<br />
stecken die permanente Belastung durch<br />
erhöhten Stress und zu geringe Erholungszeiten<br />
nicht mehr so gut weg. Sie<br />
sind den Anforderungen nur noch durch<br />
die Aktivierung von Stressmechanismen<br />
gewachsen. Insofern war die Schichtplanumstellung<br />
auch eine Anpassung an die<br />
Erfordernisse älterer ArbeitnehmerInnen.<br />
Information & Kontakt<br />
AMZ worklab Chemiepark Linz<br />
A - 4021 Linz, St. Peter Straße 25<br />
Tel: 0706914 3328<br />
m.lindorfer@worklab-linz.at<br />
www.worklab.at<br />
Kontakt<br />
Fonds Gesundes Österreich,<br />
Mariahilferstraße 176,<br />
A-1150 Wien, Tel. 01/8950400,<br />
Fax: 01/8950400-20,<br />
gesundes.oesterreich@fgoe.org
KOMMUNAL<br />
PRAXIS<br />
Bauphysik-Software: Bauteilrechner jetzt im Internet<br />
Berechnungen in kürzester Zeit<br />
Mit dem ArchiPHYSIKweb<br />
Bauteilrechner können bauphysikalische<br />
Berechnungen<br />
innerhalb kürzester Zeit<br />
online erstellt werden. Das<br />
einfach bedienbare Werkzeug<br />
ermöglicht die detaillierte<br />
Berechnung und Bestimmung<br />
beliebig vieler Bauteile wie<br />
Wände, Decken, Dächer,<br />
Böden.<br />
Neben Wärmeschutz werden<br />
Dampfdiffusion und Schallschutz<br />
im Web berechnet. Die<br />
Simulation des bauphysikalischen<br />
Verhaltens der Bauteile<br />
stellt eine optimale Serviceleistung<br />
für Anwender dar. Die<br />
Möglichkeit, Formulare im<br />
PDF-Format für Behördenkontakte<br />
ausdrucken zu können,<br />
bringt erhebliche Vorteile. Das<br />
ArchiPHYSIK Software-Produkt<br />
von A-NULL ist ein erstklassigesMarketinginstrument<br />
für Baustoffindustrie-<br />
Unternehmen, Baustoffhändler,<br />
private sowie öffentliche<br />
Institutionen und Behörden.<br />
Da ArchiPHYSIKweb auf einer<br />
offenen Technologie basiert,<br />
lässt sich die Webapplikation<br />
Für aqua plus Geschäftsführer Dr. Rainer Wiedemann ist der Einstieg<br />
bei WISAK eine Stärkung der Marktposition.<br />
Neuheit: System Guliver löst Geruchsprobleme<br />
Druckrohre, die nicht mehr stinken<br />
Um Geruchsentwicklungen in<br />
Druckrohrleitungen schon vor<br />
ihrem Entstehen zu beseitigen,<br />
bietet die Firma Hoelscher<br />
pneumatische Hebeanlagen<br />
zur Abwasserförderung,<br />
das so genannte System Gulliver.Die<br />
Geruchsproblematik in<br />
Druckleitungen entsteht<br />
dadurch, dass das Abwasser<br />
lange in der Leitung verweilt<br />
und dadurch anaerob wird.<br />
Genau dann kommt das<br />
System Gulliver zum Einsatz,<br />
das eine wirksame Alternative<br />
zu herkömmlichen Pumpwerken<br />
darstellt. Gulliver sorgt<br />
dafür, dass im Abwasser<br />
immer genügend Sauerstoff<br />
enthalten ist und ist weiters in<br />
der Lage, die Rohrleitung<br />
komplett zu entleeren. Bei der<br />
pneumatischen Förderung<br />
wird dem Abwasser bei jedem<br />
Pumpvorgang ein Sauerstoffgehalt<br />
von 5 - 7 mg/l dazugegeben.<br />
Somit bleibt das<br />
Abwasser in der Druckrohrleitung<br />
aerob.<br />
Infos bei RingConsult Innovative<br />
Umweltprodukte GmbH<br />
Rottwiese, Tel/Fax: +43 2612<br />
433311, www.ringconsult.at<br />
Der Förderprozess bei Gulliver<br />
erfolgt über eine speicherprogrammierbare<br />
Steuerung (SPS).<br />
Foto: aquaplus<br />
Foto: ringconsult<br />
sehr einfach in jeden Webauftritt<br />
integrieren. Die Anwender<br />
können via Internet zeitund<br />
ortsunabhängig auf den<br />
Bauteilrechner zugreifen und<br />
haben sofort die aktuellen<br />
technischen Daten der erforderlichen<br />
Produkte. Die Auswertung<br />
erfolgt also rund um<br />
die Uhr. Auf der A-NULL Website<br />
können Sie unter<br />
www.archiphysik.net mit<br />
dem ArchiPHYSIKweb Bauteilrechner<br />
kostenlos bauphysikalische<br />
Werte mit allgemeinen<br />
Baustoffen berechnen.<br />
Expansionskurs<br />
aquaplus baut aus<br />
Die aqua plus GmbH / Wien<br />
ist mit der erfolgreichen Übernahme<br />
von 50 %-Anteilen der<br />
Wiental- Sammelkanal GmbH<br />
(WISAK) weiter auf Expansionskurs.<br />
WISAK in Tullnerbach<br />
betreibt eine der<br />
modernsten Abwasserreinigungsanlagen<br />
in NÖ und entsorgt<br />
das Abwasser der<br />
Gemeinden Tullnerbach, Pressbaum,<br />
Wolfsgraben und teilweise<br />
Purkersdorf. Kontakt :<br />
aqua plus, Tel.: 01/6031012-<br />
3917, www.aquaplus.at<br />
Augsburger Messe<br />
Holzenergie in<br />
Kommunen<br />
Die Novellierung des EEG<br />
weckt Hoffnungen auf eine<br />
Erschließung der großen,<br />
ungenutzten Holzpotenziale<br />
im Strommarkt, die Überlegungen<br />
für ein Regeneratives<br />
Wärmegesetz schreiten<br />
weiter voran, deutsche Kommunen<br />
sind im Marktanreizprogramm<br />
jetzt antragsberechtigt,<br />
können also auch<br />
Fördergelder für Holzenergieanlagen<br />
bekommen.<br />
Detaillierte Infos unter<br />
www.holz-energie.de<br />
Kukmirns Dachdecker Werner<br />
Mayer setzt auf die innovativen<br />
Dacheindeckungen von Innoteg<br />
Tiefpreis-Aktion<br />
Innovaties Dach<br />
Österreichs innovativster Dachdeckungshersteller<br />
Innoteg, ein<br />
Tochterunternehmen von<br />
Umweltdienst Burgenland<br />
GmbH und Pinkafelder Elektrizitäts-Werke<br />
GmbH, verfügt<br />
seit Mitte Mai über die Zertifikate<br />
ISO 14001:1996 und ISO<br />
9001:2000. Diesen Anlass feiert<br />
das südburgenländische<br />
Unternehmen mit einer Tiefpreis-Aktion<br />
für die Produktlinien<br />
„Biber“ und „Wiener<br />
Tasche“. Die herausragendsten<br />
Merkmale von Innoteg-<br />
Dacheindeckungen sind<br />
sowohl ihre Leichtigkeit als<br />
auch die Modulbauweise, denn<br />
ein Modul trägt sechs „Einzelziegel".<br />
Allein deshalb ist Innoteg<br />
auch bei Dachsanierungen<br />
sehr gefragt.<br />
Infos bei Jörg Winkler unter<br />
03328/325 79-703 oder<br />
www.innoteg.at<br />
Foto: Innoteg
Wirtschafts-Info<br />
Kelag-Dienstleistungen bieten Full-Service<br />
Gewinn für Gemeinden<br />
Ein umfassendes Energiemanagement wird für kommunale Einrichtungen immer bedeutender.<br />
Zusätzlich zu Energielieferungen profitieren Gemeinden von Serviceleistungen und<br />
umfassender Betreuung der Kelag. Dabei stehen Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität<br />
im Vordergrund.<br />
Individuell auf die Bedürfnisse der<br />
Gemeinden abgestimmt, wird ein<br />
Energiekonzept erstellt. Angefangen<br />
von der Energieanalyse reicht das<br />
Angebot bis zum Einspar-Contracting.<br />
„Der Vorteil der Gemeinden liegt darin,<br />
dass mit Vorliegen der Energieanalyse<br />
auf spezielle Energiesituationen konkret<br />
eingegangen werden kann. Unsere<br />
Kunden schätzen unsere hohe fachliche<br />
Kompetenz und die individuelle Betreuung“,<br />
fasst Ing. DI (FH) Willibald Kohlweg,<br />
Leiter der Gruppe Kelag-Dienstleistungen,<br />
das Angebot zusammen.<br />
Keinerlei Risiko für<br />
Gemeinden<br />
Die Kelag betreut das gesamte Projekt<br />
von der Analyse, über die Ausschreibung<br />
bis hin zur Umsetzung begleitet.<br />
Jede Anlage wird genau analysiert.<br />
Dabei wird der Istzustand festgehalten,<br />
das mögliche Energie-Einsparpotential<br />
aufgelistet und die Kosten für die Realisierung<br />
dem Einsparpotential gegenüber<br />
gestellt. So weiß die Gemeinde<br />
genau, wie viel jede Maßnahme kosten<br />
und was die Umsetzung bringen wird.<br />
„Die Informationen über das Angebot<br />
der Kelag-Dienstleistungen haben wir<br />
beim Kärntner Gemeindebund bekommen.<br />
Das hat uns gleich interessiert,“<br />
berichtet Vizebürgermeister und Baureferent<br />
Walter Huber über den Entschluss,<br />
mit der Kelag gemeinsam<br />
einen EnergieMonitoring für die Stadtgemeinde<br />
Althofen durchzuführen.<br />
„Die Personalressourcen in Gemeinden<br />
sind knapp. Wir haben nicht die Fachleute<br />
für die unterschiedlichsten Bereiche,<br />
wie Energie- und Installationstechnik,<br />
Wärmedämmung oder Bauphysik.<br />
Der Vorteil für uns dabei ist, dass wir<br />
bei der Kelag alles aus einer Hand<br />
bekommen,“ ist Ing. Harald Alberer,<br />
Leiter des Bauamtes der Stadtgemeinde<br />
Althofen mit den Kelag-Dienstleistungen<br />
zufrieden.<br />
42 KOMMUNAL<br />
Bgm. Manfred Mitterdorfer (re) und Vbgm. Walter Huber setzen sich für Energieeffizienz<br />
in der Stadtgemeinde Althofen ein.<br />
Für die Stadtgemeinde Althofen brachte<br />
die Energieanalyse der Kelag mehrere<br />
Vorteile. Einerseits erhielten Bürgermeister<br />
Manfred Mitterdorfer und sein<br />
Team die Bestätigung, dass bei einigen<br />
Anlagen, wie z. B. bei der Volksschule,<br />
beim Kulturhaus und der Freizeitanlage,<br />
die Energie bereits sehr effizient eingesetzt<br />
wird. Andererseits ergab die Analyse,<br />
dass bei der Straßenbeleuchtung<br />
großer Handlungsbedarf gegeben ist.<br />
Jährlich werden 11.000,-<br />
Euro gespart<br />
Mit der neuen Straßenbeleuchtung<br />
ergeben sich gleich mehrere Vorteile<br />
für die Stadt Althofen. Jährlich werden<br />
rund 11.000,- Euro eingespart.<br />
Zusätzlich fallen für die neue<br />
Beleuchtungsanlage zukünftig auch<br />
geringere Kosten für Wartung und<br />
Instandhaltung an.<br />
Ca. ein Drittel der Investitionskosten<br />
wird aus der Einsparung finanziert.<br />
„Mit diesen Maßnahmen steigern wir<br />
weiter die Wirtschaftlichkeit in unserer<br />
Stadt und verschönern gleichzeitig das<br />
Ortsbild,“ ist Bürgermeister Mitterdorfer<br />
zufrieden mit dem Projekt.<br />
Verantwortlich fürs<br />
moderne Licht<br />
Davon ist Bürgermeister Mitterdorfer<br />
überzeugt: „Das liegt schon in unserer<br />
Geschichte. Auer von Welsbach war ein<br />
Althofener und hat mit seinen Errungenschaft<br />
unsere Stadtgemeinde über<br />
die Bundesgrenzen hinaus bekannt<br />
gemacht.“ Das Auer von Welsbach-<br />
Museum zeigt das Lebenswerk eines<br />
Univeralgenies und ist einen Besuch<br />
wert.<br />
Informationen:<br />
Tel.: 0463/ 525-1644<br />
dienstleistungen@kelag.at<br />
www.kelag.at<br />
E.E.
Projekt Spöttlgasse in Wien Floridsdorf.<br />
Erste 4-geschoßige Wohnhausanlage...<br />
...in Holzbauweise<br />
Das Projekt Spöttlgasse in<br />
Wien Floridsdorf wurde<br />
nach der Novellierung der<br />
Wiener Bauordnung, <strong>Ausgabe</strong><br />
Jänner 2001, konzipiert.<br />
Demnach sind Holzwohnbauten<br />
bis zu einer<br />
Höhe von 4 Holzgeschossen<br />
(3 Hauptgeschosse, 1 Dachgeschoss)<br />
auf einem, aus<br />
nicht brennbaren Baustoffen<br />
bestehendem Sockelgeschoss<br />
zugelassen.<br />
Auf einem Tiefgaragengeschoss<br />
werden 113 Wohnungen<br />
(durchschnittlich 73 m 2 )<br />
errichtet. Die Wohnungen<br />
werden über Laubengänge<br />
erschlossen. Die Planung des<br />
Projektes stammt vom Architekturbüro<br />
Arch. Dipl.-Ing.<br />
Hubert Riess, Steiermark.<br />
Nach Abschluss der Massivbauarbeiten<br />
(Tiefgarage,<br />
Sockelgeschosse und Stiegenaufgänge)<br />
wird die Holztragstruktur,<br />
bestehend aus KLH<br />
Massivholzplatten, der einzelnen<br />
Wohnungen montiert.<br />
Massivholzplatten<br />
Die Wandelemente werden<br />
weitgehend vorgefertigt, die<br />
Deckenaufbauten vor Ort<br />
fertig gestellt. Die Montage<br />
vor Ort nimmt nur wenige<br />
Wochen in Anspruch. Die<br />
Holztragstruktur aus den<br />
großformatigen, mehrschichtig<br />
verleimten KLH Massivholzplatten<br />
erlaubt eine<br />
extrem schnelle Bauweise<br />
und einen hohen Vorfertigungsgrad.<br />
Die Randbedingungen für<br />
den Wiener Raum stellen für<br />
den Holzbau eine echte Herausforderung<br />
dar (Ableitung<br />
von Erdbebenlasten, hohe<br />
Brandschutzanforderungen,<br />
Schallschutzwerte).<br />
Um all diesen Anforderungen<br />
gerecht werden zu können,<br />
wurden für dieses Bauvorhaben<br />
bzw. für diesen<br />
Haustyp zahlreiche Tests<br />
und Prüfungen durchgeführt.<br />
Neben einem Testhaus<br />
für die Schallschutzmessungen<br />
wurden auch Brandversuche<br />
bei der MA 39, Wien<br />
und statische Belastungstests<br />
bei der HFA (Holzforschung<br />
Austria) durchgeführt.<br />
Die Aufbauten mit KLH Massivholzplatten<br />
konnten allen<br />
Anforderungen gerecht werden.<br />
Für die wesentlichen<br />
Bauteile wurden sogar deutlich<br />
höhere Werte erzielt, als<br />
in der Bauordnung und den<br />
geltenden Normen gefordert.<br />
Im Hinblick auf den<br />
Wärmeschutz wurde der<br />
Standard Niedrigenergiehaus<br />
gewählt.<br />
Dieses Bauvorhaben umfasst<br />
ca. 9.061 m 2 Wohnfläche,<br />
davon 7.396 m 2 errichtet in<br />
KLH Massivholzbauweise.<br />
Dafür sind ca. 16.000 m 2<br />
KLH Massivholzplatten als<br />
Wand- und Deckenelemente<br />
notwendig. Damit wird eine<br />
große Menge an CO 2 über<br />
Jahrzehnte hinaus der<br />
Atmosphäre entzogen und<br />
gespeichert.<br />
Informationen:<br />
KLH Massivholz GmbH<br />
A-8842 Katsch/Mur 202<br />
Tel: 03588/8835-11<br />
Fax: 03588/8835-20<br />
office@klh.at<br />
www.klh.at<br />
E.E.<br />
STAPLER VON HYSTER.<br />
SERVICE VON ZEPPELIN.<br />
ALLES VOM FEINSTEN.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Sonst guckt ja<br />
wieder keiner hin.<br />
Im Prinzip ist das der älteste Trick der Welt: Sex sells. Aber was sollen<br />
wir machen? Stapler sind nicht wirklich sexy. Nicht einmal die von Hyster.<br />
Dennoch wollen wir Sie unbedingt auf Folgendes aufmerksam machen:<br />
1) Zeppelin* hat exklusiv Vertrieb und Service für Hyster-Stapler in<br />
Österreich und zahlreichen weiteren Ländern Europas übernommen.<br />
2) Das bedeutet: noch mehr Service-, mehr Leasing-, mehr Finanzierungs-,<br />
mehr Miet- und noch mehr Flottenkompetenz.<br />
3) Und vor allem: mehr Präsenz, denn Sie bekommen Hyster-Stapler an<br />
über 5 Orten in Österreich. Natürlich auch Mietmaschinen, Beratung,<br />
Ersatzteile – das volle Programm.<br />
Nun, nachdem Sie bewiesen haben, dass Sie nicht nur nach bunten<br />
Bildchen gucken, stehen wir Ihnen auch telefonisch gerne Rede und<br />
Antwort: 02232 790292.<br />
* Zeppelin ist Europas größtes Handels- und Serviceunternehmen für die Baumaschinen und Motoren von Caterpillar.<br />
www.zeppelin-hyster.at<br />
MAASTRICHT<br />
SERVICE<br />
Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen<br />
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialisten<br />
für kommunale Leasingprojekte.<br />
E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at<br />
www.kommunal-leasing.at<br />
www.skpwerbung.de<br />
KOMMUNAL 43
Energie<br />
Unzählige Gemeinden verfügen über ein<br />
Biomasseheizwerk, das zumeist mit<br />
Hackschnitzeln, im östlichen Niederösterreich<br />
aber auch mit Stroh betrieben<br />
wird und neben Privathaushalten zahlreiche<br />
öffentliche Gebäude mit Wärme<br />
versorgt.<br />
Traditionelle und erneuerbare Energie in Gemeinden<br />
Einsatzmöglichkeiten<br />
für Solar und Wind<br />
Der Einsatz Erneuerbarer Energie in den Gemeinden war schon immer von zentraler<br />
Bedeutung. Die traditionellen Einsatzformen sind die Wärmeerzeugung aus Biomasse<br />
und die Wasserkraftnutzung. KOMMUNAL berichtet, wie Gemeinden von<br />
Klimaschutzmaßnahmen profitieren können.<br />
◆ Mag. Peter Haftner<br />
Im Zuge der Industrialisierung und<br />
Urbanisierung wurde vorerst Brennholz<br />
sukzessive durch Kohle ersetzt, die wiederum<br />
beginnend mit den fünfziger Jahren<br />
von Öl und Gas bei stark steigendem<br />
Energieumsatz abgelöst wurde.<br />
Fossile Energie<br />
Die Endlichkeit fossiler Energieträger<br />
◆ Mag. Peter Haftner ist Umweltberater<br />
im Fachbereich Energie in<br />
Niederösterreich<br />
44 KOMMUNAL<br />
rückte in der Ölkrise der 70er Jahre ins<br />
gesellschaftliche Bewusstein. Heute<br />
gehen die führenden Energieexperten<br />
davon aus, dass der Höhepunkt der<br />
Ölproduktion bereits<br />
erreicht ist, und prognostizieren<br />
eine drasti-<br />
sche Steigerung des<br />
Ölpreises spätestens in<br />
den zwanziger Jahren.<br />
Die Importabhängigkeit<br />
der Europäischen Union<br />
bezüglich Erdöl wird bis<br />
dahin auf etwa 90 Prozent<br />
steigen, während<br />
sich der Schwerpunkt<br />
der Erdölförderung<br />
noch stärker auf die<br />
derzeitigen Krisenländer<br />
im Mittleren Osten verlagert.<br />
Der beginnende Klimawandel macht<br />
sich durch die weltweite Zunahme an<br />
Katastrophen bemerkbar und findet<br />
immer wieder seinen Niederschlag in<br />
Der<br />
lokale Einsatz<br />
Erneuerbarer Energie<br />
trägt wesentlich zur<br />
Versorgungssicherheit<br />
und zur Stärkung<br />
der regionalen<br />
Wertschöpfung bei.<br />
der Diskussion regionaler Wetterkapriolen.<br />
In dieser Situation sind vor allem<br />
auch die Gemeinden gefordert, die Klimastrategie<br />
der Bundesregierung zu<br />
unterstützen, die Einerseits<br />
in der Steigerung<br />
der Energieeffizienz und<br />
andererseits im Ausbau<br />
Erneuerbarer Energie<br />
liegt. Bis 2010 sollen<br />
immerhin 13 Prozent der<br />
Treibhausgase eingespart<br />
werden, derzeit sind sie<br />
aber noch im Steigen<br />
begriffen.<br />
Dabei profitieren die<br />
Gemeinden selbst sehr<br />
stark von Klimaschutzmaßnahmen.<br />
Der lokale<br />
Einsatz Erneuerbarer<br />
Energie trägt wesentlich<br />
zur Versorgungssicherheit und zur Stärkung<br />
der regionalen Wertschöpfung bei.<br />
Ökologie und Ökonomie gehen Hand in<br />
Hand, denn die Erneuerbare Energie
Solartankstelle der Feistritz Werke in Gleisdorf.<br />
kommt aus der Region und das Knowhow<br />
zur Nutzung kommt in erster Linie<br />
der Region zugute. Auch die Förderung<br />
der Landwirtschaft, die ganz bedeutend<br />
für den Erhalt unserer Kulturlandschaft<br />
ist, ist mit der Forcierung erneuerbarer<br />
Energieträger verbunden. Denn der<br />
Landwirt der Zukunft wird zum Teil<br />
auch Energiewirt sein.<br />
Die Einsatzbereiche Erneuerbarer Energie<br />
in den Gemeinden ist dabei sehr vielfältig.<br />
Es gibt unzählige hervorragende und<br />
erfolgreiche Beispiele, die zeigen, wie<br />
sich Gemeinden mit Erneuerbarer Energie<br />
Kompetenz schaffen und sogar konsequent<br />
darauf aufbauend ein spezifisches<br />
regionales Image aufbauen, das dann<br />
letztlich sogar touristisch anziehend wirkt<br />
und ein wichtiges Puzzle in der Regionalentwicklung<br />
ist.<br />
Solarenergie<br />
So ist zum Beispiel Gleisdorf<br />
inzwischen zum Zentrum der<br />
Solarenergienutzung geworden.<br />
In der Gemeinde selbst<br />
wird man an unzähligen<br />
Punkten bewusst mit dem<br />
Thema Solarenergie konfrontiert.<br />
Die thermische Solarenergienutzung<br />
sollte ja für alle<br />
Gemeinden, die über ein<br />
eigenes Freibad verfügen,<br />
inzwischen selbstverständlich<br />
geworden sein. Auf dem<br />
Mit dem<br />
Energiepark in<br />
Bruck an der<br />
Leitha verfolgt<br />
die Gemeinde<br />
das langfristige<br />
Ziel der Energieautarkheit.<br />
Gelände der Feistritzwerke gibt es darüber<br />
hinaus nicht nur eine öffentlich<br />
zugängliche Sonnenstromtankstelle für<br />
Elektrofahrzeuge,<br />
sondern<br />
auch<br />
eine<br />
Pflanzenöltankstelle<br />
für<br />
umgerüsteteDieselfahrzeuge,<br />
die auch vom gemeindeeigenen<br />
Fuhrpark recht fleißig genutzt wird.<br />
Mit dem Energiepark in Bruck an der<br />
Leitha verfolgt die Gemeinde das langfristige<br />
Ziel der Energieautarkheit.<br />
Neben einem Biomasseheizwerk und<br />
zahlreichen Windkraftparks<br />
gibt es auch eine<br />
große Biogasanlage.<br />
Unzählige Gemeinden<br />
Gemeinden profitieren<br />
von ihnen vor allem durch<br />
die massive Reduktion der<br />
Treibhausgase und durch den<br />
Anstoß zu einer nachhaltigen<br />
Gemeindeentwicklung.<br />
verfügen über ein Biomasseheizwerk,<br />
das<br />
zumeist mit Hackschnitzeln,<br />
im östlichen Niederösterreich<br />
aber auch<br />
mit Stroh betrieben wird<br />
und neben Privathaushalten<br />
zahlreiche öffentliche<br />
Gebäude mit Wärme versorgt.<br />
Wichtig ist hier,<br />
Energie<br />
Windkraftanlage von Bruck an der<br />
Leitha mit einer Aussichtsplattform, die<br />
auch touristisch genützt wird.<br />
dass auch gleich für den Anschluss<br />
neuer Siedlungen bei der Flächenwidmung<br />
vorgesorgt wird.<br />
In diesen aufgezeigten Beispielen ist die<br />
Gemeinde zumeist nicht der Betreiber<br />
der Anlagen. Oft ist die Gemeinde aber<br />
beteiligt und unterstützt aktiv die Projektentwicklung<br />
und -umsetzung dieser<br />
Anlagen. Schließlich ist sie in den meisten<br />
Fällen auch der Abnehmer der<br />
angebotenen Energie. Gemeinden profitieren<br />
von ihnen vor allem durch die<br />
massive Reduktion der Treibhausgase<br />
und durch den Anstoß zu einer nachhaltigen<br />
Gemeindeentwicklung.<br />
KOMMUNAL 45
Wirtschafts-Info<br />
Bautechnische Lösungen für höchste Ansprüche<br />
Die optisch ansprechenden Steinkörbe bestechen durch ihre hohe<br />
Stabilität und Widerstandsfähigkeit.<br />
Flexible und naturnahe Lösungen ermöglichen<br />
die neuen RAWE-Steinkörbe. Die<br />
innovativen Steinkörbe eignen sich für<br />
Bauprojekte wie Schutz- und Stützmauern,<br />
Wildwasserverbauungen aber auch<br />
kleinere Bauvorhaben wie Hang- und<br />
Gartengestaltung in<br />
Parkanlagen. Aufgrund<br />
der hervorragendenSchallabsorbierung<br />
können die<br />
Steinkörbe auch als<br />
ideale Module für<br />
Lärm- und Sichtschutzwände<br />
bei<br />
Straßenanlagen und<br />
Autobahnbauten eingesetzt<br />
werden.<br />
Dem Trend zum<br />
natürlichen Bauen<br />
sowohl im öffentlichen<br />
als auch privaten<br />
Bereich entsprechen die RAWE-Steinkörbe:<br />
Hochwertige österreichische<br />
Natursteine werden in regionalen Steinbrüchen<br />
gewonnen und gleich im Werk in<br />
rostfreie Gitterkörbe verfüllt, gerüttelt<br />
und dadurch zur maximalen Stabilität<br />
verdichtet.<br />
Die Steinkorb-Elemente sind in unterschiedlichen<br />
Größen und Gesteinsarten<br />
flexibel und vielseitig einsetzbar. Fix und<br />
fertig werden sie als Module mit den von<br />
Ihnen gewünschten Gesteinsarten im<br />
Werk verfüllt. Der patentierte RAWE-<br />
Steinkorb ist in Österreich mit heimischem<br />
Kalkstein, Dolomit, Granit,<br />
Amphybolit, Basalt und Diabas, sowohl<br />
ein- als auch mehrfärbig erhältlich.<br />
Die Montage der Steinkörbe erfolgt<br />
kostengünstig und rasch: Als flexible Einheiten<br />
ermöglichen sie einen raschen und<br />
mörtelfreien Bau der stabilen Natursteinmauern.<br />
Der optisch ansprechende Steinkorb<br />
besticht durch seine hohe Stabilität<br />
und Widerstandsfähigkeit.<br />
46 KOMMUNAL<br />
Die gute Wasserdurchlässigkeit des Steinkorbs<br />
bildet eine natürliche Drainage. Die<br />
Hohlräume zwischen den Steinen können<br />
einfach bepflanzt und damit rasch Grüninseln<br />
bei kommunalen Bauten gestaltet<br />
werden.<br />
Informationen:<br />
Stein auf<br />
Stein<br />
Steinkörbe – für natürliche und<br />
dauerhafte Befestigungsmauern,<br />
Dammbauten und Lärmschutzwände.<br />
Der patentierte RAWE-Steinkorb ist sowohl ein- als auch mehrfärbig<br />
in unterschiedlichen Gesteinsgrößen erhältlich.<br />
Eine Wiederverwertung oder Versetzung<br />
der Natursteinkörbe ist einfach und ökologisch<br />
schonend machbar.<br />
Die modulartigen Steinkorb-Bauelemente<br />
werden seit dem Frühling erstmals auch<br />
in Österreich angeboten.<br />
Ausführliche Informationen zu technischen Daten und Bezugsquellen finden sich<br />
auf der Website: www.steinkorb.at sowie direkt bei den Steinkorb-Unternehmen:<br />
Dolomit Eberstein Neuper GmbH, Ing. Dietmar Aspernig<br />
Klagenfurter Straße 1, 9372 Eberstein, Tel.: +43 [0] 4264/8182-20<br />
E-Mail: office@dolomit.at, www.dolomit.at<br />
Nöhmer Ges.m.b.H. & Co. KG, Stefan Nöhmer<br />
Weißenbach 83, 4854 Weißenbach/Attersee, Tel.: + 43 [0] 7663/8910-0<br />
E-Mail: stonebox@noehmer.at, www.noehmer.at<br />
Hengl Schotter-Asphalt-Recycling GmbH, Ing. Josef Gratz<br />
Hauptstraße 39, 3721 Limberg, Tel.: + 43 [0] 2958/88223-47<br />
E-Mail: office@hengl.at, www.hengl.at<br />
E.E.
BAWAG P.S.K. Leasing-Gruppe startet in Osteuropa durch<br />
„Ab sofort forcieren wir unsere Aktivitäten<br />
in den neuen EU-Beitrittsländern.<br />
Und zwar gleich in mehreren<br />
Staaten“, vermeldet die Geschäftsführung<br />
der BAWAG P.S.K.-Leasing<br />
Gruppe. Die neuen Niederlassungen<br />
erfolgen in Zusammenarbeit mit den<br />
lokalen Tochterbanken der BAWAG<br />
P.S.K.-Gruppe in drei der neuen EU-Mitgliedsstaaten<br />
(Tschechien, Ungarn, Slowakei).<br />
Schwerpunkt der Aktivitäten<br />
sind das Fuhrparkmanagement, das<br />
Kfz- sowie das Mobilien-Leasing. Insgesamt<br />
werden in den drei Gesellschaften<br />
20 Personen beschäftigt. Zwei Mitarbeiter<br />
wurden aus Österreich in die neuen<br />
Niederlassungen entsendet.<br />
Für die Geschäftsführer der BAWAG<br />
P.S.K.-Leasing Gruppe sind die ersten<br />
Signale aus den Niederlassungen der<br />
neuen EU-Mitgliedsstaaten trotz der<br />
fortgeschrittenen Marktbesetzung vielversprechend.<br />
Entscheidend sind die<br />
Kunden- und Vertriebsbasis der Bankengruppe<br />
sowie der Know-how-Transfer<br />
was Produktvielfalt und Zielgruppenmarketing<br />
anlangt.<br />
Top drei als Ziel<br />
Im Jubiläumsjahr anlässlich des<br />
25jährigen Bestehens der BAWAG<br />
P.S.K.-Leasing Gruppe zählt das Unternehmen<br />
zu den Top-Leasing-Anbietern<br />
in Österreich. Wir sind Universalanbieter<br />
und es gibt fast keine Leasingalternative,<br />
die wir nicht anbieten.<br />
Dazu meldet die Geschäftsleitung: „Wir<br />
haben im Branchenvergleich eine überdurchschnittlich<br />
hohe Produktivität.<br />
Aktuell verfügen wir über einen Marktanteil<br />
von 8,3 Prozent und sind den<br />
Top drei Anbietern dicht auf den Fersen.“<br />
Ziel des Unternehmens ist es in den<br />
nächsten Jahren unter die Top drei im<br />
österreichischen Leasing-Geschäft zu<br />
kommen. Die Geschäftsführung erläutert:<br />
„Wir streben das an, auch wenn<br />
die Marktanteile<br />
kein Wert an sich<br />
sind. Denn ein<br />
Unternehmen muss<br />
nicht notwendigerweise<br />
der Marktführer<br />
sein, um Geld zu<br />
verdienen. Die<br />
BAWAG P.S.K.-Leasing<br />
Gruppe hat<br />
2003 einen Gewinn<br />
vor Steuern von<br />
rund 5,5 Millionen<br />
Euro erwirtschaftet.<br />
Die Bilanzsumme<br />
des Unternehmens<br />
machte per Ende 2003 rund 1,3 Milliarden<br />
Euro aus.“<br />
Den Vorstoß unter die Top drei Leasing-<br />
Anbieter will die BAWAG P.S.K.-Leasing<br />
Gruppe durch die forcierte Nutzung des<br />
Vertriebs erreichen: dazu zählen die<br />
160 BAWAG-Filialen, die 240 Finanzberatungszentren<br />
in den Post-Filialen, die<br />
rund 150 Auto-Handelspartner sowie<br />
die Vertriebsbüros der Allianz- und<br />
Generali-Versicherungen, der ausgewählte<br />
Büromaschinenhandel und die<br />
Internet-Plattform www.leasing.at.<br />
Leasing-Volumen stieg<br />
um 5,7 Prozent<br />
Das Leasing-Volumen der BAWAG<br />
P.S.K.-Leasing Gruppe machte 2003<br />
exakt W 1,312 Mrd. aus. Das entspricht<br />
einem Plus von 5,7 Prozent gegenüber<br />
2002 (W 1,243 Mrd.). Den größten<br />
Zuwachs brachte das Kfz-Leasing mit<br />
einer neunprozentigen Steigerung. Das<br />
entspricht einem Volumen von W 446<br />
Millionen. Das Immobilien-Leasing ist<br />
die Sparte mit einem Plus von 5,4 Prozent<br />
oder einem Volumen von W 548<br />
Millionen. Die Sparte Mobilien-Leasing<br />
brachte ein Volumen von W 319 Millionen<br />
und damit ein Plus von 1,7 Prozent<br />
gegenüber 2002.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Fast alles ist leasebar<br />
Die BAWAG P.S.K.-Leasing Gruppe startet die Expansion in die Nachbarländer Ungarn,<br />
Tschechien und Slowakei. In Österreich soll das Unternehmen unter die Top drei<br />
Leasinganbieter vorstoßen.<br />
Die drei Geschäftsführer der BAWAG P.S.K.-Leasing Gruppe (v.l.):<br />
Mag. Rudolf Fric, Harald Haider und Friedrich Primetzhofer.<br />
2,6 Prozent Plus bei den<br />
Verträgen<br />
2003 hatte die BAWAG P.S.K.-Leasing<br />
Gruppe 45.737 Verträge und erreichte<br />
damit bei den Verträgen einen durchschnittlichen<br />
Zuwachs von 2,6 Prozent<br />
gegenüber 2002. In den drei Sparten<br />
Mobilien, Immobilien und Kfz konnten<br />
bei der Zahl der Verträge durchwegs<br />
Zugewinne erzielt werden. Bei den<br />
Mobilien konnte das Unternehmen um<br />
1,8 Prozent auf 13.405 Verträge zulegen.<br />
Bei den Kfz-Verträgen wurde ein<br />
Plus 2,9 Prozent auf 31.904 Verträge<br />
erreicht. Die höchste Steigerung konnte<br />
beim Immobilien-Leasing mit einem<br />
Zuwachs von 5,7 Prozent auf 428 Verträge<br />
verzeichnet werden.<br />
Informationen:<br />
<strong>Kommunal</strong>leasing GmbH – ein<br />
Unternehmen der BAWAG P.S.K.-<br />
Leasing Gruppe und der<br />
<strong>Kommunal</strong>kredit AG<br />
Mag. Stefan Vigl<br />
Tel.: 01/ 31 6 31 - 110<br />
Mag. Ewald Freund<br />
Tel.: 01/ 369 20 20 - 410<br />
E-Mail:anfrage@<br />
kommunal-leasing.at<br />
www.kommunal-leasing.at<br />
KOMMUNAL 47<br />
E.E.
Kosten sparen mit Wien Energie<br />
Energiebuchhaltung<br />
Kostenkontrolle und Verbrauchsübersichten sind Basis für das Budget. Wie sieht es bei<br />
der Energie aus? Gibt es eine Dokumentation und Kontrolle über den Verbrauch und<br />
die Kosten? Wien Energie hat das perfekte Serviceangebot für Kommunen: Die<br />
Energiebuchhaltung.<br />
Die Energiebuchhaltung hilft aufzuzeigen,<br />
wo gespart werden kann. Dokumentation<br />
und Kontrolle über den Verbrauch<br />
und die Kosten der Energie hilft<br />
bei Einsparungen.<br />
Das alles bringt die<br />
Energiebuchhaltung<br />
Plant die Gemeinde Sanierungs- oder<br />
Umweltprojekte, liefert die Energiebuchhaltung<br />
die nötigen Entscheidungsgrundlagen.<br />
Die Beurteilung der<br />
ökologischen und ökonomischen Sinnhaftigkeit<br />
von Maßnahmen und die<br />
Erfolgskontrolle und Motivation von<br />
Nutzern wird möglich. Und die Erfolgskontrolle<br />
und Motivation von Nutzern<br />
mittels Reporting spornt Mitarbeiter an,<br />
beim Energieverbrauch bewusst und<br />
sparsam zu agieren. Die Energiebuchhaltung<br />
zeichnet Energieverbräuche,<br />
Kosten, Schadstoffemissionen und<br />
andere relevante Kenngrößen in regelmäßigen<br />
Abständen auf. Anschauliche<br />
und leicht verständliche Auswertungen<br />
verdeutlichen die Einflüsse der Gebäu-<br />
48 KOMMUNAL<br />
Aussagekräftige Reports<br />
nach Maß:<br />
◆ Energieverbrauchs-, Energiekostenstatistiken<br />
und Schadstoffbilanzen<br />
◆ Soll-/Istvergleiche und Abweichungsanalysen<br />
◆ Energiebenchmarks wie Kennzahlenberechnung,<br />
Vergleiche<br />
mit Sollwerten<br />
denutzung, Witterung und Anlagen.<br />
Die Auswirkungen auf Energiekosten<br />
und Schadstoffemissionen werden dargestellt.<br />
Erfolgskontrolle<br />
Bei der Energiebuchhaltung von Wien<br />
Energie wird die neueste Kommunikationstechnologie<br />
verwendet. Die<br />
Gemeinde kann die Energiebuchhaltung<br />
über www.wienenergie.at von<br />
jedem PC aus benutzen und Zähler-<br />
Mit der Energiebuchhaltung von<br />
Wien Energie haben Gemeinden<br />
ihre Kosten im Griff.<br />
stände eingeben. Die Auswertungen<br />
erfolgen individuell je nach den Anforderungen<br />
und kommen direkt auf den<br />
PC in der Gemeinde.<br />
Keine Investitionen<br />
Für diese modernste Art des Buchhaltung<br />
– der Energiebuchhaltung – sind<br />
keine Investitionen, keine Software-<br />
Installation, keine Software-Wartung<br />
notwendig. Der Zugriff zu den Daten<br />
ist rund um die Uhr, weltweit möglich.<br />
Informationen:<br />
Wenn Sie weitere Fragen zum<br />
Thema Energiebuchhaltung haben,<br />
informieren Sie gerne Ihre<br />
Wien Energie-Gemeindebetreuer<br />
Ing. Christian Peterka,<br />
Tel.: 01/97700-38170,<br />
christian.peterka@wienenergie.at,<br />
und Josef Spazierer,<br />
Tel.: 01/97700-38171,<br />
josef.spazierer@wienenergie.at<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Effizienter Klimaschutz durch Modernisierung und Sanierung<br />
Moderne Ölheizung mit Verantwortung<br />
Rund 900.000 Haushalte in Österreich<br />
heizen mit Heizöl. Um in Sachen Klimaschutz<br />
den Beitrag dieser Bürgerinnen<br />
und Bürger sicherzustellen, hat die<br />
Mineralölwirtschaft ihre Anstrengungen<br />
in der „Initiative pro Klimaschutz“<br />
gebündelt. Würden diese Maßnahmen<br />
umgesetzt, könnten bis 2012 pro Jahr<br />
rund 1 Million Tonnen beim CO 2 -Ausstoß<br />
eingespart werden. Und das ohne<br />
den Einsatz von beachtlichen Steuergeldern,<br />
die bei der Förderung von Biomasse<br />
für die Individualheizung und<br />
für Fernwärme unkritisch und in<br />
großen Summen ausgegeben werden.<br />
Klimaschutz: Vorschläge<br />
der Mineralölwirtschaft<br />
◆ Ersatz veralteter und ineffizienter<br />
Heizkessel<br />
◆ Modernisierung der Heizungs- und<br />
Warmwasserverteilsysteme<br />
◆ Regelmäßige Inspektion und Wartung<br />
der Heizanlagen<br />
◆ Kombination von modernen Ölhei-<br />
Der Anteil der modernen Ölheizung an<br />
den Schadstoffemissionen Österreichs ist<br />
zungen mit Solaranlagen zur Warmwasserbereitung<br />
◆ Thermische Sanierung der Gebäudehüllen<br />
Dazu setzt die Initiative, die von der<br />
Mineralölindustrie und dem Brennstoffhandel<br />
getragen wird, konkrete<br />
Wettbewerb<br />
„Energieregionen der Zukunft“ gestartet<br />
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie<br />
(BMVIT) beabsichtigt mit dem Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften<br />
durch die Förderung nachhaltigkeitsorientierter Entwicklungen<br />
wesentliche Innovationsimpulse für die österreichische<br />
Wirtschaft zu setzen. Ziel der Programmlinie „Energiesysteme der<br />
Zukunft“ ist es, Technologien und Konzepte für auf der Nutzung<br />
erneuerbarer Energieträger aufbauende, energieeffiziente und flexible<br />
Energiesysteme zu entwickeln, die langfristig in der Lage sind,<br />
unseren Energiebedarf zu decken.<br />
Begleitend dazu wurde der Wettbewerb „Energieregionen der<br />
Zukunft“ gestartet: bis zum 20. Oktober 2004 können bereits<br />
realisierte, vorbildhafte Aktivitäten, Maßnahmen und Projekte mit<br />
Energiebezug auf regionaler/lokaler Ebene eingereicht werden, die<br />
im Sinne der Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“ richtungweisend<br />
sind.<br />
Eine unabhängige Expertenjury wählt die auszuzeichnenden Projekte<br />
aus. Die Preisverleihung durch Vizekanzler und Bundesminister<br />
Hubert Gorbach erfolgt im Jänner 2005 auf Basis des Vorschlags<br />
der Jury. Die Jury kann Preisgelder in der Höhe von insgesamt<br />
30.000,- Euro vergeben.<br />
Zwischenschritte und messbare Zielsetzungen.<br />
Österreichs größtes Bundesland<br />
macht vor, wie es geht: Hier wurde<br />
die bewährte Kesseltausch-Förderaktion<br />
bis Ende 2005 verlängert. Seitens<br />
der Wirtschaftskammer (Landesgremium<br />
des Brennstoff- und Mineralölhandels)<br />
gilt darum die besondere<br />
Anerkennung den zuständigen<br />
politischen Verantwortungsträgern,<br />
die hier im Sinne tausender Ölheizungsbesitzer<br />
und im Sinne eines<br />
effizienten Klimaschutzes den richtigen<br />
Schritt gesetzt haben.<br />
Informationen:<br />
IWO-Österreich<br />
Reisnerstraße 3/7<br />
1030 Wien<br />
Tel.: 01/710 68 99<br />
Fax: 01/710 68 98<br />
E-Mail: wien@iwo-austria.at<br />
Web: www.iwo-austria.at<br />
www.heizungsvergleich.at<br />
Themen<br />
Erfolgreiche Umsetzung innovativer Energiesysteme<br />
Besonders innovative energiebezogene Einzelmaßnahmen mit<br />
lokalem oder kommunalem Bezug<br />
Implementierung von Leitbildern, Visionen und Konzepten<br />
Lokale/regionale Initiativen (z.B. Bürgerinitiativen, Schulprojekte,…)<br />
Zielgruppen<br />
Gemeinden, Bezirke und Regionen<br />
Lokale/regionale Akteure und Netzwerke (Einzelpersonen, Vereine,<br />
Kooperationen,…)<br />
Beurteilungskriterien und Auswahl der Preisträger<br />
Beitrag zu Nachhaltiger Entwicklung im Sinne der Programmlinie<br />
„Energiesysteme der Zukunft“:<br />
• Förderung der Nutzung erneuerbarer Energieträger<br />
• Einbindung/Partizipation der Bevölkerung bei der Umsetzung<br />
der Maßnahmen<br />
• Orientierung am Nutzen und an der Dienstleistung<br />
• Orientierung am Effizienzprinzip (Energie-, Material- und<br />
Kosteneffizienz)<br />
• Beitrag zur Sicherung von Arbeit, Einkommen und Lebensqualität<br />
Neuheit, Originalität und Effektivität der Maßnahmen<br />
Vorbildwirkung und Potenzial für weitere Umsetzungen im Sinne<br />
der Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“<br />
Beratung<br />
Mag. Reinhard Jellinek oder DI Andreas Indinger<br />
Energieverwertungsagentur – The Austrian Energy Agency (E.V.A.)<br />
Info-Hotline: 01/ 586 15 24 -55<br />
E-Mail: office@ENERGIESYSTEMEderzukunft.at<br />
Mehr Infos unter www.ENERGIESYSTEMEderzukunft.at (Leitfaden zum Wettbewerb, Einreichformular,…)<br />
KOMMUNAL 49<br />
E.E.
Energie<br />
Lokale und umweltverträgliche Energieversorgungspolitik<br />
Die Möglichkeiten<br />
und die Grenzen<br />
Anhand einer vielbeachteten Forschungsarbeit klärt KOMMUNAL die Frage, ob<br />
Gemeinden sich aktiver in alternative Energieversorgung einschalten sollten.<br />
Sprich: Soll eine Gemeinde eine Windkraftanlage initiieren oder gar betreiben?<br />
◆ Mag. Patrik Scherhaufer<br />
Derzeit gibt es zwei aktuelle Problemkreise,<br />
die international innerhalb des so<br />
umfassenden und wichtigen Politikfeldes<br />
- der Energie- bzw. Elektrizitätsversorgung<br />
und -nutzung - diskutiert werden:<br />
◆ Das Problem des Klimawandels und<br />
die damit in Zusammenhang stehende<br />
Emission von Treibhausgasen (insbesondere<br />
CO2): Der anthropogen beeinflusste<br />
Klimawandel macht eine „Energiewende“<br />
unabdingbar. Diese Wende muss einerseits<br />
zu einem effizienten Energieeinsatz<br />
auf der Nachfrageseite führen und andererseits<br />
ressourcenverbrauchende und<br />
emissionsintensive Energieträger (wie<br />
Kohle, Erdöl und Erdgas) substituieren.<br />
◆ Das Problem der Zentralisierung der<br />
Energieproduktion: Ein auf sogenannten<br />
Großtechnologien aufbauendes Stromversorgungssystem<br />
kann zum Beispiel mit<br />
einem unkontrollierbaren technischen<br />
Risiko verbunden sein (vgl. Atomkraft:<br />
Unfälle in Three Miles Island/1979 und<br />
Tschernobyl/1986), bedeutet oft den Verbrauch<br />
enormer Mengen an „Landschaft“<br />
(vgl. Wasserkraft: Drei-Schluchten-Staudamm<br />
am Yangze) und fossiler Ressour-<br />
◆ Mag. Patrick<br />
Scherhaufer ist Doktoratsstudent an der<br />
Uni Wien und studiert derzeit am Institut<br />
für Höhere Studien (IHS) Politikwissenschaft<br />
/ Europäische Integration<br />
50 KOMMUNAL<br />
cen (vgl. großtechnischer Verbrauch von<br />
Erdöl, Erdgas und Kohle in kalorischen<br />
Kraftwerken) und erhöht die Abhängigkeit<br />
von einzelnen Produktionsanlagen<br />
(vgl. allein im August und September<br />
2003 gab es vier überregionale „Stromblackouts“<br />
in USA/Kanada, Großbritannien,<br />
Dänemark/Schweden und Italien).<br />
Suche nach Alternativen<br />
Unter der Berücksichtigung dieser Tatsachen<br />
gewann die Suche nach technischen<br />
Alternativen, die die vier zentralen Zielgrößen<br />
einer Energie- bzw. Stromversorgungspolitik<br />
- nämlich Umweltverträglichkeit,<br />
Versorgungssicherheit, Sozialverträglichkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit - umfassender<br />
gewährleisten können, immer mehr<br />
an Bedeutung. Als einzige die Vorgaben<br />
erfüllende Alternative haben sich die<br />
sogenannten (neuen)<br />
erneuerbaren Energieträgern<br />
herausgestellt (dazu<br />
zählen: Kleinwasserkraft,<br />
Biomasse, Biogas, Deponie-<br />
und Klärgas, geothermische<br />
Energie, Windund<br />
Sonnenenergie).<br />
Erneuerbare Energieträger<br />
haben das Potential<br />
die oben genannte Problemkreise<br />
- wenn nicht<br />
ganz - so zumindest zum<br />
Teil zu lösen.<br />
Bezeichnend für den Einsatz<br />
der Windkraft und auch der anderen<br />
erneuerbaren Energieträger ist, dass sie<br />
vorwiegend dezentral einsetzbar und verfügbar<br />
sind und damit den Zentralisationsprozessen<br />
der klassischen Energiewirtschaft<br />
widersprechen. Nicht zuletzt<br />
Auch kleinere und<br />
mittlere Gemeinden<br />
haben die Chance,<br />
sich mit Energieversorgung<br />
im Feld der<br />
Daseinsvorsorge<br />
zu beweisen.<br />
hat durch den Erfolg der Windkraft auch<br />
eine stärker auf kommunaler Ebene<br />
basierende Energieerzeugung und -politik<br />
an Bedeutung gewonnen.<br />
Das Beispiel Zurndorf<br />
Um nun die Möglichkeiten und Grenzen<br />
einer lokalen umweltverträglichen Energiepolitik<br />
aufzuzeigen, hat der Autor dieser<br />
Forschungsarbeit zunächst die wirtschaftlichen,<br />
geographischen, ökologischen<br />
und sozialen Rahmenbedingungen<br />
einer Stromversorgung mittels Windkraft<br />
untersucht. Darüber hinaus hat er sich<br />
eingehend mit dem Fallbeispiel Windpark<br />
Zurndorf (liegt im Burgenland - Nahe des<br />
Grenzübergangs Nickelsdorf/Hegeyshalom)<br />
auseinandergesetzt. Zurndorf stand<br />
deshalb im Mittelpunkt der Studie, da<br />
ursprünglich die Gemeinde den Windpark<br />
nicht nur initiieren<br />
sondern auch selbst<br />
betreiben wollte.<br />
Nach eingehender Analyse<br />
aller Dokumente<br />
und Quellen und dem<br />
Abschluss der empirischen<br />
Phase (qualitative<br />
Interviews mit allen relevanten<br />
Akteuren des<br />
Fallbeispiels „Windpark<br />
Zurndorf“) konnten<br />
innerhalb der Forschungsarbeit<br />
auch spezifischeHandlungsrelevanzen<br />
für den kommunalpolitischen<br />
Entscheidungsprozess diskutiert werden.<br />
Unter anderem ging der Autor folgenden<br />
Fragen nach:<br />
◆ Sollen Kommunen den Betrieb von<br />
Windkraftanlagen in ihrem Gemeindege-
Windkraft in Österreich<br />
Die Windkraft, als wichtiger<br />
Teil dieser regenerativenEnergiequellen,<br />
boomt und das<br />
nicht nur in Deutschland,<br />
Spanien und<br />
Dänemark, sondern<br />
auch in Österreich.<br />
biet unterstützen bzw. sogar initiieren<br />
(Anreizpolitik)?<br />
◆ Sollen Kommunen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung<br />
als Betreiber<br />
von Windkraftanlagen auftreten (Dienstleistungspolitik)?<br />
Kommunen als Initiatoren<br />
Im Sinne der Förderung eines nachhaltigen,<br />
umwelt- und sozialverträglichen<br />
Energiesystems, spricht sich der Autor der<br />
Forschungsarbeit dafür aus, dass die<br />
Gemeinden - wie im Beispiel<br />
Zurndorf - die<br />
Errichtung und den<br />
Betrieb von Windkraftanlagen<br />
in ihrem<br />
Gemeindegebiet unterstützen<br />
und auch initiieren<br />
sollen. Die Gemeinden<br />
haben dabei die<br />
Chance, eine Art Katalysatorenfunktion<br />
zu übernehmen,<br />
indem sie<br />
einerseits dafür sorgen,<br />
dass Projektideen entstehen<br />
und/oder dass gesicherteRahmenbedingungen<br />
für Umsetzungsund<br />
Realisierungsprozesse vorhanden<br />
sind (z.B. in Form einer Umwelt- bzw.<br />
Energieplanung, Flächenwidmung etc.).<br />
Die vielfältigen kommunale Gestaltungs-<br />
spielräume können sich im Sinne der Problembearbeitung<br />
nur als hilfreich erweisen.<br />
Es gilt in diesem Politikfeld „neue<br />
Wege“ (auch im Sinne eines New Public<br />
Managements) zu beschreiten, materielle<br />
oder immaterielle Ressourcen zu nutzen,<br />
Akteursnetzwerke zu koordinieren etc.,<br />
um letztendlich potentielle Betreiber für<br />
Allein auf<br />
Grundlage des<br />
Fallbeispiels abzuleiten,<br />
Gemeinden<br />
sollen als Betreiber<br />
auftreten, wäre<br />
geradezu<br />
verwegen.<br />
Bezeichnend für den Einsatz<br />
der Windkraft und auch der<br />
anderen erneuerbaren Energieträger<br />
ist, dass sie vorwiegend<br />
dezentral einsetzbar<br />
und verfügbar sind<br />
den jeweiligen Standort zu gewinnen.<br />
Insbesondere der/die BürgermeisterIn<br />
einer Gemeinde hat, wenn er/sie entsprechend<br />
positiv, flexibel, kreativ und engagiert<br />
agiert, viele Handlungsmöglichkeiten.<br />
Kommunen als Betreiber<br />
Innerhalb des Betriebs von Windkraftanlagen<br />
spielen die Gemeinden heute nur<br />
mehr eine untergeordnete Rolle. Die<br />
momentane Entwicklung läuft dahingehend<br />
hinaus, dass die<br />
Gemeinden nur mehr die<br />
Flächenwidmungsanträge<br />
der Standorte pflichtbewusst<br />
und rasch zu erledigen<br />
haben. Ansonsten haben sie<br />
aber in einer von Betreibergemeinschaften,Großinvestoren<br />
und Energieversorgungsunternehmendominierten<br />
Betreiberwelt nichts<br />
verloren. Zurndorf bildete<br />
eine der wenigen Ausnahmen,<br />
wo eine Gemeinde versucht<br />
hat, als potentieller<br />
Betreiber eines Windparks<br />
aufzutreten.<br />
Allein auf Grundlage des Fallbeispiels<br />
abzuleiten, Gemeinden sollen als Betreiber<br />
auftreten, wäre geradezu verwegen.<br />
Dies darf aber nicht über die Tatsache<br />
hinwegtäuschen, dass der Verfügbarkeit<br />
und technischen Realisierbarkeit der<br />
Windkraftanlagen entsprechend, jetzt<br />
nicht nur größere Städte Energieversorgungsunternehmen<br />
betreiben können,<br />
auch kleinere und mittlere Gemeinden<br />
haben nun die Chance, sich in diesem<br />
Feld der Daseinsvorsorge zu beweisen.<br />
Energie<br />
Jedoch hat gerade das Fallbeispiel „Windpark<br />
Zurndorf“ gezeigt, dass die Wirtschaftlichkeit<br />
des Projekts sehr schwer zu<br />
erreichen war und dass das ökonomische<br />
Risiko für die Gemeinde letztendlich zu<br />
groß gewesen ist. Zudem würden viele<br />
wahrscheinlich den Einwand<br />
erheben, dass es nicht primäre<br />
Aufgabe der <strong>Kommunal</strong>politik<br />
ist, Unternehmen zu betreiben<br />
und dass<br />
unter<br />
Berück-<br />
sichtigung„begrenzter“Gemeindebudgets<br />
und einer<br />
allgemeinenAufgabenüberlastung<br />
eigentlich<br />
noch viel mehr<br />
kommunalpolitische<br />
Tätigkeiten<br />
ausgelagert<br />
gehören (Stichwort:Liberalisierung<br />
der Daseinsvorsorge).<br />
Dieser Argumentationslinie<br />
zur Folge ist im Sinne einer<br />
wirtschaftlichen Projektierung die<br />
Gemeinde auf Kooperationen angewie-<br />
sen, die sich praxisorientiert in drei Bereichen<br />
abspielen können:<br />
◆ Die Gemeinde kooperiert ortsübergreifend<br />
in Form von Gemeindeverbänden<br />
(interkommunale Zusammenarbeit).<br />
Denn die Frage ist: Wieso gibt es Abfallverbände,<br />
Abwasserverbände und Wasserversorgungsverbände<br />
aber keine<br />
Stromversorgungsverbände?<br />
◆ Die Gemeinde kooperiert im Rahmen<br />
von Public Private Partnership Projekten<br />
mit Unternehmen der Privatwirtschaft<br />
und erschließt damit u.a. privates Risikokapital.<br />
◆ Die Gemeinde kooperiert mit der lokalen<br />
oder regionalen Bevölkerung in Form<br />
von Bürgerbeteiligungsmodellen. Diese<br />
Form der Beteiligungsmöglichkeit wirkt<br />
sich vor allem positiv auf die Akzeptanz<br />
eines Windkraftprojekts aus.<br />
Die Arbeit<br />
Gerade das<br />
Fallbeispiel „Windpark<br />
Zurndorf“ hat<br />
gezeigt, dass die<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
des Projekts sehr<br />
schwer zu erreichen<br />
war und dass das<br />
ökonomische Risiko<br />
für die Gemeinde<br />
letztendlich zu groß<br />
gewesen ist.<br />
Scherhaufer, Patrick: „Möglichkeiten und<br />
Grenzen einer lokalen umweltverträglichen<br />
Energieversorgungspolitik“. Aufgezeigt<br />
am Beispiel des Windparks in der<br />
Gemeinde Zurndorf (Bgld.), Dipl.-Arb.,<br />
Universität Wien 2002, Eingereicht beim<br />
„Preis der Kommunen 2003“<br />
KOMMUNAL 51
Wirtschafts-Info<br />
TerraTec – Intern. Fachmesse für Umwelttechnik und Umweltdienstleistungen<br />
Geschäftsmöglichkeiten in Osteuropa<br />
Die Transformationsprozesse in der<br />
Umweltwirtschaft Osteuropas und die<br />
daraus erwachsenden Geschäftsmöglichkeiten<br />
für die westeuropäische<br />
Industrie und Dienstleister bilden im<br />
nächsten Jahr einen Schwerpunkt der<br />
Internationalen Fachmesse für Umwelttechnik<br />
und Umweltdienstleistungen<br />
TerraTec. Stärker als bisher thematisiert<br />
die Leipzieger Fachmesse (8. bis 11.<br />
März 2005) das Flächenrecyling, geoinformationsgestützteBranchenlösungen/Regionalplanung<br />
und Konzepte<br />
zum präventiven Hochwasserschutz.<br />
Mit Veranstaltungen zum Kyoto-Protokoll<br />
und zur Europäischen Wasserrah-<br />
������ �������<br />
��������� ���� �������� ���� ��������� ����<br />
������� ������� ����� ����� ������ ����� ���<br />
������� ������ ������� ��� ��������<br />
������������������������� ������������<br />
�����������<br />
������ �������� ��������� ������ ���� ������<br />
�������� ������������������������������<br />
��������������������������������������<br />
�������������������<br />
52 KOMMUNAL<br />
Blickfang in der Glashalle – Entsorgungsfahrzeuge<br />
auf der TerraTec<br />
menrichtlinie greift die TerraTec weitere<br />
aktuelle Fragen auf, die in der<br />
Umweltbranche diskutiert werden. „Die<br />
TerraTec ist für Hersteller und Dienstleister,<br />
die Kunden in den neuen Bundesländern<br />
und in Osteuropa gewinnen<br />
und halten wollen, unverzichtbar“, ist<br />
Dr. Deliane Träber, Bereichsleiterin bei<br />
der Leipziger Messe, überzeugt.<br />
Informationen:<br />
Leipziger Messe GmbH<br />
PF 10 07 20<br />
Messe-Allee 1<br />
D-04007 Leipzig<br />
Tel.: +49 (0) (341) 678 81 81<br />
www.terratec-leipzig.at<br />
Die neue Hyster Baureihe J1.60-2.00XMT ACX<br />
Eine sichere Wahl für Fahrer und Anwender<br />
Anlässlich des 75-jährigen Bestehens von<br />
Hyster als Produzent hochwertiger Flurförderfahrzeuge<br />
wird eine neue Serie<br />
von Dreirad-Elektrogabelstaplern mit<br />
Frontantrieb auf den Markt gebracht: die<br />
neue Baureihe J1.60-2.00XMT ACX. Mit<br />
einem breiten Angebot für Fahrer ebenso<br />
wie Anwender verbindet sie die Erfahrungen<br />
und das Know-how des Unternehmens<br />
mit modernster Drehstromund<br />
CANbus-Technologie und vorbildlicher<br />
Ergonomie.<br />
Die neuen Stapler zeichnen sich durch<br />
bewährte Hyper-Zuverlässigkeit aus<br />
und sind für ein 1000-Stunden-Serviceintervall<br />
bei den meisten Hauptkomponenten<br />
ausgelegt. Die neue Baureihe<br />
bietet den Anwendern die Wahl zwischen<br />
einer Drehstromoption für lange<br />
Arbeitsschichten und einer Option für<br />
zusätzliche Drehstromleistung.<br />
Eine weitere Besonderheit der Baureihe<br />
ist die propertionale Traktionssteuerung,<br />
die enge Kurvenfahrten ohne Leistungsverlust<br />
ermöglicht.<br />
Ein Stapler der<br />
Sicherheit gibt<br />
Nach den individuellen Bedürfnissen<br />
des Fahrers sind Lenksäule und Sitz verstellbar.<br />
In der e-hydraulischen Armlehne<br />
sind Einstellelemente und Mini-<br />
hebel integriert, sodass der Fahrer den<br />
Stapler jederzeit sicher im Griff hat. Das<br />
auch bei schlechten Lichtverhältnissen<br />
gut lesbare Armaturenbrett ermöglicht<br />
die Wahl zwischen vier vorprogrammierten<br />
Leistungsstufen.<br />
Informationen:<br />
Zeppelin Österreich GmbH<br />
Zeppelinstraße 2<br />
2401 Fischamend<br />
Tel.: 02232/ 790 - 292<br />
Fax: 02232/ 790 - 262<br />
E-Mail: margit.greven@<br />
zeppelin-hyster.at<br />
www.zeppelin-hyster.at<br />
�����������<br />
����<br />
���������<br />
���<br />
���������������<br />
����������� ���<br />
�����������<br />
����� ���<br />
�������������<br />
��� ���������<br />
���������<br />
����������<br />
���������<br />
�����������<br />
E.E.<br />
E.E.
Entscheidung zur Behandlung von Public Private Partnerships<br />
Demnach kann der Finanzierungsvorteil<br />
der öffentlichen Hand genutzt werden:<br />
Entscheidend bei der Verbuchung von<br />
PPPs ist nämlich die Risikoverteilung<br />
zwischen Staat und privat.<br />
Übernimmt der private Partner im Rahmen<br />
eines PPPs die alleinige Verantwortung<br />
für die Finanzierung, so steigen die<br />
Finanzierungskosten des Projektes deutlich.<br />
Grund sind die gegenüber dem Staat<br />
schlechtere Bonität des privaten Partners<br />
sowie die bankaufsichtsrechtlich vorgesehenen<br />
höheren Eigenmittelunterlegungskosten<br />
der finanzierenden Bank.<br />
Nach der jüngsten Eurostat-Entscheidung<br />
kann der Finanzierungsvorteil<br />
weitgehend genutzt werden, da das<br />
Entscheidungskriterium für die Zuordnung<br />
eines Public Private Partnerships<br />
auf den Sektor Staat oder den privaten<br />
Sektor nicht in einer finanziellen Beteiligung<br />
der öffentlichen Hand sondern in<br />
der Verteilung der Risken zwischen den<br />
beiden Partnern liegt. Laut Eurostat<br />
werden öffentlich-private Partnerschaften,<br />
bei denen der private Partner den<br />
Großteil des Risikos trägt, diesem auch<br />
zugeordnet und haben somit keine<br />
direkten Auswirkungen auf Maastricht-<br />
Defizit und Gesamtverschuldung des<br />
Staates. Eurostat hat diesbezüglich folgende<br />
Regel definiert: Wenn der private<br />
Partner das „Baurisiko“ und zusätzlich<br />
entweder das „Ausfallsrisiko“ oder das<br />
„Nachfragerisiko“ trägt, werden Vermögenswerte,<br />
die Gegenstand einer öffentlich-privaten<br />
Partnerschaft sind, nicht<br />
dem Sektor Staat zugeordnet.<br />
Baurisiko<br />
Unter Baurisiko versteht Eurostat insbesondere<br />
Fälle wie verspätete Lieferung,<br />
die Nichteinhaltung vorgegebener Standards,<br />
zusätzliche Kosten, technische<br />
Mängel und externe negative Effekte.<br />
Verpflichtet sich der Staat, Zahlungen<br />
ohne Berücksichtigung des tatsächlichen<br />
Zustandes des Vermögenswertes<br />
zu leisten, wäre dies ein Indiz für die<br />
Zuordnung des Baurisikos an den Staat.<br />
Ausfallsrisiko<br />
Das Ausfallsrisiko besteht, wenn der<br />
Partner nicht in der Lage ist, die vertraglich<br />
vereinbarte Menge zu liefern,<br />
oder die Sicherheitsnormen, die öffentlichen<br />
Zertifizierungs- bzw. vertraglich<br />
fixierten Qualitätsstandards im Zusammenhang<br />
mit der Erbringung der Leistung<br />
einzuhalten. In diesem Fall muss<br />
der Staat berechtigt sein, seine vertraglich<br />
vereinbarten Zahlungen entsprechend<br />
den tatsächlich erbrachten Leistungen<br />
kürzen zu können, damit man<br />
von der privaten Trägerschaft des Risikos<br />
ausgehen kann.<br />
Nachfragerisiko<br />
Das Nachfragerisiko umfasst Nachfrageschwankungen,<br />
die nicht dem Verhalten<br />
des privaten Partners zuzuschreiben<br />
sind. Sie sind auf Faktoren wie Konjunkturzyklus,<br />
Markttrends oder direkten<br />
Wettbewerb zurückzuführen. Auch hier<br />
wären Zahlungen des Staates, die nicht<br />
Wirtschafts-Info<br />
Maastricht-Relevanz<br />
von PPPs<br />
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, hat kürzlich entschieden, wie<br />
Public Private Partnerships (PPPs) in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu<br />
verbuchen sind.<br />
Finanzierungsvorteil der öffentlichen<br />
Hand kann bei PPPs nun genutzt werden.<br />
auf diese Nachfrageschwankungen reagieren<br />
würden, ein Indiz, dass dieses<br />
Risiko vom Staat getragen wird.<br />
Finanzierungsvorteil<br />
Die neue Eurostat-Entscheidung ermöglicht<br />
nun – sofern der Private das Baurisiko<br />
und mindestens das Ausfallsrisiko<br />
oder Nachfragerisiko trägt – dass im<br />
Rahmen von PPPs auch der Finanzierungsvorteil<br />
der öffentlichen Hand<br />
genutzt werden kann, ohne dass es zu<br />
einer Zuordnung des PPPs zum Sektor<br />
Staat kommt. Zum einen kann der Staat<br />
direkt einen (jedoch nicht überwiegenden)<br />
Teil des Projektes finanzieren, zum<br />
anderen kann er für die vom privaten<br />
Partner bereitgestellte Gesamtfinanzierung<br />
des Projektes durch die Übernahme<br />
einer Haftung seine Bonität und<br />
somit seinen Finanzierungsvorteil zur<br />
Verfügung stellen.<br />
Details zur Eurostat-Entscheidung sind<br />
im Artikel „Die Maastricht-Relevanz<br />
von Public Private Partnerships“ der<br />
aktuellen <strong>Ausgabe</strong> der Fachzeitschrift<br />
„RFG - Rechts- und Finanzierungspraxis<br />
der Gemeinden“ zu finden. Interessenten<br />
können die RFG unter der Bestellhotline<br />
01/53161-100 erwerben (Sonderkonditionen<br />
für Gemeinden).<br />
Informationen:<br />
<strong>Kommunal</strong>kredit Austria AG<br />
Dipl.-Ing. Wolfgang Viehauser<br />
Abteilungsleiter-Stellvertreter<br />
Finanzierungen<br />
Mag. Wolfgang Meister<br />
Leiter Wirtschaftspolitik & Recht<br />
Türkenstraße 9, 1092 Wien<br />
Tel.: 01/31 6 31-0<br />
Fax: 01/31 6 31-503<br />
E-Mail:<br />
kommunal@kommunalkredit.at<br />
KOMMUNAL 53<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Infrapool – Vereinigung für Stadt- und Standortmarkteting<br />
Erste Stadtmarketing-Tagung in Tirol<br />
Die Ungewissheit vor der dritten österreichischen<br />
BID-Tagung am 3. Juni in<br />
Innsbruck war groß, ob genügend<br />
Teilnehmer für das Thema Stadtmarketing<br />
im Westen Österreichs zu mobilisieren<br />
sind. Der Erfolg gab Infrapool<br />
recht, die gemeinsam mit der Landeshauptstadt<br />
Innsbruck und dem Innsbruck<br />
Marketing erstmals eine solche<br />
Veranstaltung in Tirol<br />
organisierten.<br />
BID-Methode<br />
vorgestellt<br />
Kernpunkt der Tagesveranstaltung<br />
war die<br />
Belebung der Innenstädte<br />
mit der BID-<br />
Methode unter erstmaliger<br />
breiter Einbindung<br />
der Liegenschaftseigentümer<br />
in<br />
die Planung und<br />
Umsetzung der<br />
Projekte. Von den Teil-<br />
54 KOMMUNAL<br />
nehmern wurden die Liegenschaftseigentümer<br />
immer wieder als Knackpunkt<br />
für die erfolgreiche Umgestaltung<br />
der Innenstadt genannt. Oft ist die<br />
Gesprächsbasis zwischen Gemeinde<br />
und einzelnen Liegenschaftseigentümern<br />
schon vorbelastet, sodass inhaltlich<br />
keine Fortschritte erzielt werden.<br />
Die Notwendigkeit von externen Mode-<br />
Erstmals war Tirol Tagungsort zum Thema Stadtmarketing.<br />
ratoren und Umsetzern ist dadurch<br />
umso mehr gegeben.<br />
Mehr ins Detail<br />
Da auf der Tagung die Grundzüge der<br />
BID-Methode vorgestellt werden<br />
konnte, wird es zu weiteren<br />
Gesprächen mit den interessierten<br />
Städten kommen. Eines ist sicher: Jene<br />
Städte, die ein solches Dreijahresprogramm<br />
mit vollem Engagement durchziehen,<br />
erfahren eine enorme Standortaufwertung.<br />
Durch die entstehenden<br />
Planungen der Stadtgemeinde gewinnen<br />
auch die privaten Investoren Vertrauen<br />
in den Standort Innenstadt und<br />
bringen sich in die Projekte ein.<br />
Informationen:<br />
Infrapool – Vereinigung für Stadtund<br />
Standortmarketing e.V.<br />
Mag. Christian Schaffner<br />
Tel.: 0699/ 19 44 94 05<br />
schaffner@infrapool.com<br />
www.infrapool.com<br />
Kundler Landmaschinenhersteller investiert drei Millionen in neues Zentrallager<br />
Lindner weiter auf Erfolgskurs<br />
Beim Kundler Landmaschinenhersteller<br />
Lindner stehen die Zeichen<br />
auf Investition. „Wir errichten<br />
im laufenden Geschäftsjahr<br />
ein neues Zentrallager am kürzlich<br />
erworbenen Areal nahe dem<br />
Ausstellungszentrum in Kundl.<br />
Das Investitionsvolumen dafür<br />
beträgt drei Millionen Euro“,<br />
erklärt Firmenchef Hermann<br />
Lindner. Darüber hinaus werde<br />
aufgrund der um mehr als zehn<br />
Prozent gestiegenen Produktion<br />
die Montagehalle erweitert. Lindner<br />
hat im Geschäftsjahr<br />
2003/2004 insgesamt 1280<br />
Modelle der Marke Geotrac sowie 145<br />
Unitrac-Transporter verkauft.<br />
Umsatz lag im Vorjahr<br />
bei 48,5 Millionen Euro<br />
Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete<br />
Lindner einen Umsatz von<br />
48,5 Millionen Euro. Das ist im Vergleich<br />
zum Vorjahr eine Steigerung von<br />
Neben dem Grün- und Berglandsegment bietet<br />
Lindner vermehrt Pflege- und Weinbautraktoren<br />
sowie für kommunale Einsätze den Unitrac an.<br />
15 Prozent. Hermann Lindner: „Auch<br />
im Auslandsgeschäft konnten wir<br />
Erfolge verbuchen: Der Exportanteil<br />
stieg von 25 auf 28 Prozent. Wichtigste<br />
Absatzmärkte sind Deutschland, die<br />
Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien<br />
sowie die Niederlande. Das Kundler<br />
Unternehmen beschäftigt 190 Mitarbeiter.<br />
In den ersten vier Monaten 2004<br />
erreichte Lindner in Österreich einen<br />
Marktanteil von 15,2 Prozent. „Wir<br />
Foto: Lindner<br />
konnten damit die dritte Position am<br />
Traktorenmarkt deutlich ausbauen.“<br />
Konzentration auf<br />
weitere Einsatzgebiete<br />
Neben der Spezialisierung auf den<br />
Grünlandbereich konzentriert sich Lindner<br />
verstärkt auf weitere Einsatzgebiete:<br />
„Neben dem Grün- und Berglandmarktsegment<br />
bieten wir vermehrt Pflegeund<br />
Weinbautraktoren sowie für kommunale<br />
Einsätze den Unitrac. Dieser<br />
wird oft als kleiner Bruder des Unimog<br />
bezeichnet“, so der Firmenchef. Derzeit<br />
verfügt Lindner in Österreich über 250<br />
Vertragshändler, rund 100 Händler vertreiben<br />
Lindner-Fahrzeuge im Ausland.<br />
Informationen:<br />
Lindner Traktorenwerk GesmbH<br />
A-6250 Kundl<br />
Tel.: 05338/ 74 20 - 0<br />
Fax: 05338/ 74 20 - 41<br />
www.lindner-traktoren.at<br />
E.E.<br />
E.E.
Neu: Mobiler Mastsockel von Mannus<br />
Formschön und<br />
funktional<br />
Wirkungsvoller Fahnenschmuck ist ein<br />
fixer Bestandteil bei den verschiedensten<br />
Veranstaltungen. Sonnleithner-<br />
MANNUS - Österreichs Marktführer bei<br />
Fahnenstangen - unterstützt sie bei Feierlichkeiten<br />
wie Eröffnungen, Schul-<br />
oder Stadtfesten mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten.<br />
Speziell Leihfahnenmasten und mobile<br />
Mastsockeln von MANNUS kommen<br />
hier zum Einsatz. Die flexiblen Mastsockeln<br />
aus verzinktem Stahlblech, die<br />
auch pulverbeschichtet erhältlich sind,<br />
können mit Wasser, Sand oder Erde<br />
befüllt werden. Die Füße der Wanne<br />
sind einzeln höhenverstellbar, was -<br />
zusätzlich zum Füllvolumen von rund<br />
600 Litern - absolute Standfestigkeit<br />
garantiert.<br />
Der große Vorteil dieser formschönen<br />
Behältnisse: im Alltag erfüllen sie die<br />
Funktion von Blumentrögen, die zur<br />
Verschönerung von Plätzen beitragen.<br />
BEWAG: Österreichs größter Windstromproduzent<br />
Im Aufwind<br />
Die kräftige Brise auf der Parndorfer<br />
Platte macht die BEWAG zu Österreichs<br />
größtem Windstromproduzenten<br />
und das Burgenland zu einer wahren<br />
Ökoregion.<br />
Wind-Offensive<br />
Im Frühjahr des vergangenen Jahres<br />
startete die BEWAG mit ihrer Tochter<br />
Austrian Wind Power eine Wind-<br />
Offensive. 2003 wurden 200 Millionen<br />
Euro investiert, heuer folgen weitere<br />
50 Millionen. Ergebnis: Als Österreichs<br />
größter Windstrom-Produzent speist<br />
die BEWAG täglich bis zu 3,8 Millionen<br />
Kilowattstunden Ökostrom ins<br />
Netz ein.<br />
Auch die burgenländische Landespolitik<br />
unterstützt die Wind-Offensive.<br />
Wenn alle geplanten Projekte realisiert<br />
werden, können damit zwei Drittel<br />
des burgenländischen Strombedarfes<br />
gedeckt werden. Mit der Fertigstellung<br />
des Windparks Kittsee durch den<br />
bewährten Anlagenlieferanten ENER-<br />
CON wurde bereits in diesem Juni die<br />
Hälfte des Zieles erreicht.<br />
Blumentrog mit<br />
integrierter Masthalterung<br />
gibt es<br />
als vier- und sechseckige<br />
Variante<br />
Und bei Festen werden sie ohne Aufwand<br />
zu Fahnenmasthalterungen aufgewertet.<br />
Somit sind festlich geschmückte Ortsplätze<br />
zum 1. Mai und 26. Oktober<br />
gesichert.<br />
Informationen:<br />
Sonnleithner-MANNUS, A-4461<br />
Laussa<br />
Tel. 0 72 55 / 73 11<br />
E-Mail office@<br />
sonnleithner.at<br />
ENERCON E-66 Windenergie-Anlagen<br />
Informationen:<br />
ENERCON Austria GmbH<br />
Hauptstraße 19<br />
A-2120 Wolkersdorf bei Wien<br />
Tel. 02245/82828<br />
Fax 02245/82838<br />
E.E. E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
KOMMUNAL 55
Wirtschafts-Info<br />
BAWAG – P.S.K. Gruppe<br />
Auswirkungen von<br />
Basel II auf Gemeinden<br />
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat sich auf neue Richtlinien für die<br />
Absicherung von Kreditrisiken von Banken mit Eigenkapital und einen Zeitplan zur<br />
Einführung geeinigt. Das Basel-II-Abkommen soll Ende 2006 in Kraft treten. Die<br />
Richtlinien müssen nun in nationale Regelungen umgesetzt werden.<br />
Banken sind verpflichtet, Bilanzen zu<br />
verlangen und diese zu raten.<br />
56 KOMMUNAL<br />
Mit Basel II müssen die<br />
Banken künftig die<br />
Eigenkapitalunterlegung<br />
von Krediten stärker<br />
von der Bonität<br />
ihrer Kunden abhängig<br />
machen. Die Bonität<br />
eines Kunden wird<br />
durch dessen Rating<br />
ausgedrückt. Nachdem<br />
ein Großteil der österreichischen<br />
Gemeinden kein externes Rating einer<br />
anerkannten Ratingagentur wie<br />
Moody`s oder S&P vorweisen kann,<br />
müssen die Kreditinstitute ein internes<br />
Rating vergeben und danach unter<br />
Berücksichtigung allfälliger Sicherheiten<br />
die Risikogewichtung und die erforderliche<br />
Eigenmittelunterlegung<br />
berechnen.<br />
Transparenz durch<br />
Vereinheitlichung<br />
Die Bonität<br />
eines Kunden<br />
wird durch<br />
dessen Rating<br />
ausgedrückt.<br />
Eine Möglichkeit die für das Rating von<br />
Kommunen wichtigen Daten und Kennzahlen<br />
transparenter und vergleichbarer<br />
zu gestalten, wäre die Vereinheitlichung<br />
der Rechnungsunterlagen und sonstigen<br />
Vorschriften in allen Bundesländern. In<br />
Vorarlberger Gemeinden wird zum Beispiel<br />
oft keine Trennung zwischen dem<br />
ordentlichen und dem außerordentlichen<br />
Haushalt vorgenommen. Aus diesem<br />
Grund können aus den vorliegenden<br />
Gebarungsübersichten keine mit<br />
anderen Bundesländern vergleichbaren<br />
Durchschnittswerte (Kennziffern) ermittelt<br />
werden. Auch der Schuldendienst<br />
wird von Bundesland zu Bundesland<br />
unterschiedlich ausgewiesen (mit oder<br />
ohne Bedeckung).<br />
Neben den sogenannten<br />
„hard facts“ eines Scorings<br />
(Bewertung) durch Kennzahlen<br />
können beim<br />
Gemeinderating auch qualitative<br />
Kriterien berücksichtigt<br />
werden. Hierzu zählt<br />
zum Beispiel, dass alle<br />
Gebietskörperschaften den<br />
strengen Maastrichtkriterien<br />
unterliegen und das Land Träger der<br />
Rechtsaufsicht über die Kommunen ist.<br />
Verpflichtung der Banken<br />
Die Banken sind durch die Basel II<br />
Bestimmungen und das Bankwesengesetz<br />
verpflichtet, sowohl vor Krediteinräumung<br />
als auch während der<br />
Laufzeit eines Engagements Rechnungsabschlüsse<br />
bzw. Bilanzen<br />
zumindest von allen nicht extern<br />
gerateten Gebietkörperschaften zu<br />
verlangen und diese zu raten.<br />
In diesem Zusammenhang wird auch<br />
die Offenlegung von Haushaltsunterlagen<br />
und -daten die Basis für Konditionenofferte<br />
bei Finanzierungsausschreibungen<br />
sein.<br />
Informationen:<br />
Wolfgang Widholm<br />
Österreichische Postsparkasse AG<br />
Bereich Institutionelle Kunden &<br />
Öffentliche Hand<br />
Georg-Coch-Platz 2<br />
1018 Wien<br />
Tel.: 01/51400-43869<br />
Fax.: 01/51400-41756<br />
E-Mail: wolfgang.widholm@psk.at<br />
E.E.
In zeitgerechten Versorgungsmaßnahmen<br />
liegt ein einormes Einsparungspotential<br />
zugunsten des gesamten<br />
Gesundheitssystems. Regelmäßige körperliche<br />
Aktivität durch Bewegung und<br />
Sport verlängert das Leben, macht es<br />
lebenswerter, hält fit und macht mobil<br />
bis ins hohe Alter.<br />
Das Projekt „Fit für Österreich“ versteht<br />
sich als Dachmarke für eine Projektreihe,<br />
die unter dem Motto „für ein<br />
lebenslanges Sporttreiben – der Sport<br />
als Dienstleister im Gesundheitssystem“<br />
steht. Mit diesem Projekt will das<br />
Staatssekretariat für Sport auf das<br />
Potential des organisierten Sport in<br />
Österreich als Dienstleister im Gesund-<br />
Wirtschafts-Info<br />
Dünserberg ist die erste österreichische Gemeinde mit...<br />
..auschließlich solarer Beleuchtung<br />
Ein sehr innovatives Beleuchtungsprojekt<br />
wurde in Dünserberg<br />
(Vorarlberg) durch<br />
die Firma „ecoliGhts“ in<br />
Zusammenarbeit mit Bürgermeister<br />
Walter Rauch realisiert.<br />
Die Gemeinde Dünserberg<br />
hat etwa 150 Einwohner<br />
und liegt zwischen 1000<br />
und 1200 Meter Seehöhe. Es<br />
gibt 3 Teilortschaften die ca.<br />
1 Kilometer von einander<br />
getrennt sind. Im ersten Projektabschnitt<br />
wurde das<br />
Straßengebiet entlang des<br />
Gemeindehauses, Feuerwehr<br />
und Volksschule (ca. 500 Meter) mit 8<br />
Stück Solarleuchten „SPL150“ bestückt.<br />
Die Straßenbeleuchtung war ein großes<br />
Gemeindeanliegen, da in den Morgenstunden<br />
Schulkinder unterwegs sind<br />
und in den Abendstunden häufig Veranstaltungen<br />
im Gemeindesaal stattfinden.<br />
Eine herkömmliche am öffentlichen<br />
Stromnetz angeschlossene Beleuchtung<br />
hätte nur schwer mit aufwendigen Grabungsarbeiten<br />
realisiert werden können.<br />
Dünserberg: Die<br />
Straßenbeleuchung ist<br />
ausschließlich autark.<br />
heitssystem aufmerksam<br />
machen, vorhandene<br />
gesundeheitsfördernde<br />
Potentiale ausschöpfen und<br />
neue Wege zur Reduktion<br />
der Krankheitskosten und<br />
zur Entlastung des Gesundheitssystems<br />
aufzeigen.<br />
„SportKids“<br />
Unsere Kinder leiden<br />
immer mehr unter Bewegungsmangel,<br />
der Ursache<br />
für Unfälle, Verletzungen<br />
und Krankheiten ist. In enger<br />
partnerschaftlicher Zusammenarbeit<br />
mit Kindergärten, Schulen und<br />
Sportvereinen sollen motorische Defizite<br />
behoben und ausreichende Bewegung<br />
gesichert werden.<br />
„Fit für School“<br />
Schülerinnen und Schüler sollen<br />
zusätzlich zum regulären Turnunterricht<br />
weitere Bewegungs-, Spiel- und<br />
Sportangebote in der Schule erhalten.<br />
Die sportliche Betätigung stellt eine<br />
nachhaltige Nachmittagsbetreuung und<br />
sinnvolle Alternative zum „computermotivierten<br />
Stubenhockerdasein“ dar.<br />
Schon am Tag der Montage<br />
war man beeindruckt über<br />
die robuste und formschöne<br />
Bauart der Leuchten. Besonders<br />
begeistert ist man von<br />
der sehr guten Ausleuchtung<br />
der Straße. Zusätzlich<br />
gibt der Hersteller die<br />
Garantie, dass die tägliche<br />
Leuchtzeit der Lampen auch<br />
in den Wintermonaten mindestens<br />
8 Stunden beträgt.<br />
Die Beleuchtung von 500<br />
Meter Gemeindestraße<br />
inklusive Fundamentarbeiten<br />
wurde in nur 2 Tagen<br />
realisiert. Die Gesamtkosten belaufen<br />
sich auf rund 30.000 Euro. Die Investition<br />
gegenüber Netzstrom-Beleuchtung<br />
hat sich schon bei der Installation<br />
gerechnet. Zusätzlich erspart sich die<br />
Gemeinde auch die anfallenden Stromkosten<br />
der Straßenbeleuchtung, das sind<br />
für 8 Leuchten in 20 Jahren ca.<br />
15.000,00 Euro!<br />
Die Firma ecoliGhts beschäftigt sich seit<br />
3 Jahren sehr intensiv mit der Entwick-<br />
Sport Kids: Gesund durch Bewegung<br />
„Fit für Business“<br />
Berufstätige Erwachsene können durch<br />
Sport ihre Leistungsfähigkeit und damit<br />
ihr Selbstbewußtsein stärken. Gesundheitsfördernde<br />
Modelle, mit der<br />
Geschäftsleitung vereinbart, sollen zu<br />
lebenslangem Sporttreiben motivieren.<br />
Informationen:<br />
Staatsekretariat für Sport<br />
www.fitfueroesterreich.at<br />
Tel.: 01/ 531 15/ 4063<br />
lung und der Herstellung von solaren<br />
Beleuchtungsanlagen.<br />
Einfach und<br />
nachhaltig<br />
Entscheidend ist der Einsatz von sehr<br />
stromsparenden Leuchtmittel und speziellen<br />
Regelungen. Wichtig ist natürlich<br />
auch die ansprechende Optik der Leuchten,<br />
mit diesen Faktoren werden sehr<br />
innovative Produkte auf den Markt<br />
gebracht. Hauptziel der Firma ecoliGhts<br />
ist es „die einfache und nachhaltige<br />
Beleuchtungslösung“ anbieten zu können,<br />
die auf Sicht Kosten spart und auch<br />
mehr Sicherheit im Straßenverkehr gibt!<br />
Informationen:<br />
ecoligGhts/ Georg Dietmaier<br />
A-8740 Zeltweg, Bundesstraße 66<br />
Tel.: 03577/ 758 660, Fax: 758 662<br />
Mobil: 0664/ 314 83 53<br />
E-Mail: info@ecolights.at<br />
Web: www.ecolights.at<br />
KOMMUNAL 57<br />
E.E. E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Energiecomfort bietet Gemeinden maßgeschneiderte Lösungen<br />
Kommunen setzen<br />
auf Biomasse<br />
Vom instabilen Ölpreis sind zahlreiche Branchen betroffen. Auch der kleinste Mann<br />
in der kleinsten Gemeinde muss sich darüber Gedanken machen, welche<br />
Kostenexplosion ihn durch den Anstieg des Ölpreises erwarten könnte.<br />
Die Wien Energie-Tochter ENERGIE-<br />
COMFORT setzt schon seit einiger Zeit<br />
auch auf nicht fossile Energieträger wie<br />
z.B. Biomasse.<br />
Kostengünstig und<br />
umweltfreundlich<br />
Energiecomfort bietet Gemeinden<br />
vollständige Planung, Finanzierung<br />
Errichtung sowie die Betriebsführung<br />
von Ortswärmenetzen mit dem erneuerbaren<br />
Energieträger Holz aus der<br />
So funktioniert Ortswärme-Versorgung.<br />
jeweiligen Region.<br />
Dies sichert nicht nur dem einzelnen<br />
Bürger komfortable Wärme, schafft<br />
Arbeitsplätze in der Region, sondern<br />
zeigt den Kommunen den Weg der<br />
Umweltentlastung durch Schadstoffreduktion<br />
auf, die besonders in Zeiten<br />
wie diesen jeder Gemeinde ein Anliegen<br />
ist. Das Unternehmen, das zur Zeit<br />
111 MitarbeiterInnen beschäftigt und<br />
auf dem Markt nicht nur durch Ener-<br />
58 KOMMUNAL<br />
gie- sondern auch durch sein florierendes<br />
Gebäude- und Facilitymanagement<br />
bekannt ist, hat erst kürzlich wieder –<br />
anlässlich des Städtetages in Bregenz –<br />
kommunale Manager über die Vorteile<br />
von Biomasse beraten.<br />
ENERGIECOMFORT prüft<br />
gratis für Gemeinden<br />
ENERGIECOMFORT betreibt bereits<br />
erfolgreich Biomasseheizwerke in Bad<br />
Aussee, Tannheim in Tirol und steht<br />
kurz vor der Eröffnung eines<br />
solchen in Purkersdorf bei<br />
Wien. In zahlreichen anderen<br />
Kommunen führt das Unternehmen<br />
zur Zeit eine Plausibilitätsprüfung<br />
durch, um sicherzustellen,<br />
ob und in welchem<br />
Maße ein solches Projekt für<br />
die jeweilige Region wirtschaftlich<br />
ist. Dieser Service<br />
sowie Informationsveranstaltungen,<br />
bei denen jedes einzelne<br />
Gemeindemitglied in<br />
Hinblick auf seine spezifischen<br />
Bedürfnisse beraten sowie für<br />
jeden Interessenten eine Heizkostenvergleichsrechnung<br />
angestellt wird, wird gratis<br />
angeboten.<br />
Alles aus einer Hand...<br />
ist nicht zufällig der Slogan von ENER-<br />
GIECOMFORT. Auch im Falle der Ortswärme-Versorgung<br />
trifft dieser konkret<br />
zu. Zusätzlich zu Information, Wirtschaftlichkeitsprüfung,Konzepterstellung,<br />
Errichtung und Betriebsführung,<br />
werden auch alle Investitionen unter<br />
der ausschließlichen Verantwortung<br />
von ENERGIECOMFORT, jedoch in<br />
Biomasse – DIE Energiequelle.<br />
ständiger Abstimmung mit der<br />
Gemeinde durchgeführt, wodurch<br />
deren Budget maßgeblich entlastet<br />
wird.<br />
Darüber hinaus sorgt die Wien Energie-<br />
Tochter für die Förderungsabwicklung,<br />
die Vertragserstellung sowie die direkte<br />
Abrechnung mit den Kunden, die an<br />
ein Ortswärmenetz angeschlossen sind.<br />
Ein besonderes Zuckerl sind außerdem<br />
Contracting-Modelle für Gemeindeobjekte<br />
ebenso wie für private Immobilien,<br />
bei denen die Finanzierung der<br />
Investitionen aus den eingesparten<br />
Energiekosten erfolgt. Auch Gemeinden<br />
müssen sich heutzutage auf ihr Kerngeschäft<br />
konzentrieren und schätzen<br />
daher die Alles-aus-einer-Hand-Verantwortlichkeit<br />
von ENERGIECOMFORT.<br />
Informationen:<br />
ENERGIECOMFORT<br />
Energie- und Gebäudemanagement<br />
GmbH<br />
Obere Donaustraße 63<br />
1020 Wien<br />
Tel.: +43/1/313 17 3669<br />
Fax: +43/1/313 17 3636<br />
eva.petermann@energiecomfort.at<br />
E.E.
Österreischisches Qualitätsprodukt für die Straßenreinigung.<br />
Alpine Bau setzt auf Qualität<br />
Straßenreinigung<br />
mit M-U-T<br />
Die Alpine Bau Salzburg,<br />
die europaweit zu den<br />
größten Baufirmen zählt,<br />
vertraut bei der Straßenreinigung<br />
auf die Technik von<br />
M-U-T Stockerau.<br />
Harte Tests: M-U-T<br />
klarer Sieger<br />
Zahlreiche Kehrmaschinenprodukte<br />
wurden im härtesten<br />
Einsatz von den Experten<br />
der Alpine Bau getestet<br />
und ging M-U-T als eindeutiger<br />
Sieger hervor.<br />
Die M-U-T Austrocleaner 247<br />
/ 7,0 RS überzeugte insbesondere<br />
durch die extrem<br />
hohe Saugleistung, aber auch<br />
durch die kompakte Bauart<br />
bei der bei optimaler Wendigkeit<br />
ein Maximum an Wassertankgröße<br />
und Schmutzbehältergröße<br />
sichergestellt<br />
ist. Weiters zahlreiche ausgereifte<br />
und anwenderfreundliche<br />
Zubehörteile, die speziell<br />
hinsichtlich Wartung und Reinigung<br />
der Maschine dem<br />
Betreiber echten praktischen<br />
Nutzen bringen.<br />
Highlights<br />
◆ komplett rostfreier Aufbau<br />
◆ 7 m 3 Kehrichtbehälter<br />
◆ 2 x 1700 l Wassertank<br />
◆ Heckteil ausgeführt für<br />
Anhängerbetrieb, daher starkes<br />
Fahrgestell mit 330 PS<br />
◆ Aufkratzvorrichtung teleskopierbar<br />
◆ Hochdruckanlage (120<br />
bar, 120 l/min)<br />
◆ Schlauchaufwicklung mit<br />
Hochdruckpistole<br />
◆ Straßenwaschbalken<br />
vorne über die gesamte<br />
Fahrzeugbreite montiert und<br />
zusätzlich auf der rechten<br />
Seite ausziehbar - damit vergrößerte<br />
Waschbreite<br />
◆ Waschbalken links /<br />
rechts schwenkbar<br />
◆ Moderne äußerst bedienfreundliche<br />
Steuerung<br />
◆ Hochleistungsgebläse<br />
Zufriedene<br />
Kunden<br />
Neben den Stammkunden,<br />
wie beispielsweise die<br />
Gemeinde Bruck / Mur,<br />
Waidhofen oder Heidenreichstein,<br />
konnten zur<br />
Frühjahrskehrung 2004<br />
auch zwei Neukunden aufgrund<br />
der hervorragenden<br />
Vergleichswerte gewonnen<br />
werden. Und zwar die Baufirma<br />
Gebr. Haider, die in<br />
Oberösterreich und der Steiermark<br />
aktiv ist, und die<br />
Firma Huber - Entsorgung in<br />
Feldkirchen in Kärnten.<br />
Informationen:<br />
M-U-T<br />
Schießstattgasse 49<br />
A - 2000 Stockerau<br />
Tel.: 02266/ 603 - 0<br />
Fax: 02266/ 603 - 153<br />
E.E.<br />
Wie entspannend<br />
sitzen sein kann ...<br />
Wirtschafts-Info<br />
beweist BRAUN Lockenhaus täglich aufs<br />
Neue. Ob nun im Hotel oder am Flughafen,<br />
im Konzert oder im Büro. Oft nehmen Sie<br />
Platz auf unseren Sitzmöbeln und fühlen sich<br />
einfach wohl. Achten Sie mal darauf. Denn<br />
bei einer Produktion von jährlich etwa 30.000<br />
Stühlen und 12.000 Objektmöbel ist die<br />
Wahrscheinlichkeit sehr groß, immer wieder<br />
auf BRAUN Lockenhaus zu stoßen, auch<br />
international... Also: Man sieht sich. Und:<br />
Vielleicht möblieren wir auch mal Ihr Objekt.<br />
Würde uns freuen.<br />
Unsere aktuelle Kollektion finden Sie in unserem<br />
neuen Produktkatalog. Einfach anfordern:<br />
E: info@braunlockenhaus.at<br />
Johann Braun & Söhne<br />
Fachwerkstätten für Sitzmöbel<br />
Tische | Objektausstattungen<br />
A-7442 Lockenhaus | Teich<br />
T: +43 (0)26 16 | 22 04 0<br />
F: +43 (0)26 16 | 22 04 8<br />
E: info@braunlockenhaus.at<br />
www.braunlockenhaus.at<br />
KOMMUNAL 59
Wirtschafts-Info<br />
Husqvarna-XP Öl besteht schwierigen Test<br />
Top bei halbsynthetischen Ölen<br />
60 KOMMUNAL<br />
Die schwedische<br />
Prüfanstalt<br />
SMP meldet<br />
ausgezeichnete<br />
Testresultate für<br />
Husqvarnas XP<br />
Zweitakt-Öl im<br />
Vergleich zu<br />
den Tests der<br />
SMP von Ölen<br />
anderer Hersteller.<br />
Der Grund für<br />
das gute<br />
Abschneiden ist<br />
Husqvarnas<br />
„Spezial-Hausrezept“.<br />
Das<br />
neue Öl, Husqvarna<br />
XP 2-<br />
Takt, ist speziell<br />
für den Einsatz<br />
in Kettensägen<br />
konzipiert worden.<br />
Es hat sich<br />
in hartem Klima<br />
aber so ausge-<br />
zeichnet bewährt, dass es nicht nur für<br />
Benzin-Werkzeuge verwendet wird,<br />
sondern mittlerweile auch für Motorräder,<br />
Snowmobile und sogar Mopeds.<br />
Nicht einmal Formel 1<br />
Motoren sind so heiß!<br />
„Kein Motor wird so heiß wie der einer<br />
Kettensäge - nicht einmal ein Formel 1-<br />
Motor. Das bedeutet, dass sehr viele<br />
Leute Husqvarna-2-Takt-Öle auch für<br />
andere Typen von Zweitaktmotoren<br />
verwenden“, erklärt Günter Feilmair<br />
von Husqvarna. In Österreich kostet<br />
das Husqvarna-XP 2-Takt Öl W<br />
9,40/Liter - damit können 50 Liter 2-<br />
Takt Treibstoff gemischt werden.<br />
Besser als<br />
vollsynthetische Öle<br />
hoch raffinierten Mineralölen. Die Formel<br />
ist geheim, aber wir können sagen,<br />
dass nach den Ergebnissen dieses<br />
neuen Tests die besten anderen 2001<br />
getesteten vollsynthetischen Öle deutlich<br />
übertroffen werden.<br />
Rasante Forschung<br />
„Es gibt eine rasante Forschung in diesem<br />
Bereich, und selbst wenn die letzten<br />
Tests drei Jahre zurück liegen, zeigen<br />
sie dennoch, dass das Husqvarna<br />
XP 2-Takt Öl bei den halbsynthetischen<br />
Ölen absolut Top ist.“, schließt Daniel<br />
Johansson von Husqvarna Schweden<br />
seine Überlegungen.<br />
Informationen:<br />
E.E.<br />
Husqvarnas „Spezial-Haus-<br />
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG -<br />
rezept“, das neue Öl, Hus-<br />
4010 Linz<br />
qvarna XP 2-Takt, übertraf<br />
Beim Husqvarna-Öl handelt es sich um Bezugsquellen-Nachweis<br />
in Tests die besten voll-<br />
ein halbsynthetisches Öl, also um eine Tel.: 0732/ 77 01 01 - 219<br />
synthetischen Öle. Mischung aus synthetischen Ölen und<br />
Wir planen, errichten, finanzieren<br />
und betreiben Wasserverorgungsund<br />
Abwasserentsorgungsanlagen<br />
www.aquaplus.at<br />
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- GmbH<br />
Absberggasse 47 | A-1103 Wien | Tel.: +43-1-603 10 12-3917<br />
Fax: -3920 | mail: office@aquaplus.at<br />
Gemeinden<br />
wünschen wünschen -<br />
Gemeinden<br />
wir bauen<br />
wir bauen<br />
VARIO-BAU errichtet kommunale Objekte für jeden Zweck<br />
in jeder Architektur und Leistungsstufe. So zum Beispiel<br />
Schulen, Kindergärten, Seniorenheime, Gemeindeämter<br />
oder Wohnhausanlagen.<br />
VARIO BAU<br />
FERTIGHÄUSER<br />
Ackergasse 21, 2700 Wr. Neustadt<br />
Tel.: 0 26 22/89 33 6-0<br />
www.variobau.at
Mobilfunkanlage im Ort heißt weniger Sendeleistung<br />
Sendeleistung steigt<br />
mit der Entfernung<br />
Immer öfter fordern kleinere Gemeinden<br />
im Zuge des Aufbaus der Mobilfunknetze,<br />
Basisstationen nicht in bewohntem<br />
Gebiet zu errichten. Was dabei übersehen<br />
wird: Basisstationen<br />
am Ortsrand können<br />
höhere Immissionen<br />
durch elektromagnetische<br />
Felder, mehr Standorte<br />
und insgesamt schlechtere<br />
Versorgung bedeuten.<br />
Ähnlich wie bei<br />
Straßenlaternen, die in<br />
kurzen Abständen stehen<br />
müssen, um eine Straße<br />
vollständig auszuleuchten,<br />
versorgt ein relativ<br />
engmaschiges Netz von<br />
Mobilfunkanlagen (Basisstationen)<br />
mit niedriger<br />
Sendeleistung - vor allem<br />
in städtischen Ballungsräumen - relativ<br />
kleine Gebiete (Funkzellen) mit vielen<br />
Mobilfunkkunden. Dadurch unterscheidet<br />
sich der Mobilfunk vom Rundfunk,<br />
bei dem wenige Sendeanlagen ausreichen,<br />
die dafür mit sehr hoher Sendeleistung<br />
betrieben werden. Je näher ein<br />
Mobiltelefon bei einer Mobilfunkanlage<br />
ist, desto geringer ist die erforderliche<br />
Sendeleistung, um zur Basisstation<br />
zurück zu funken. Deshalb gewährleisten<br />
Mobilfunkanlagen in der Nähe der<br />
Mobilfunknutzer im Rahmen dieser<br />
Zweiwegkommunikation ein „flüsterndes<br />
System“, in dem die Sendeleistungen<br />
minimiert werden. Denn sowohl das<br />
Mobiltelefon als auch die Mobilfunkanlage<br />
senden und empfangen Signale -<br />
und beide regeln ihre Sendeleistung entsprechend<br />
der Verbindungsqualität.<br />
Das Gegenteil von „gut“ ist<br />
„gut gemeint“<br />
Die immer öfter auf Gemeindeebene<br />
erhobene gut gemeinte Forderung, den<br />
Bau von Mobilfunkanlagen nur noch im<br />
Abstand von einigen hundert Metern zu<br />
bewohntem Gebiet zuzulassen, entspringt<br />
häufig dem Wunsch, die Sendeleistungen<br />
zu reduzieren. Doch mit dem<br />
Wissen um die technische Funktionsweise<br />
von Mobilfunk wird klar, dass „gut<br />
gemeint“ hier das Gegenteil von „gut“ ist.<br />
Denn Mobilfunkanlagen am Rande des<br />
Gemeindegebiets und weit weg von den<br />
Mobiltelefonen der Nutzer bedeuten<br />
höhere Immissionen, mehr Standorte<br />
und sogar schlechtere Netzversorgung.<br />
Basisstationen in der Nähe der Mobilfunknutzer gewährleisten<br />
minimierte Sendeleistungen.<br />
Optimale Versorgung<br />
Dieses Szenario lässt sich anhand eines<br />
Beispiels einfach erklären: In der kleinen<br />
ländlichen Gemeinde A soll eine<br />
Mobilfunkanlage des Betreibers B<br />
errichtet werden. Der Betreiber plant<br />
die Anlage im Ortszentrum zu bauen,<br />
da eine einzige, zentral positionierte<br />
Basisstation aus funktechnischen<br />
Gründen das Gemeindegebiet gleichmäßig<br />
und gleichzeitig mit der geringsten<br />
notwendigen Leistung optimal<br />
versorgen kann. Die Gemeinde, die als<br />
Standortgeber fungiert, schlägt nach<br />
lokalen Protesten von Anrainern der<br />
geplanten Anlage vor, die Station am<br />
Ortsrand zu errichten, dort, wo sie im<br />
Idealfall möglichst unsichtbar ist. Dieser<br />
Wunsch ist psychologisch verständlich,<br />
aber physikalisch nicht sinnvoll,<br />
denn was wären die Konsequenzen?<br />
Aufgrund der begrenzten Reichweite<br />
der Basisstation könnten Teile der<br />
Gemeinde nicht versorgt werden. Um<br />
eine gute Netzqualität zu gewährleisten,<br />
müssten unter Umständen 2 bis 3<br />
zusätzliche Mobilfunkanlagen errichtet<br />
werden! Darüber hinaus würden<br />
gleichzeitig die Gesamtimmissionen im<br />
Ort steigen, da die Mobilfunknutzer in<br />
der Gemeinde weiter weg von den<br />
Mobilfunkanlagen sind – also vom<br />
Handy wie auch von der Basisstation<br />
mehr Leistung verlangt wird, um<br />
größere Distanzen mittels Funk zu<br />
überwinden.<br />
E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
T-Mobile<br />
Mag. Margit Kropik<br />
e-mail:<br />
environment@t-mobile.at<br />
Mobilkom Austria<br />
Mag. Claudia Übellacker<br />
e-mail:<br />
umwelt@mobilkom.at<br />
Connect Austria/one<br />
Ing. Johann Killian<br />
e-mail:external.affairs@one.at<br />
tele.ring<br />
Melpomene Kriz<br />
e-mail: melpomene.<br />
kriz@telering.co.at<br />
Hutchison 3G Austria<br />
Ernest Gabmann<br />
e-mail:<br />
ernest.gabmann@h3g.at<br />
Allgemeine Informationen:<br />
Forum Mobilkommunikation<br />
Mag. Thomas Barmüller<br />
Mariahilfer Straße 37-39<br />
A-1060 Wien<br />
Tel.: 01/588 39-0<br />
e-mail: barmueller@fmk.at<br />
KOMMUNAL 61
Neue Serie JH 900 SC<br />
Herkules Allesmäher<br />
Aus dem Bestreben, den Bedürfnissen professioneller Anwender rundum gerecht zu<br />
werden, entstand der neue Allesmäher JH 900 SC der Marke Herkules. Dieser Mäher<br />
zeichnet sich durch ein besonders breites Anwendungsspektrum ebenso wie durch eine<br />
sehr komfortable und benutzerfreundliche Anwendung aus.<br />
Das völlig neuartige und<br />
patentierte Bedienkonzept<br />
„Smart-Control“ ermöglicht<br />
eine komfortable Steuerung<br />
aller relevanten Bedienelemente<br />
vom Führungsholm<br />
aus. Bei Betätigung des<br />
hydrostatischen Antriebs<br />
über die Drehgriffe des JH<br />
900 SC schwenken die<br />
Hebel der Lenkbremsen<br />
automatisch mit. Dies<br />
ermöglicht dem Bediener<br />
des Herkules Allesmähers<br />
JH 900 SC jederzeit eine<br />
optimale Griffposition<br />
ohne umzugreifen.<br />
Weitere Highlights<br />
Weitere Highlights des JH 900 SC sind<br />
die neu entwickelte Schnitthöhenverstellung<br />
über eine Parallelogrammaushebung<br />
sowie eine problemlose und<br />
komfortable Höhen- und Seitenverstellung<br />
des Führungsholmes über Quick-<br />
Schnellverschlüsse. Um frühzeitigen<br />
Ermüdungserscheinungen vorzubeugen<br />
verfügt der Herkules Allesmäher JH<br />
900 SC außerdem über einen speziell<br />
62 KOMMUNAL<br />
Auch durch seine enorme Flächenleistung ist der Herkules<br />
JH 900 SC für den kommunalen Einsatz prädestiniert.<br />
gelagerten und antivibrationsgedämpften<br />
Führungsholm und serienmäßig<br />
eingebaute Lenkbremsen.<br />
Überall hervorragende<br />
Mähergebnisse<br />
Der Anwendungsbereich des Herkules<br />
Allesmähers JH 900 SC reicht vom<br />
Zierrasen über Hochgraswiesen bis hin<br />
zu extensiv gepflegten Flächen mit kleineren<br />
Bäumen und Sträuchern. Der JH<br />
900 SC erzielt jederzeit ein hervorra-<br />
Der JH 900 SC erzielt jederzeit<br />
ein hervorragendes Mähergebnis<br />
und ist auch an Schrägoder<br />
Hanglagen sehr gut<br />
manövrierbar.<br />
gendes Mähergebnis und ist auch an<br />
Schräg- und Hanglagen sehr gut<br />
manövrierbar. Ein Aufmähen auf Steine<br />
oder andere im Gelände liegende<br />
Gegenstände verursacht dank des Herkules-Sicherheits-Systems<br />
„HSS“ keine<br />
Schäden am Motor bzw. der Kurbelwelle<br />
des JH 900 SC, da das robuste<br />
Messer über eine elektromagnetische<br />
Kupplung durch einen Keilriemen angetrieben<br />
wird.<br />
Enorme Flächenleistung<br />
Durch seine enorme Flächenleistung ist<br />
der JH 900 SC auch für großes Arbeitsvolumen<br />
bestens geeignet. Er findet vor<br />
allem im kommunalen Bereich, bei<br />
Straßenmeistereien, Landschaftsgärtnern<br />
und im Weinbau seine Anwendung.<br />
Informationen:<br />
Nähere Informationen bekommen<br />
Sie bei Ihrem Herkules Vertriebspartner<br />
vor Ort oder bei<br />
Firma RKM unter der Tel. Nr.<br />
02782/ 83 222<br />
E.E.
Alukönigstahl Brandschutzkonstruktionen<br />
Sicherheit auf höchstem Niveau<br />
Moderne Brandschutzsysteme widerlegen<br />
das Vorurteil, Sicherheit auf hohem<br />
Niveau könne ausschließlich durch<br />
wuchtige Materialstärken und zumeist<br />
optisch unattraktive Elemente erreicht<br />
werden. Leichtigkeit und vielfältiges<br />
Design unter Berücksichtigung der<br />
erforderlichen Sicherheitsklassifizierung<br />
sind die Anforderungen, die Architekten<br />
und Investoren an zeitgemäße Brandschutzkonstruktionen<br />
stellen. ALUKÖ-<br />
NIGSTAHL bietet ein neues Aluminiumsystem<br />
für Brandschutzfassaden in zwei<br />
Profilbreiten an: SCHÜCO FW 50+ BF<br />
mit 50 mm bzw. FW 60+ BF mit 60<br />
mm Ansichtsbreite. Mögliche Neigungswinkel<br />
von 15° bis 80° lassen viel Spielraum<br />
für attraktive Gestaltung mit den<br />
neuen SCHÜCO Fassadensystemen. Vorhangfassaden<br />
und Lichtdach-Konstruktionen<br />
lassen sich nahtlos aneinanderfügen.<br />
Der Einsatz der Systemkomponenten<br />
ist ebenso durchdacht, wie wirtschaftlich:<br />
Pfosten und Riegel werden<br />
als Komplettprofile verarbeitet; in der<br />
wasserführenden Ebene sind keine Verschraubungen<br />
erforderlich – das<br />
Sehr geehrter Herr<br />
Bürgermeister, Ihre<br />
nächste Rede könnte<br />
in etwa so beginnen:<br />
„Hurra, das<br />
Gemeinde-Budget<br />
ist entlastet, weil...“<br />
Noch ein paar hilfreiche Schlagworte: weil<br />
<strong>Kommunal</strong>-Leasing, weil zig Finanzierungsvorteile<br />
bei Immobilien, Fuhrparks, Maschinen, weil<br />
spezielle Modelle für Infrastruktur-Einrichtungen und<br />
kostenlose Beratung durch Herrn Mag. Heneis unter<br />
(01) 716 01-8070 oder per E-Mail: leasing@rl.co.at<br />
gewährleistet Systemsicherheit und<br />
Wartungsfreiheit.<br />
Brandschutzsysteme<br />
aus Stahl<br />
ALUKÖNIGSTAHL Brandschutzkonstruktionen<br />
mit Jansen Systemen bieten die<br />
klassischen Vorteile einer Stahlkonstruktion,<br />
wie etwa überragende statische<br />
Werte und damit die Möglichkeit, besonders<br />
große Elemente zu realisieren. Die<br />
geprüfte Sicherheit der Jansen Brandschutzkonstruktionen<br />
ermöglicht die Realisierung<br />
von Türflügelhöhen bis zu 3000<br />
mm. Schüco und Jansen Brandschutzsysteme<br />
zeigen, daß höchste Sicherheitsanforderungen<br />
und Ästhetik der Konstruktion<br />
kein Gegensatz sind. Architekten profitieren<br />
von der großen Gestaltungsfreiheit,<br />
die es ihnen ermöglicht, ihre kreativen<br />
Ideen mit Systemen umzusetzen, die<br />
sich perfekt ergänzen. So sind die verglasten<br />
Rauch- und Brandschutzkonstruktionen<br />
optisch nicht von herkömmlichen<br />
Bauelementen zu unterscheiden und<br />
www.raiffeisen-leasing.at<br />
Wirtschafts-Info<br />
JANSEN VISS TV G30: Wärmegedämmte<br />
Pfosten-Riegel-Konstruktionen für Brandschutzfassaden<br />
aus Stahl.<br />
fügen sich somit harmonisch in das<br />
Gesamtbild eines Gebäudes ein.<br />
Informationen:<br />
ALUKÖNIGSTAHL GmbH.<br />
Goldschlagstraße 87 - 89<br />
1150 Wien<br />
Tel.: 01/98 130 -0<br />
Fax: 01/98 130 -64<br />
E-Mail: m.pertl@alukoenigstahl.com<br />
������������ �����<br />
������ ���� ����<br />
������������ ����� ���<br />
������� �����<br />
����� ���� ����<br />
������������ ����� � ���<br />
������������� ���� � ������ ����� � �����<br />
���� ��� � �� �� � �� ���� � ���� �� ��<br />
������������������������<br />
KOMMUNAL 63<br />
E.E.
Ein innovatives Produkt von Bramac sorgt für mehr Sicherheit<br />
Auch am Dach<br />
wohl behütet<br />
Das Dach ist ein gefährlicher Boden: Jeder dritte tödliche Arbeitsunfall am Bau passiert<br />
bei einem Absturz vom Dach! Damit zählen Dachdecker und Rauchfangkehrer in<br />
Österreich zu den besonders gefährdeten Berufsgruppen.<br />
Österreichs Versicherungen haben längst<br />
darauf reagiert und das Unfallrisiko von<br />
Dachdeckern im Vergleich zur übrigen<br />
Bauwirtschaft mit dem „Faktor 2“ bewertet!<br />
Jetzt nimmt ein neues Gesetz die<br />
Bauherren ziemlich streng in die Pflicht:<br />
Laut dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz<br />
ist jeder Bauherr zur Anbringung<br />
eines Dachsicherungssystems verpflichtet.<br />
In der ÖNORM EN 517 mit nationalem<br />
Vorwort ist dieser Sachverhalt genau<br />
geregelt. Sieht man in die Statistik so<br />
kommen diese neuen Gesetze nicht von<br />
ungefähr. Im Jahr 2002 wurden in Österreich<br />
160 Stürze vom Dach registriert,<br />
sieben davon endeten tödlich. Damit liegt<br />
das Dach unter allen Sturz- und Fall-<br />
Unfällen mit Todesfolge an der ersten<br />
Stelle! Ursache für die Unfälle ist beinahe<br />
immer „unsachgemäßes Arbeiten in<br />
großer Höhe“.<br />
Sichere Nachnutzung<br />
Bei der Errichtung des Daches ist das in<br />
der Regel noch kein so gravierendes<br />
Problem – zumindest nicht für den Bauherrn:<br />
Denn wird für die Arbeiten ein<br />
Fachbetrieb beauftragt, geht die Verantwortung<br />
während der Bauphase auf die<br />
Projektleitung über.<br />
Aber was geschieht danach – bei Reparaturarbeiten,<br />
der Installation einer<br />
64 KOMMUNAL<br />
Antenne oder anderen nachträglichen<br />
Dacharbeiten? Ganz einfach: Der Hausbesitzer<br />
hat für all diese Fälle dafür<br />
Sorge zu tragen, dass Menschen nicht<br />
von seinem Dach stürzen. Gerade im<br />
Bereich der öffentlichen Auftraggeber<br />
sollte man sich daher nicht auf Haftungsverpflichtungen<br />
im Falle von<br />
Unfällen einlassen. Bisher gar keine so<br />
einfache Sache, dieser gesetzlichen Verpflichtung<br />
auch wirklich sinnvoll nachzukommen,<br />
denn geeignete Systeme,<br />
die den neuesten Regelungen gerecht<br />
werden, sind absolute Mangelware.<br />
Dachsicherheitshaken<br />
Der Dachspezialist Bramac hat sich aber<br />
mittlerweile mit der Materie intensiv<br />
auseinandergesetzt und einen Dachsicherheitshaken<br />
entwickelt, der den<br />
strengen österreichischen Schutzbestimmungen<br />
entspricht.<br />
Der neue Dachsicherheitshaken von Bramac<br />
ist sowohl als Anschlagpunkt für<br />
den Gebrauch einer persönlichen<br />
Schutzausrüstung gemäß EN 354, 355,<br />
360 und 362 geeignet, als auch als<br />
Dachdeckerhaken zum Einhängen einer<br />
Dachleiter. Durch seine spezielle Form<br />
ist der Dachsicherheitshaken in der<br />
Lage, Stürze über die Traufe, über den<br />
Ortgang und über den First abzufangen.<br />
Der neue Dachsicherheitshaken<br />
von Bramac.<br />
Trotz dieser hohen Funktionalität<br />
besticht dieser Haken durch ein einfaches<br />
Grundsystem und einer raschen<br />
und einfachen Verlegung. Durch eine<br />
darunter liegende Schiene kann der<br />
Haken beliebig verschoben und somit<br />
leicht platziert werden. Spezielle Bramac-Sondersteine<br />
mit einer Aussparung<br />
für den Haken sorgen neben dem geringen<br />
Aufwand für eine optisch ansprechende<br />
Lösung. Außerdem wird beim<br />
Bramac-System die Unterkonstruktion<br />
nicht durchdrungen.<br />
Damit schafft man für nachträgliche<br />
Arbeiten am Dach und für den Rauchfangkehrer<br />
ideale Voraussetzungen für<br />
ein risikofreies Arbeiten.<br />
Informationen:<br />
Der neue Sicherheitsdachhaken der<br />
Bramac ist mit Anfang Juli 2004<br />
lieferbar.<br />
Nähere Informationen dazu<br />
erhalten Sie unter:<br />
Bramac Dachsysteme International<br />
z. H. Günter Prirschl,<br />
Leiter Anwendungstechnik<br />
Bramacstr. 9, 3380 Pöchlarn<br />
Tel.: 02757/4010-260<br />
Fax: 02757/4010-64<br />
E-Mail:<br />
guenter.prirschl@bramac.com<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Erfolgreiche Veranstaltung im neuen Messe Center Graz<br />
Kongress und Fachmesse GasWasser<br />
Das neue Messe Center Graz war Ende<br />
Mai Austragungsort der traditionellen<br />
Veranstaltung der Österreichischen Vereinigung<br />
für das Gas- und Wasserfach<br />
(ÖVGW), zu der Präsident SR DI Hans<br />
Sailer erstmals mehr als 500 Tagungsteilnehmer<br />
aus dem In- und Ausland<br />
begrüßen konnte.<br />
Der Kongress vereinte Gasnetzbetreiber,<br />
Trinkwasserversorger und die fachspezifischen<br />
Industrie und war gleichzeitig<br />
auch ein klares Signal der Gemeinsamkeit<br />
der österreichischen Versorgungswirtschaft<br />
an Politik und Behörden. In<br />
Zeiten, in denen sich die politischen<br />
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
der Branchen ständig und immer<br />
rascher ändern, bot diese Veranstaltung<br />
den betroffenen Fachleuten den entsprechenden<br />
Raum für Meinungsbildung<br />
und Erfahrungsaustausch.<br />
Hochrangige Mitarbeiter der EU-Generaldirektionen<br />
Binnenmarkt sowie Wettbewerb<br />
waren ebenfalls anwesend. Bei<br />
einem gemeinsamen Pressegespräch<br />
mit dem Präsidenten der ÖVGW und<br />
VDir DI Malik (Grazer Stadtwerke AG)<br />
inigungsexpertisen.<br />
Reinigungskosten im Griff haben.<br />
wurde das Thema „Das Wasser und die<br />
EU“ erörtert, anschließend standen die<br />
Herren dem Fachpublikum für Diskussionen<br />
zur Verfügung.<br />
Darüber hinaus konnten sich die Fachexperten,<br />
aber auch andere Interessierte<br />
im Rahmen einer frei zugänglichen,<br />
ca. 830 m≈ Ausstellungsfläche<br />
umfassenden Fachmesse über die<br />
modernsten technische Produkte informieren,<br />
die in der Gas- und Wasserversorgung<br />
zur Anwendung kommen.<br />
Insgesamt kann die ÖVGW also auf<br />
eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken<br />
und freut sich daher schon auf<br />
den nächsten Kongress mit Fachmesse<br />
GasWasser am 15. und 16. Juni 2005<br />
in der Stadt Salzburg!<br />
Informationen:<br />
Das Hilfsmittel zur Kontrolle und<br />
Reduktion Ihrer Reinigungskosten.<br />
Präsident SR DI Hans Sailer konnte erstmals<br />
mehr als 500 Tagungsteilnehmer begrüßen.<br />
Österr. Vereinigung für das Gasund<br />
Wasserfach (ÖVGW)<br />
Schubertring 14, A-1015 Wien<br />
Tel: 43/1/513 15 88/26<br />
Fax: 43/1/513 15 88/25<br />
http://www.ovgw.at,<br />
http://www.erdgasautos.at<br />
http://www.wasserwerk.at<br />
Wir berechnen objektspezifisch und individuell: die Reinigungsfläche,<br />
den Zeitaufwand, den Personalbedarf, die<br />
jährlichen Reinigungskosten und den Bedarf an Maschinen,<br />
Geräten usw.<br />
Auf Basis dieser Berechnungen erstellen wir Reinigungspläne<br />
mit ausführlichen Reinigungs- und Pflegeanleitungen.<br />
Unsere Reinigungsexpertisen sind eine wertvolle Hilfe um<br />
die Reinigungskosten in den Griff zu bekommen.<br />
Walter Bösch KG | A-6890 Lustenau | Industrie Nord | t 05577/81 31-0<br />
A-6020 Innsbruck t 0512/268 828-0<br />
A-8045 Graz/Andritz t 0316/691 751-0<br />
A-5101 Bergheim bei Sbg. t 0662/453 048-0<br />
A-9020 Klagenfurt t 0463/318 961-0<br />
A-4060 Linz/Leonding t 0732/672 190-0<br />
A-1230 Wien t 01/865 95 36-0<br />
CZ-63900 Brünn t +420/543 217 496<br />
SI-61210 Laibach t +386 (0)1/512 10 83<br />
nigung Informationen unter: www.boesch.at | info@boesch.at<br />
KOMMUNAL 65<br />
E.E.
<strong>Kommunal</strong>er Bau<br />
Das österreichische Modell ist international bemerkenswert<br />
Finger weg von der<br />
Wohnbauförderung<br />
Am österreichischen Modell der Wohnbauförderung darf nicht gerüttelt werden, darin<br />
sind sich viele Experten einig. Länder und Gemeinden stellen auch im Zuge der<br />
laufenden Finanzausgleichverhandlungen mit dem Finanzminister klar, dass bei<br />
der Wohnbauförderung nicht gespart werden darf.<br />
◆ KOMMUNAL-Redaktion<br />
Auch der Verbandstag der Gemeinnützigen<br />
Wohnungswirtschaft Österreichs<br />
Anfang Juni stand im Zeichen eines<br />
Plädoyers für die Beibehaltung der<br />
Wohnbauförderung. Vor allem der<br />
Wohnungsmarkt bedarf mit seiner<br />
Besonderheit der Wohnung als existentielles<br />
Gut für den Nutzer und gleichzeitiglangfristigesWirtschaftsgut<br />
eines star-<br />
kenöffentlichenfinanziellen Engagements,<br />
um Fehlentwicklungen<br />
und Mängel in<br />
der Wohnversorgung<br />
zu verhindern.<br />
Der<br />
prominente<br />
Ökonom<br />
Univ.Prof. Dr.<br />
Ewald Nowotny<br />
plädiert etwa im Lichte internationaler<br />
Erfahrungen vor allem für eine Beibehaltung<br />
des bestehenden Miteinanders<br />
von Objektförderung und ergänzender<br />
Subjektförderung. Karl Czasny vom<br />
Institut für Stadt- und Regionalforschung<br />
meint unter Hinweis auf eine<br />
internationale Vergleichsstudie, dass es<br />
in Österreich gelungen ist, durch die<br />
Förderung eine ausgewogene Wohnkostenstruktur<br />
zu etablieren, die zunehmend<br />
„Armutsrisken abfedert“. Messbar<br />
und nachweislich wäre, dass<br />
unser Förderungssystem eine soziale<br />
Durchmischung im Wohnbereich<br />
66 KOMMUNAL<br />
Wohnbauförderung<br />
hilft<br />
„Ghettoisierungseffekte“<br />
zu vermeiden<br />
und leistet<br />
damit einen Beitrag<br />
zum sozialen<br />
Frieden.<br />
ermöglicht, „Ghettoisierungseffekte“<br />
vermeiden hilft und damit auch einen<br />
Beitrag zum sozialen Frieden leistet.<br />
„Wohnbauförderung ist<br />
unverzichtbar“<br />
Die drei Wohnbau-Experten im<br />
Nationalrat, Walter Tancsics<br />
(ÖVP), Dietmar Hoscher (SPÖ)<br />
und Gabriele Moser (Grüne)<br />
signalisieren ebenfalls hohe<br />
Wertschätzung und Unterstützung<br />
für eine weiterhin leistungsfähigeWohnbauförderung,<br />
die sich in ihren „sozialen<br />
und wirtschaftlichen Zielsetzungen<br />
bestens bewährt hat“. GBV-<br />
Obmann Karl<br />
Wurm wendet<br />
sich gegen die<br />
spürbare Tendenz,<br />
unter den Slogans<br />
von „schlanker<br />
Staat, Privatisierung und<br />
Deregulierung“ Fragen<br />
von höchster Priorität<br />
wie Beschäftigung,<br />
Sicherung eines ausrei-<br />
chenden Einkommens<br />
und der Lebensqualität<br />
durch leistbares und<br />
sicheres Wohnen aus<br />
dem politischen Diskurs<br />
auszublenden. Wurm:<br />
„Die Wohnbauförderung<br />
ist bei vergleichsweise<br />
geringen Kosten nach<br />
wie vor ein unverzichtba-<br />
«<br />
rer Faktor für eine funktionierende<br />
Gesellschaft im Gleichgewicht“.<br />
Das „österreichische<br />
Modell“<br />
„Bemerkenswert am österreichischen<br />
Modell der Wohnbauförderung ist der<br />
im internationalen Vergleich ausgesprochen<br />
hohe Förderungsdurchsatz. Knapp<br />
80 Prozent der baubewilligten Wohnungen<br />
werden aus Mitteln der Wohnbauförderung<br />
kofinanziert. Damit<br />
kommt der Wohnbauförderung eminente<br />
Bedeutung bei der quantitativen<br />
und qualitativen Steuerung der Wohnungsproduktion<br />
zu. Dennoch liegen<br />
die <strong>Ausgabe</strong>n für die Wohnbauförderung<br />
nicht über<br />
dem Niveau anderer<br />
westlicher Länder“,<br />
erläutert Dr.<br />
Wolfgang Amann,<br />
Geschäftsführer<br />
der Forschungsgesellschaft<br />
für Wohnen,<br />
Bauen und<br />
Planen die Besonderheiten<br />
der<br />
Gäbe es keine Wohnbauförderung,<br />
gäbe<br />
es nicht regionale<br />
Investitionen in<br />
Milliardenhöhe.<br />
Wolfgang Sobotka<br />
Niederösterreichischer<br />
Finanzlandesrat<br />
«<br />
österreichischen<br />
Wohnbauförderung.<br />
Österreich<br />
bringt ca. ein Prozent<br />
des BIP für<br />
Zwecke der Wohnbauförderung<br />
auf.<br />
Einer französischen<br />
Studie<br />
zufolge liegt der
Wohnbauförderung in Österreich<br />
Anteil in Deutschland bei 2,1 Prozent<br />
und in Schweden bei 2,7 Prozent.<br />
Großbritannien wendet 2,6 Prozent des<br />
BIP zum Zwecke der Wohnbauförderung<br />
auf.<br />
Motor der Bauwirtschaft<br />
Einig sind sich die Experten darin, dass<br />
der Mehr-Wert der Wohnbauförderung<br />
diese unverzichtbar macht. Durch die<br />
Stützung der Darlehen mit Geldern der<br />
Einig sind sich die Experten<br />
darin, dass der Mehr-<br />
Wert der Wohnbauförderung<br />
diese unverzichtbar<br />
macht. Seit 2001 sind<br />
<strong>Ausgabe</strong>n für Infrastruktur-<br />
und Kyoto-relevante<br />
Maßnahmen aus Mitteln<br />
der Wohnbauförderung<br />
möglich, das führt zu<br />
wichtigen Lenkungseffekten<br />
hinsichtlich des<br />
Umweltschutzes und des<br />
Städtebaus.<br />
Und nicht zuletzt ist die<br />
Wohnbauförderung ein<br />
entscheidender Motor der<br />
Bauwirtschaft und<br />
bewirkt somit nicht nur<br />
konjunkturelle Effekte,<br />
sondern sichert Arbeitsplätze.<br />
Auf eine Million<br />
Euro, die in die Bauwirtschaft<br />
investiert werden,<br />
kommen 17.000 Arbeitsplätze.<br />
Wohnbauförderung reduzieren sich die<br />
jährlichen Zinsforderungen an die<br />
Darlehensnehmer und sorgen so für<br />
eine höhere Liquidität. Seit 2001 sind<br />
<strong>Ausgabe</strong>n für Infrastruktur- und Kyotorelevante<br />
Maßnahmen aus Mitteln der<br />
Wohnbauförderung möglich, das führt<br />
zu wichtigen Lenkungseffekten hinsichtlich<br />
des Umweltschutzes und des<br />
Städtebaus. Mit Hilfe der Wohnbauförderung<br />
können sich auch junge und<br />
mitunter einkommensschwache Men-<br />
<strong>Kommunal</strong>er Bau<br />
schen den Traum vom Eigenheim<br />
erfüllen. Und nicht zuletzt ist die<br />
Wohnbauförderung ein entscheidender<br />
Motor der Bauwirtschaft<br />
und bewirkt somit nicht nur konjunkturelle<br />
Effekte, sondern sichert<br />
Arbeitsplätze. Jeder Euro, der in<br />
die Bauwirtschaft investiert wird,<br />
sichert Arbeitsplätze. Die mehrdimensionale<br />
Hebelwirkung der<br />
Wohnbauförderung, mit der mit<br />
vergleichsweise geringen finanziellen<br />
Mitteln enormer volkswirtschaftlicher<br />
Nutzen erbracht<br />
werde kann, ist für das Land<br />
unverzichtbar. Wohnbau-Experte<br />
Amann: „Wer die Wohnbauförderung<br />
abschaffen möchte riskiert, dass der<br />
Staat und somit auch der Steuerzahler<br />
letztlich mehr Geld für die Subjektförderung<br />
und<br />
steuerliche<br />
Förderung<br />
ausgeben<br />
muss, als er<br />
heute für die<br />
Wohnbauförderungaufwendet“.NÖ-FinanzlandesratWolfgang<br />
Sobotka<br />
rechnet vor,<br />
dass alleine in<br />
NÖ in den<br />
letzten fünf<br />
Jahren durch<br />
die Wohnbauförderung<br />
regionale Investitionen<br />
in der<br />
Höhe von 7,6<br />
Milliarden<br />
Euro ausgelöst<br />
wurden. „Im<br />
Jahr 2003<br />
«<br />
Die Mittel der<br />
Wohnbauförderung<br />
wurde im<br />
letzten Finanzausgleich<br />
bewusst<br />
zweckgewidmet.<br />
Herbert Sausgruber<br />
Landeshauptmann von<br />
Vorarlberg<br />
waren dies 1,4 Milliarden Euro. Gäbe<br />
es keine Wohnbauförderung, gäbe es<br />
nicht diese Investitionen“, so LR<br />
Sobotka. Über das Baugewerbe hinaus<br />
profitieren von der Wohnbauförderung<br />
kleinste Gemeinden und unzählige<br />
Klein- und Mittelbetriebe. Dieser<br />
Impulsgeber hilft der regionalen Bauwirtschaft.<br />
„Finger weg von der Wohnbauförderung“,<br />
fordert auch der Vorarlberger<br />
Landeshauptmann Herbert<br />
Sausgruber und weist darauf hin, dass<br />
die Mittel der Wohnbauförderung im<br />
letzten Finanzausgleich bewusst in der<br />
Zweckwidmung erweitert wurden.<br />
Und auch der Wiener Bürgermeister<br />
Michael Häupl stellte bereits klar, dass<br />
an der Wohnbauförderung nicht gerüttelt<br />
werden darf.<br />
KOMMUNAL 67<br />
«
Wirtschafts-Info<br />
BAWAG P.S.K. Leasing feiert 25 Jahre<br />
Der Wiener Spezialitäten-Abend<br />
Den festlichen Rahmen für die 25<br />
Jahr-Feier der BAWAG P.S.K. Leasing-Gruppe<br />
bildete das Palais Ferstel<br />
in der Wiener Innenstadt. 450<br />
Kunden und Partner waren der<br />
Einladung der drei Geschäftsführer<br />
Mag. Rudolf Fric, Harald Haider<br />
und Mag. Friedrich Primetzhofer<br />
gefolgt. Motto des Abends<br />
waren „Wiener Spezialitäten“, die<br />
sowohl kulinarisch als auch künstlerisch<br />
sichtbar waren. Zwischendurch<br />
gaben sechs Mitarbeiter<br />
der BAWAG P.S.K. Leasing den<br />
BAWAG P.S.K. Leasing-Song zum<br />
Besten, der von Geschäftsführer<br />
Primetzhofer komponiert und<br />
getextet worden war. Höhepunkt<br />
des Abends war die erste Verleihung<br />
des BAWAG P.S.K. Leasing-Preises, die<br />
LEAS`I 2004. Sie wurde diesmal von<br />
P.S.K. Generaldirektor Dr. Stephan<br />
Koren an Dr. Gerd Libowitzky, den<br />
langjährigen Geschäftsführer der<br />
BAWAG P.S.K. Leasing verliehen. Künftig<br />
sollen mit dem Preis alle zwei Jahre<br />
Menschen ausgezeichnet werden, die<br />
68 KOMMUNAL<br />
„Wiener Spezialitäten“ im Palais Ferstel zur 25-Jahr-Feier<br />
der BAWAG P.S.K. Leasing.<br />
sich für die Leasing-Idee einsetzen oder<br />
verdient gemacht haben.<br />
Unter den Gästen sichtete man den<br />
gesamten Vorstand der BAWAG, allen<br />
voran Generaldirektor Dkfm. Johann<br />
Zwettler, den Generaldirektor der P.S.K.<br />
Dr. Stephan Koren und den Generaldirektor<br />
der Istrobanka Mag. Volker Pichler<br />
sowie Vertreter aus Handel und<br />
KLH Massivholz GmbH<br />
A-8842 Katsch / Mur 202<br />
Tel ++43 (0)3588 / 8835-0<br />
Fax ++43 (0)3588 / 8835-20<br />
e-Mail: office@klh.at<br />
Die Firma Pejcl hat es sich<br />
zum Grundsatz gemacht,<br />
für ihre Kunden mehr als<br />
nur ein Lieferant zu sein.<br />
Täglich ist man bemüht<br />
die Serviceleistungen für<br />
Sie zu verbessern. Aus diesem<br />
Grund freut man sich,<br />
den neuen Mitarbeiter<br />
Ulreich Günter (1. v.<br />
rechts) vorstellen zu dürfen.<br />
Herr Ulreich ist seit<br />
Anfang Mai 2004 bei der<br />
Firma Pejcl beschäftigt, und<br />
hat eine 15- jährige Praxiserfahrung<br />
im Außendienst und<br />
in der Kundenbetreuung.<br />
Durch die langjährige Erfahrung<br />
als Monteur kennt Herr<br />
Ulreich die Problematik eines<br />
Unternehmens bei Ausfall<br />
eines Arbeitsgerätes.<br />
Ab sofort steht Herr Ulreich<br />
für Servicearbeiten und technische<br />
Fragen bei Ihnen im<br />
Betrieb zur Verfügung.<br />
Reparaturen auf Kehrmaschinen<br />
der Marken Bucher,<br />
Wirtschaft u.a. Dir. Leopold<br />
Fischer (<strong>Kommunal</strong>kredit Austria<br />
AG), den Generaldirektor der Ford<br />
Motor Company Fritz Schmutzhart,<br />
Mag. Klaus Stöger, Finanzvorstand<br />
der Austrian Airlines und<br />
Arbö-Präsident Dr. Herbert<br />
Schachter. Weiters unter den<br />
Gästen: Dir. Max Windhager, Landesdirektor<br />
der Wiener Städtischen<br />
Versicherung, Dr. Wolfgang<br />
Huber, als Vertreter der Generali-<br />
Gruppe, Markus Trimmel für den<br />
Allianz-Konzern, Mag. Franz<br />
Hagen, Präsident des Leasingverbandes<br />
und seine Generalsekretärin<br />
Mag. Brigitte Jancik, Mag.<br />
Karlheinz Sandler von der Raiffeisen<br />
Leasing und Mag. Robert Wunderl<br />
Geschäftsführer der Sparte Information<br />
und Consulting in der Wirtschaftskammer.<br />
Durch den Abend führten Gerhard<br />
Aichinger (Moderator) und Prok. Maria<br />
Auer, die durch ihren Einsatz bei der<br />
Gestaltung des Abends der Veranstaltung<br />
ihren charmanten Stemplel aufdrückte.<br />
Pejcl <strong>Kommunal</strong>technik<br />
Erweitertes Team<br />
Das Team der Firma Pejcl.<br />
Schmid, Hochdorf, Johnston,<br />
MUT und Faun werden vor<br />
Ort durchgeführt.<br />
Das PEJCL <strong>Kommunal</strong>technik<br />
Team würde sich freuen<br />
Sie auch bei Ihren Anliegen<br />
betreuen zu dürfen.<br />
Informationen:<br />
Pejcl <strong>Kommunal</strong>technik<br />
Schafzeile 21<br />
2172 Schrattenberg<br />
Tel.: 02555/ 2237<br />
Fax: 02555/ 242 37<br />
E-Mail:<br />
landtechnik@pejcl.at<br />
E.E.
Foto: Telekom Austria<br />
Kabellos via Breitband mailen und surfen<br />
Telefonzelle wird<br />
zum Hot Spot<br />
Mit einer offiziellen Eröffnungsfeier<br />
wurden am 9. Juni 2004 die ersten Hot<br />
Spots von Telekom Austria im oberösterreichischen<br />
Perg eröffnet. „Die so<br />
genannte ,Digitale Kluft’ – die infrastrukturelle<br />
Lücke zwischen Stadt- und<br />
Landbevölkerung – kann nur durch<br />
nachhaltige Investitionen in die Kommunikationsnetze<br />
überwunden werden.<br />
Das Land Oberösterreich hat auf dem<br />
Weg in Richtung eEurope eine eigene<br />
Breitband-Offensive gestartet und will<br />
gemeinsam mit Internetanbietern eine<br />
Vollversorgung der oberösterreichischen<br />
Gemeinden mit Breitband-Internet<br />
erreichen“, erklärte der Oberösterreichische<br />
Landeshauptmann Stellvertreter<br />
Franz Hiesl im Rahmen der<br />
Eröffnungsfeier.<br />
Wachstumsimpuls für die<br />
ländlichen Regionen<br />
Ebenfalls gekommen war der oö. Wirtschaftslandesrat<br />
Viktor Sigl, der das<br />
Pilotprojekt Perg als positives Signal für<br />
die Region begrüßte: „Als wichtiger<br />
wirtschaftlicher Standortfaktor schafft<br />
der Zugang zu Breitband-Internet einen<br />
enormen Wettbewerbsvorteil für alle<br />
Wirtschaftstreibenden und einen<br />
Wachstumsimpuls für die ländlichen<br />
Regionen. Mit diesem öffentlichen<br />
Zugang zu Breitband-Internet haben die<br />
Bürgerinnen und Bürger in Perg jetzt<br />
die Möglichkeit, rasch und flächendeckend<br />
auf den Datenhighway aufzufahren."<br />
Einfach kabellos surfen<br />
und mailen<br />
An insgesamt 26 Standorten in Perg<br />
werden Telefonzellen und andere<br />
Standorte wie z.B. Schulen mit kabellosem<br />
Breitband-Internet ausgestattet.<br />
Alle Hot Spots sind im Stadtplan von<br />
Perg eingezeichnet und unter<br />
http://HotSpots.Aon.at abrufbar. Im<br />
Rahmen des Pilotprojekts wird allen<br />
Besuchern und Bewohnern von Perg<br />
das Breitband-Internet über die neuen<br />
Hot Spots für die nächsten<br />
sechs Monate gratis<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Jeder, der ein WLAN-fähiges<br />
Endgerät besitzt, kann<br />
rund um die Hot Spots in<br />
Perg bequem und ganz<br />
einfach über eine Website<br />
ins Internet einsteigen,<br />
die automatisch auf dem<br />
jeweiligen Display<br />
erscheint. Am 14. Juni<br />
gab es für alle interessierten<br />
Pergerinnen und Perger<br />
einen Infoabend mit<br />
Bürgermeister Hermann<br />
Peham, DI Helmut Leopold,<br />
Leiter Technik Telekom<br />
Austria, und Mag.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Die Telekom Austria startete am 9. Juni 2004 ein Pilotprojekt im oberösterreichischen Perg<br />
mit 26 Hot Spots – öffentlicher, kabelloser Zugang zu Breitband-Internet als wichtiger<br />
Standortfaktor für Gemeinden.<br />
LH-Stv. Franz Hiesl, LR Viktor Sigl, Anton Froschauer,<br />
Vzbgm Perg und Rudolf Fischer, Vorstandsdirektor von<br />
Telekom Austria bei der Eröffnungsfeier in Perg.<br />
Josef Peter Preining, Leiter Telekom<br />
Austria Business Solutions Oberösterreich.<br />
„Es ist uns gelungen, gemeinsam<br />
mit Telekom Austria dieses partnerschaftliche<br />
Projekt für Perg zu starten<br />
und damit den Bewohnern und Besuchern<br />
unserer Gemeinde in den nächsten<br />
sechs Monaten die Möglichkeit zu<br />
geben, an öffentlichen Plätzen gratis im<br />
Internet zu surfen“, freut sich Anton<br />
Froschauer, Vize-Bürgermeister von<br />
Perg, auf die Zusammenarbeit mit dem<br />
größten Telekommunikationsunternehmen<br />
Österreichs. Telekom Austria sammelt<br />
im Rahmen des Pilotprojektes in<br />
Perg Erkenntnisse zur WLAN-Technologie<br />
und lädt die Pergerinnen und Perger<br />
ein, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Das<br />
Feedback der WLAN-User wird in die<br />
Produktentwicklung eingebunden, was<br />
einen innovativen Schritt in der Telekom-Branche<br />
darstellt.<br />
Telekommunikationsmarkt<br />
Oberösterreich<br />
Alleine in den letzten vier Jahren hat<br />
Telekom Austria über 135 Millionen<br />
Euro in den Telekommunikationsmarkt<br />
Oberösterreich investiert. Zusätzlich hat<br />
Telekom Austria in diesem Zeitraum<br />
auch wichtige Impulse für die oberösterreichische<br />
Wirtschaft gesetzt: Um<br />
rund 25 Mio. Euro wurden Leistungen<br />
von Drittfirmen beispielsweise für Grabungsarbeiten,<br />
Kabelverlegungen oder<br />
den Aufbau von Antennentragwerken<br />
eingekauft. Dadurch konnte die Region<br />
maßgeblich belebt werden.<br />
Informationen:<br />
Telekom Austria<br />
www.telekom.at<br />
HotSpots.Aon.at<br />
KOMMUNAL 69<br />
E.E.
Sicherheit<br />
Der Gemeindebund appelliert an<br />
die Kommunen, für Sicherheit vor<br />
Ort, vor allem aber rund um<br />
Kinderbetreuungseinrichtungen<br />
und Schulen zu sorgen.<br />
Gemeindebund initiiert neue Verkehrssicherheitskampagne<br />
„Sicher und Sichtbar“<br />
in allen Gemeinden<br />
Mit zwei Kampagnen kämpft der Österreichische Gemeindebund gegen<br />
vermeidbare Ursachen und Folgen von Verkehrsunfällen an. „Sicher und Sichtbar“<br />
und „Alkoholselbstkontrolle“ appellieren an die Gemeinden und Bürger, bewusst auf<br />
Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu achten und gegen Trunkenheit am<br />
Steuer aufzutreten.<br />
◆ Dr. Petra Schröder<br />
Zwei Drittel aller Straßen Österreichs<br />
sind Gemeindestraßen. Laut Kuratorium<br />
für Verkehrssicherheit (KfV) ereignen sich<br />
die Hälfte bzw. mit Wien zwei Drittel aller<br />
Verkehrsunfälle mit Personenschaden im<br />
Ortsgebiet, die Anzahl der getöteten Kinder<br />
steigt jährlich. Leider droht auch oft<br />
Gefahr durch schlecht beschilderte Kreuzungen,<br />
unzureichend beleuchtete<br />
Straßen, kaum wahrnehmbare<br />
Schutzwege oder andere Versäumnisse<br />
auf Verkehrsflächen.<br />
Deshalb nimmt der Österreichische<br />
Gemeindebund die traurige Verkehrsunfallbilanz<br />
auch zum Anlass, Österreichs<br />
Gemeinden im Zuge einer breit gefächer-<br />
◆ Dr. Petra Schröder ist Pressereferentin<br />
des Österreichischen Gemeindebundes<br />
70 KOMMUNAL<br />
ten Kampagne zu mehr Sicherheit und<br />
Sichtbarkeit im Straßenverkehr bei der<br />
herausfordernden Aufgabe als örtliche<br />
Straßenpolizei zu unterstützen. Mit<br />
Sicher und Sichtbar erfolgt der Startschuss<br />
für eine öffentlichkeitswirksame<br />
Vorzeigekampagne, indem die Gemeinden<br />
ihren Beitrag für mehr Verkehrsicherheit<br />
zur Schau stellen und als gutes Beispiel<br />
für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit<br />
im Ortsgebiet und auf Gemeindestraßen<br />
vorangehen sollten. Erstes Ziel für<br />
Gemeinden sollte die Kontrolle der<br />
Straßen, Wege und Plätze rund um<br />
Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungensein.<br />
Eine Checkliste hilft dabei.<br />
„Sicher und Sichtbar“ steht unter der<br />
Patronanz des Zukunftsministeriums mit<br />
Ministerin Elisabeth Gehrer sowie des<br />
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation<br />
und Technologie mit Vizekanzler<br />
Hubert Gorbach. Partner der Kampagne<br />
sind unter anderem das Kuratorium für<br />
Verkehrssicherheit und KOMMUNAL.<br />
Die erste Etappe: Eine<br />
Informationskampagne<br />
Während der Sommermonate steht die<br />
Sensibilisierung von Gemeinden im<br />
Zentrum. Das Ziel sind sichere Straßen,<br />
sichere Plätze, sichere Wege. Der<br />
Gemeindebund appelliert deshalb an<br />
die Kommunen,<br />
für<br />
Sicherheit<br />
vor Ort<br />
und vor<br />
allem<br />
rund um<br />
Kinderbetreuungseinrichtungen<br />
und Schulen<br />
zu<br />
sorgen.<br />
Die „Sicher und<br />
Sichtbar“-Hotline 07242/<br />
46 640-47 gibt Antwort<br />
auf brennende Fragen<br />
zur örtlichen Straßenpolizei<br />
und Verkehrssicherheit<br />
vor Ort.<br />
Konkret geht es um Fragen wie: Wie<br />
kontrolliere ich, ob der Schulweg sicher<br />
ist? Ist die richtige Kennzeichnung bei<br />
Rad- und Gehwegen vorhanden? Funktionieren<br />
Ampeln tadellos? Ist die<br />
Beschilderung abgestimmt?<br />
Gemeinde-Wettbewerb<br />
startet im Herbst<br />
Der Gemeindebund sucht den aktivsten<br />
Bürgermeister in punkto Sicherheit und
Sichtbarkeit. Nachdem straßenpolizeiliche<br />
Aufgaben herausfordern, bietet der<br />
Österreichische Gemeindebund Unterstützung<br />
an: So finden sich beispielsweise<br />
in der RFG-Schriftenreihe „Recht<br />
& Finanzierungspraxis der Gemeinden“<br />
2/2004 „Die Gemeinde und ihre<br />
straßenpolizeilichen Aufgaben“, die an<br />
alle Gemeinden gesandt und auf<br />
www.gemeindebund.at abrufbar ist,<br />
wertvolle Tipps und Hinweise.<br />
Internetplattform<br />
www.sicherundsichtbar.at<br />
Für alle notwendigen Informationen<br />
und Fragen rund um Sicherheit und<br />
Sichtbarkeit hat der Österreichische<br />
Gemeindebund mit seinen Partnern<br />
eine eigene Internetplattform und Telefon-Hotline<br />
eingerichtet.<br />
Auf www.sicherundsichtbar.at sind<br />
Checklisten für die Verkehrssicherheit<br />
in Gemeinden abrufbar, finden sich<br />
grundsätzliche Information zur Kampagne,<br />
<strong>Download</strong>s (zum Beispiel Folder),<br />
aber vor allem kostengünstige und<br />
praktische Tipps und Lösungen.<br />
Somit kann sich jede Gemeinde rüsten<br />
– zum Einen für mehr Sicherheit, zum<br />
anderen für den österreichweiten Wettbewerb,<br />
der im Herbst startet und die<br />
TopTen-Gemeinden in punkto Sicherheit<br />
und Sichtbarkeit sucht und prämieren<br />
wird.<br />
Die genauen Details und Bedingungen<br />
zum Wettbewerb werden über KOM-<br />
MUNAL im Spätsommer den Gemeinden<br />
kommuniziert.<br />
Die Internet-Plattform<br />
Auf www.sicherundsichtbar.at<br />
sind Checklisten für die Verkehrssicherheit<br />
in Gemeinden abrufbar,<br />
grundsätzliche Information zur<br />
Kampagne, <strong>Download</strong>s (zum Beispiel<br />
Folder) aber vor allem in<br />
Zeiten der Finanznot der Kommunen<br />
kostengünstige und praktische<br />
Tipps und Lösungen stehen<br />
per Knopfdruck zur Verfügung.<br />
Fotos: Kuratorium für Verkehrssicherheit<br />
Foto: Hans Braun<br />
Gemeindebund und ORF lancieren Kampagne<br />
Spätestens seit der verheerenden Bilanz<br />
der auf Österreichs Straßen durch alkoholisierte<br />
überwiegend jugendliche<br />
Lenker ausgelösten Unfälle zu Ostern<br />
2004 ist Alkoholselbstkontrolle abermals<br />
zu einem der wichtigsten Themen<br />
der öffentlichen Diskussion geworden.<br />
Eine von ORF, dem Bundesministerium<br />
für Inneres und dem Kuratorium für<br />
Verkehrssicherheit durchgeführte große<br />
Verkehrssicherheitskampagne steht<br />
daher auch heuer wieder unter dem<br />
Motto „Alkoholselbstkontrolle“. Der<br />
Österreichische<br />
Gemeindebund ist<br />
Partner.<br />
In Fortsetzung der im<br />
Vorjahr gestarteten<br />
Aktion soll in einer<br />
österreichweiten<br />
Informations- und<br />
Werbekampagne das<br />
Bewusstsein in der<br />
Bevölkerung und vor<br />
allem in der jugendlichen<br />
Zielgruppe, freiwillig<br />
auf Alkohol am Steuer zu verzichten,<br />
nachdrücklich gestärkt werden.<br />
Alkoholselbstkontrolle wird nicht<br />
nur als verantwortungs- und rücksichtsvolles<br />
Handeln dargestellt, sondern<br />
auch als wirksames Mittel, negative<br />
Folgen bei einer Kontrolle durch die<br />
Exekutive vermeiden zu können. Der<br />
Slogan „Wenn ich fahr', dann trink' ich<br />
nichts, und wenn ich trink', dann fahr<br />
ich nicht“ ist neuerlich ein Appell an<br />
die Vernunft, selbst die Kontrolle zu<br />
übernehmen, noch bevor es andere tun<br />
und vor allem noch bevor es zu weiteren<br />
durch Alkohol am Steuer bedingten<br />
Sicherheit<br />
Mit „Selbstkontrolle“<br />
gegen Alkohol am Steuer<br />
«<br />
Wenn ich fahr',<br />
dann trink' ich<br />
nichts, und wenn<br />
ich trink', dann<br />
fahr ich nicht!<br />
«<br />
Der Slogan der Kampagne<br />
von ORF und<br />
Gemeindebund<br />
Tragödien auf Österreichs Straßen<br />
kommt.<br />
Die Gemeinden sind für die Sicherheit<br />
der Bürgerinnen und Bürger in unseren<br />
Gemeinden mitverantwortlich! „Die<br />
Tragödie, die sich am heurigen Ostersonntag<br />
in der Steiermark ereignet hat<br />
- bei der ein alkoholisierter Lenker, der<br />
mit seinem Wagen in eine Blasmusikkapelle<br />
gerast ist, zwei Menschen getötet<br />
und sieben weitere verletzt hat - ist<br />
ebenso trauriger wie aktueller Anlass<br />
dafür, dass wir gemeinsam alle erdenk-<br />
lichen Vorkehrungen und<br />
Begleitmaßnahmen treffen,<br />
um einen Wiederholungsfall<br />
zu verhindern.<br />
Aufklärung und Information<br />
über die immense<br />
Gefahr von Alkohol am<br />
Steuer und die Notwendigkeit<br />
der Selbstkontrolle<br />
zählen zu den wichtigsten<br />
Schritten im Kampf gegen<br />
den Unfalltod auf der<br />
Straße. Für die Verkehrssicherheit<br />
in unseren Gemeinden ist<br />
„Alkoholselbstkontrolle“ von größerer<br />
Bedeutung denn je. Aus diesem Grund<br />
unterstützt der Österreichische<br />
Gemeindebund die Fortsetzung dieser<br />
wichtigen Kampagne“, so Präsident<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer, der sich in<br />
einem Brief an alle BürgermeisterInnen<br />
Österreichs mit der Bitte um tatkräftige<br />
Unterstützung und Thematisierung im<br />
Interesse der Bürger wandte.<br />
Mehr Information auf<br />
www.gemeindebund.at und unter<br />
http://events.orf.at/events/<br />
KOMMUNAL 71
„Wenn ich fahr´,<br />
dann trink´ ich nicht,<br />
wenn ich trink´,<br />
dann fahr´ ich nicht!“<br />
heimatwerbung
Sicherheit<br />
Private Radarüberwachung heißt:<br />
modernste mobile Radarüberwachung<br />
auf Abruf<br />
Private Radarüberwachung in den Gemeinden<br />
Für mehr Sicherheit<br />
auf Gemeindestraßen<br />
Immer mehr Gemeinden beauftragen private Unternehmen mit der Radarüberwachung<br />
auf Gemeindestraßen. Erste Erfahrungen zeigen, dass den Gemeinden dabei die<br />
Unterstützung der Bevölkerung gewiss ist. Es geht nämlich nicht um mutwilliges<br />
Abkassieren, sondern um mehr Sicherheit für die Einwohner.<br />
◆ KOMMUNAL-Redaktion<br />
Jeder sieht es (und tut es mitunter<br />
auch selbst): kaum jemand hält sich an<br />
die zugelassene Geschwindigkeit. Auch<br />
in den Bereichen der Wohnstraßen halten<br />
sich viele nicht an die verordnete<br />
Schrittgeschwindigkeit, Eltern rasen<br />
mit ihren Kindern zur Schule oder zum<br />
Kindergarten und gefährden die anderen<br />
Kinder. Als Ergänzung zur Gendarmerie<br />
werden private Radarüberwachungsfirmen<br />
beauftragt, mit mobilen<br />
Geräten Verkehrssündern auf den Zahn<br />
zu fühlen und für mehr Verkehrssicherheit<br />
zu sorgen.<br />
Manche Gemeinden<br />
haben bereits die Ein-<br />
führung einer ständigen<br />
und mobilen Radarüberwachung<br />
im gesamten<br />
Ortsgebiet beschlossen.<br />
Eine private<br />
Radarüberwachungsfirma<br />
wird dabei mit<br />
scharfen Kontrollen und<br />
mit der Anzeigenerstattung<br />
bei der Bezirkshauptmannschaftbeauftragt.<br />
Durch geeichte<br />
Geräte und geschultes<br />
Personal ist diese private<br />
Firma rechtlich der<br />
Gendarmerie gleichgestellt. Eventuelle<br />
Mehreinnahmen aus den Strafen (die<br />
74 KOMMUNAL<br />
Manche Firmen<br />
bieten interessierten<br />
Gemeinden ein<br />
kostenloses Beratungsgespräch<br />
mit<br />
einer Präsentation der<br />
Radartechnik und 2<br />
Stunden Überwachung<br />
gratis an.<br />
Überwachungsfirma kostet natürlich<br />
etwas) werden für weitere Maßnahmen<br />
zur Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit<br />
(elektronische Anzeigetafeln,<br />
Markierungen, Umbauten,<br />
Zebrastreifen, etc.) verwendet.<br />
Was es bringt und<br />
was es kostet<br />
Die einschlägigen Firmen bieten den<br />
Gemeinden ein umfassendes Leistungspaket<br />
an und erstellen<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
der Gemeinde Gefahren-<br />
zonenanalysen. Private<br />
Radarüberwachung<br />
heißt: modernste mobile<br />
Radarüberwachung auf<br />
Abruf, keinerlei Anschaffungs-<br />
und Wartungskosten,<br />
Erstellung der<br />
Anzeigen und Weitergabe<br />
an die Gemeinde,<br />
Archivierung der Anzeigen<br />
gemäß Datenschutzgesetz,monatliche<br />
statistische Auswertung<br />
über Verkehrsaufkommen<br />
und<br />
Geschwindigkeitsübertretungen auf<br />
Anfrage. Die Einnahmen bleiben zur<br />
Gänze bei den Gemeinden.<br />
Die Messungen erfolgen mit einem<br />
mobilen Radarkasten, der gut sichtbar<br />
am Straßenrand (gemäß Straßenverkehrsordnung)<br />
aufgestellt wird, und<br />
einem speziellen Überwachungsauto,<br />
das in Sichtweite postiert wird. Das<br />
Radarauto, das mit modernster Software<br />
und kompletter Infrastruktur ausgestattet<br />
ist, gewährleistet eine schnelle<br />
Bearbeitung der Geschwindigkeitsübertretungen<br />
vor Ort. Alle Eckdaten und<br />
beste Bildqualität werden der Bezirkshauptmannschaft<br />
weitergeleitet,<br />
wodurch die Anzeigen eins zu eins<br />
bearbeitet werden können.<br />
Bei einer Innsbrucker Firma beispielsweise<br />
bucht die Gemeinde ein Jahresstunden-Kontingent,<br />
welches nach dem<br />
gemeinsam erarbeiteten Einsatzplan<br />
abgearbeitet wird. Der Stundensatz des<br />
Unternehmens liegt dabei bei 160 Euro.<br />
Erste Erfahrungen zeigen, dass unzählige<br />
Anonymverfügungen bearbeitet<br />
werden können, was sich im Gemeindebudget<br />
äußerst positiv auswirkt.<br />
Aufgrund der häufigen Überwachung<br />
und regelmäßigen Präsenz ist eine<br />
wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation<br />
festzustellen und somit kann<br />
das Ziel - mehr Sicherheit für die Bevölkerung<br />
- innerhalb weniger Monate<br />
erreicht werden.
Fachbuch<br />
<strong>Kommunal</strong>e Baumkontrolle<br />
Leitfaden für mehr<br />
Verkehrssicherheit<br />
Dieses Buch befasst sich im<br />
Wesentlichen mit den Aufgaben<br />
des Baumkontrollors in<br />
einer Kommune und schließt<br />
somit eine Lücke. Im Gegensatz<br />
zum Sachverständigen<br />
muss der kommunale Baumkontrollor<br />
pro Tag eine<br />
große Anzahl an Bäumen<br />
kontrollieren und innerhalb<br />
weniger Minuten die möglichen<br />
Gefahren für die verkehrssicherheit<br />
erkennen.<br />
Aus der jahrelangen Zusammenarbeit<br />
der (Hamburger)<br />
Fachamts für Stadtgrün und<br />
Erholung mit dem (Hamburger)<br />
Institut für Baumpflege<br />
ist ein Praxishandbuch entstanden,<br />
das dem kommunalen<br />
Baumkontrollor in<br />
vielfältiger Hinsicht eine Hilfestellung<br />
für seine tägliche<br />
Arbeit gibt.<br />
Das Buch ist umfangreich<br />
bebildert und<br />
gibt praktische Hinweise zur<br />
Organisationund Durchführung<br />
von Baumkontrollen<br />
und auch -untersuchungen.<br />
Zudem zeigt es die allegemeinen<br />
Defektsymptome<br />
in der Krone, am Stamm<br />
und am Stammfuß, an Wurzeln<br />
und im Baumumfeld in<br />
Form einer Chekliste.<br />
Das Buch<br />
Fachamt für Stadtgrün<br />
und Erholung Hamburg,<br />
Hrsg., „<strong>Kommunal</strong>e<br />
Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit“,<br />
Verlag<br />
Thalacker 2004, Postfach<br />
8364, 38133 Braunschweig,<br />
Deutschland<br />
ISBN 3-87815-202-7<br />
Abfallberater des Jahres<br />
Der Preis geht nach Radkersburg<br />
Das Umwelt-Engagement der<br />
mehr als 320 österreichischen<br />
Abfallberater wird jedes Jahr<br />
von der ARA mit der Auszeichnung<br />
„Abfallberater des<br />
Jahres“ honoriert. Heuer geht<br />
der Umweltpreis an Ing. Wolfgang<br />
Haiden vom Abfallwirtschaftsverband<br />
Radkersburg!<br />
Der Preis „Abfallberater des<br />
Radkersburgs Bgm. Alfred<br />
Schuster (rechts) mit den<br />
Abfall-/Umweltberatern des<br />
AWV Radkersburg Rupert<br />
Tamisch (links) und Ing. Wolfgang<br />
Haiden mit der ARA<br />
Auszeichnung (Mitte)<br />
Jahres“ wird jährlich von der<br />
Altstoff Recycling (ARA) und<br />
vom Umweltmanager-Magazin<br />
Umweltschutz unter der<br />
Patronanz von Umweltminister<br />
Josef Pröll vergeben. Der<br />
hochrangigen Jury gehörten<br />
u.a. Vertreter des Umweltministeriums,<br />
des Städte- und<br />
Gemeindebundes, der WU<br />
Wien, des Verbandes der<br />
österreichischen Umwelt- und<br />
Abfallberater, der ARGE Müllvermeidung<br />
und des ARA-<br />
Systems an. In der Kategorie<br />
„Innovative Projekte“ überzeugte<br />
das Umweltschulprojekt<br />
„MISTI - Der Abfallmeister“,<br />
bei dem alle Schulen<br />
des Bezirkes Radkersburg mit<br />
einem einheitlichen Abfalltrennsystem<br />
in Selbstbauweise<br />
ausgestattet wurden, die Jury.<br />
„Für den Innovationspreis ist<br />
Kreativität eines der wichtigsten<br />
Kriterien. Das Siegerprojekt<br />
des AWV Radkersburg<br />
erfüllte unsere Kriterien<br />
durchgehend“.<br />
Foto: Walter Grossmann<br />
Info-Mix<br />
Ottfried Fischer und die Mysterien der österreichischen <strong>Kommunal</strong>politik.<br />
Der große bayrische Schauspieler läßt auch beim Fotoshooting<br />
das Unterhalten nicht. Sein Kommentar, als ihm Sabine<br />
Brüggemann vom KOMMUNAL-Team einige Statistiken unseres<br />
Fachmagazins zeigte: „... und immer normal dreinschauen“.<br />
Unterhalter aus Leidenschaft<br />
... und immer normal<br />
dreinschauen<br />
Wer kennt ihn nicht, den<br />
„Bullen von Tölz“? Ottfried<br />
Fischer dreht derzeit in Wien<br />
den Film „Der Bestseller –<br />
Wiener Blut“. Der Streifen<br />
handelt vom Bestseller-Krimiautor<br />
Leo Leitner<br />
(Fischer), der einen Wien-<br />
Besuch zur Lösung seiner<br />
Schreibblockade nützen soll.<br />
Als bei einer Veranstaltung<br />
zu seinen Ehren ein Toter<br />
gefunden wird, glaubt er<br />
natürlich sofort an Mord und<br />
beginnt zu recherchieren.<br />
Sein ständiger Begleiter in<br />
Wien ist der Fiaker-Kutscher<br />
Karl Kraus (dargestellt von<br />
Burgschauspieler Robert<br />
Meyer), der den Ur-Bayern<br />
über so manche delikate Verstrickungen<br />
und Verhältnisse<br />
der „Wiener Society“ aufklärt,<br />
die immer wieder ein<br />
neues Licht auf den Todesfall<br />
werfen.<br />
Schlußendlich sind dann<br />
schon alle verdächtig, auch<br />
der Leibkutscher Kraus.<br />
Und hier kommt der Zufall<br />
ins Spiel...<br />
Eigentlich: Und Mitte Juni<br />
wollte es das Drehbuch, dass<br />
die Crew der Produzenten<br />
von Lisa Film eine Szene in<br />
der Wiener Löwelstraße vor<br />
dem Bundeskanzleramt<br />
(dem echten und nicht dem<br />
gleichnamigen Haubenlokal)<br />
vorbereitete. Und das ist<br />
praktisch auch vor der Haustür<br />
von KOMMUNAL.<br />
Wie Ottfried Fischer zum<br />
KOMMUNAL kommt?<br />
Ganz einfach: Unsere Redaktion<br />
liegt direkt neben dem<br />
Tatort und so konnte es nicht<br />
ausbleiben, dass unsere Mitarbeiter<br />
Sabine Brüggemann,<br />
Johanna Ritter und Walter<br />
Grossmann, als sie morgens<br />
ins Büro gehen wollten, als<br />
mögliche Augenzeugen<br />
befragt wurden.<br />
KOMMUNAL 75
Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau<br />
Das OISS<br />
informiert<br />
Die Themen dieser <strong>Ausgabe</strong> umfassen: Sport und Umwelt,<br />
Sicherheit in Fußballstadien, Laufstrecken, Schulbaureise,<br />
Schultafeln sowie Schulfreiräume.<br />
Arbeitsgruppe Sport &<br />
Umwelt: Das ÖISS hat eine<br />
Arbeitsgruppe zur Feststellung<br />
von Maßnahmen zur Gestaltung<br />
eines umweltgerechten<br />
Sportstättenbaues ohne Einschränkung<br />
der Sportfunktionalität<br />
ins Leben gerufen.<br />
Diese Maßnahmen beginnen<br />
bei einer auf Nachhaltigkeit<br />
ausgerichteten Planung von<br />
wegweisend.<br />
76 KOMMUNAL<br />
Hochbauten und Freianlagen<br />
und reichen bis zu Pflege,<br />
Instandhaltung und Entsorgung.<br />
Das ÖISS sucht noch<br />
engagierte Mitarbeiter aus<br />
einschlägigen Institutionen<br />
zur fachlichen Ergänzung dieses<br />
Arbeitskreises.<br />
Sicherheit in Fußballstadien:<br />
Die österreichische<br />
Signflash<br />
Bundesliga legt anlässlich<br />
aktueller Vorfälle bei Fußballspielen<br />
vermehrt großes<br />
Augenmerk auf die Sicherheit<br />
von Besuchern und Aktiven.<br />
So werden hinsichtlich<br />
Personensicherheit hohe<br />
Maßstäbe an Organisation,<br />
Baulichkeiten, Ordnerdienste<br />
und personelle Betreuung<br />
gelegt. Dabei wird insbeson-<br />
ÖISS – Schulreise 2004<br />
Hauptschule Hallein<br />
BSZ Kirchdorf<br />
Blinkeinrichtung für Schutzweg-Verkehrszeichen<br />
• Balken mit integrierten Leuchtdioden zur Montage<br />
auf bestehende Verkehrszeichen<br />
Vertrieb in Österreich:<br />
W. BAYER + CO Gesellschaft m b H<br />
A-4523 Neuzeug, Sierninghofenstr. 76 · Telefon 07259 2379-0 · Fax 07259 2379-42<br />
verkauf@bayer.co.at · www.bayer.co.at<br />
dere die Fluchtwegesituation<br />
einer genauen Inspektion<br />
unterzogen. Die ÖISS-Datensysteme<br />
GesmbH testet<br />
bereits jetzt die Stadionprojekte<br />
für die Fußball Europameisterschaft<br />
2008 auf ihre<br />
Eignung.<br />
Laufstreckenkennzeichnung:<br />
Im Auftrag des BKA<br />
• Leuchtdioden blinken abwechselnd gelb im oberen und unteren Balken,<br />
wenn sich Fußgänger im Bereich des Schutzweges befinden<br />
• Wartungsfreie Stromversorgung mittels Solarzelle und Akku<br />
• Einfache Montage - keine Kabelverlegung im Bodenbereich notwendig<br />
• SIGNFLASH auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird durch<br />
drahtlose Signalübertragung ausgelöst<br />
D. Swarovski & Co<br />
Produktgruppe Swareflex<br />
A-6112 Wattens/Austria · Tel. 05224 500-2463 · Fax 05224 500-2370<br />
swareflex.office@swarovski.com · www.swareflex.com
Staatssekretariat für Sport<br />
entwickelt eine Arbeitsgruppe<br />
unter der Leitung des<br />
ÖISS eine österreichweite<br />
einheitliche Laufstreckenkennzeichnung.<br />
Die unter<br />
den Gesichtspunkten einer<br />
guten Erkenn- und Lesbarkeit<br />
erstellten Entwürfe der<br />
Orientierungshilfen, die<br />
zusätzlich Informationen zur<br />
Schwierigkeit und Länge der<br />
Strecke enthalten, werden<br />
Kontakt<br />
ÖISS Zentrale Wien<br />
Direktor:<br />
DI Peter Gattermann,<br />
Haus des Sports<br />
Prinz Eugen Straße 12,<br />
A-1040 Wien<br />
T: 01/5058899 DW 10-15<br />
F: 01/505 88 99 DW 20<br />
E-Mail: office@oeiss.org<br />
Besuchen Sie unsere<br />
Homepage: www.oeiss.org<br />
nun auf ihre Tauglichkeit in<br />
der Praxis geprüft. Ziel der<br />
einheitlichen Kennzeichnung<br />
ist ein positiver sportlicher<br />
sowie touristischer Effekt.<br />
Schulbaureise 2004: Die<br />
Schulbaureise 2004 führt<br />
nach einem Kurzbesuch in<br />
Niederösterreich zu Schwerpunkten<br />
in Oberösterreich<br />
und Salzburg; als besonderes<br />
„Zuckerl“ steht ein Tagesausflug<br />
zu interessanten<br />
Schulbauten in Bayern auf<br />
dem Programm.<br />
Programm:<br />
◆ Gymnasium Enns<br />
◆ Musikschule Gunskirchen<br />
◆ Gymnasium Passau (D)<br />
◆ Montessorischule Aufkirchen<br />
(D)<br />
◆ Gymnasium und Gastro-<br />
Berufsschule Erding (D)<br />
◆ Grund- und Hauptschule<br />
München-Riem (D)<br />
◆ Pädagogische Akademie<br />
Salzburg<br />
◆ Tourismusschule Klessheim<br />
◆ Hauptschule Hallein<br />
◆ HBLA Ried am Wolfgangsee<br />
◆ BSZ Kirchdorf (Bauherren-Preis<br />
2003)<br />
◆ Mehrzweckhalle d. PrivatgymnasiumsDachsberg<br />
Termin: 28. September bis<br />
1. Oktober 2004<br />
Kosten: 480,- Euro<br />
Das ÖISS lädt alle interessierten<br />
LeserInnen herzlich<br />
dazu ein!<br />
Die der GFEsichertIhnen Durchführung der Geschwindigkeitskontrollen Topqualität und Seriosität bei<br />
Ihrer Gemeinde mittels modernster Radartechnik und in<br />
unseres ten Teams geschulten zu. Für interessierte und geprüf-<br />
einer Präsentation der Radar-<br />
Gemeinden bieten wir ein kostenloses<br />
Beratungsgespräch mit<br />
Schultafeln und Sicherheit.<br />
Reagierend auf die tragischen<br />
Unfälle mit Schultafeln<br />
hat das ÖISS eine Diskussionsplattform<br />
und einen<br />
Arbeitskreis zu diesem<br />
Thema eingerichtet. Das<br />
erste Ergebnis ist die neue<br />
ÖISS Richtlinie "Schultafeln<br />
und Sicherheit", die u.a. für<br />
bestehende bewegliche<br />
Schultafeln (Flügeltafeln,<br />
Universaltafeln, etc.) Sicherungselemente<br />
fordert. Die<br />
neue Richtlinie steht unter<br />
http://www.oeiss.org/oeiss_<br />
dok/Formulare/Schultafeln.pdf<br />
zum <strong>Download</strong><br />
bereit.<br />
www.schulfreiraum.com:<br />
heißt die neue Homepage<br />
des ÖISS, die speziell den<br />
Schulfreiräumen gewidmet<br />
ist. Auf dieser Seite stehen<br />
das Handbuch "Schulfreiraum<br />
- Freiraum Schule"<br />
sowie der Beratungskatalog<br />
des ÖISS zum freien <strong>Download</strong><br />
zur Verfügung.<br />
technik und 2 Stunden<br />
Überwachung gratis. Die schwindigkeitsübertre gemessenen Getungenßend<br />
sofort können der anschliehauptmannschaftBezirksgeleitet<br />
werden. weiter-<br />
24 Stunden Gratis-Infohotline: 0800-800 133<br />
Zweigniederlassungen in allen Bundesländern · E-Mail: zentrale@gfe.co.at · www.gfe.co.at<br />
SSP Schwerpunkte<br />
Heft 3/2004<br />
In der nächsten <strong>Ausgabe</strong><br />
von „Schule & Sportstätte“<br />
(erscheint am 25.<br />
August 2004) berichten<br />
wir unter anderem über<br />
◆ Tagung Schulfreiräume<br />
– Freiraum<br />
Schule<br />
◆ Schule und Architektur<br />
◆ Vorarlberger Sportstätten<br />
- Modern aber<br />
kostensparend<br />
schule<br />
sportstätte &<br />
Sichern Sie sich schon<br />
jetzt Ihren Werbeauftritt<br />
im „sportlichen“ Schwestermagazin<br />
von<br />
KOMMUNAL:<br />
Tel:01/532 23 88-11,<br />
Fax. 01/5322377<br />
johanna.ritter@<br />
kommunal.at<br />
GFE-Privat-Radar<br />
jagt Temposünder im Auftrag der Gemeinden.<br />
GFE–ÖsterreichweitihrPartnerfürmehrSicherheit<br />
KOMMUNAL 77
Wirtschafts-Info<br />
So können Gemeinden ihre Zinsaufwendungen steuern<br />
Ist der EURIBOR derzeit<br />
wirklich attraktiv?<br />
Bei der im Augenblick günstigen Lage des 6-Monats-EURIBOR darf nicht übersehen<br />
werden, dass diese indikatorengebundene Finanzierungsform halbjährlich an die<br />
aktuelle Marktsituation angepasst wird.<br />
Der derzeitige 6-Monats-EURIBOR liegt<br />
bei knapp über 2 %. Dies wird von vielen<br />
Entscheidungsträgern als attraktive<br />
Verzinsung für die Finanzierungen des<br />
Gemeindehaushalts eingeschätzt. Es darf<br />
dabei aber nicht übersehen werden, dass<br />
bei dieser indikatorgebundenen Finanzierung<br />
die Verzinsung halbjährlich an<br />
die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst<br />
wird und sich der 6 Monats EURI-<br />
BOR seit Anfang der 1990er Jahre zwischen<br />
11 % und 2 % bewegt hat.<br />
Eine Ausschreibung, die heute auf Basis<br />
des 6Monats EURIBORs getätigt wird,<br />
kann somit schon zum nächsten Zinsfeststellungstag<br />
zu einem höheren Zinsaufwand<br />
führen, und damit weniger<br />
Beispiel:<br />
Eine Gemeinde hat vor 7 Jahren eine<br />
Finanzierung mit einem Fixzinssatz<br />
von 5,00 % aufgenommen.<br />
Vor dem Hintergrund des aktuell niedrigen<br />
EUR-Zinsniveaus und der Meinung,<br />
dass dieses auch für die Restlaufzeit von<br />
3 Jahren noch anhalten wird, entscheidet<br />
sich die Gemeinde für ein „Drehen“ des<br />
Fixzinssatzes von 5,00 % in eine variable<br />
Verzinsung von 6-Monats-EURIBOR +<br />
1,50 %.<br />
Aktuell (6-M-EURIBOR per 4.6.2004:<br />
2,17 %) bedeutet das einen Zinssatz von<br />
3,67% und zumindest für die ersten 6<br />
Monate eine beträchtliche Zinsersparnis<br />
gegenüber dem Fixzinssatz. Steigt der 6-<br />
M-EURIBOR während der Restlaufzeit<br />
nicht über 3,50%, bleibt die Zinsenbelastung<br />
nachhaltig unter dem ursprünglichen<br />
Fixzinssatz. Selbst ein kurzzeitiges<br />
Ansteigen über diese Grenze könnte<br />
durch „Zinsgewinne“ in Zeiten niedrigen<br />
Zinsniveaus kompensiert werden.<br />
78 KOMMUNAL<br />
attraktiv als ursprünglich wirken. Ausgehend<br />
von heutigen Berechnungen<br />
könnte der 6-Monats-EURIBOR bereits<br />
in 2 Jahren bei 4,25 % liegen.<br />
Entscheidung mit<br />
professioneller Hilfe<br />
Das Entscheidungskriterium dafür, ob<br />
die variable Verzinsung einem Fixzinssatz<br />
vorzuziehen ist, ist die künftige<br />
Entwicklung des EURIBORS, für die es<br />
zwar Prognosen, selbstverständlich<br />
aber keine Garantien gibt. Unerlässlich<br />
für eine solche Entscheidung ist daher,<br />
eine Zinsmeinung zu besitzen oder mit<br />
professioneller Hilfe zu entwickeln. Die<br />
BA-CA <strong>Kommunal</strong>spezialisten beraten<br />
Sie diesbezüglich gerne!<br />
<strong>Kommunal</strong>es<br />
Finanzmanagement<br />
Ein umsichtiges kommunales Finanzmanagement<br />
beschäftigt sich natürlich<br />
nicht nur mit Neufinanzierungen, sondern<br />
insbesondere auch mit dem bestehenden<br />
Finanzierungsportefeuille. Die<br />
Rahmenbedingungen, unter denen vor<br />
einigen Jahren Finanzierungen ausgeschrieben<br />
und eingegangen wurden,<br />
sind sehr wahrscheinlich heute verändert,<br />
sowohl was die Zinsniveaus, aber<br />
auch was die Prognosen betrifft.<br />
Die Spezialisten der Bank Austria Creditanstalt<br />
helfen Ihnen gerne dabei, Ihr<br />
Portfolio hinsichtlich der bestehenden<br />
Zinszahlungsmodalitäten zu analysieren.<br />
Auf Basis dieser Analyse unterstützen<br />
Sie die Spezialisten der BACA<br />
gerne, aus einer Vielzahl von Absicherungs-<br />
oder Optimierungsinstrumenten<br />
die für Sie geeigneten Produkte auszuwählen,<br />
wobei i.d.R. lediglich eine<br />
Änderung der Zinszahlungsmodalitäten<br />
erfolgt, das Grundgeschäft aber unverändert<br />
bleibt.<br />
Bank Austria Creditanstalt<br />
ist Ihr Partner<br />
Die Analyse von bestehenden Zinspositionen,<br />
aber auch die im Vorfeld von<br />
Ausschreibungen notwendigen Informationen<br />
stellt die Verantwortlichen in<br />
den Kommunen vor große Herausforderungen.<br />
Schon vor den Ausschreibungen stellen<br />
die Spezialisten der BACA den Entscheidungsträgern<br />
die für die Entwicklung<br />
einer Zinsmeinung notwendigen<br />
Marktinformationen zur Verfügung,<br />
sodass die Kommune die Ausschreibung<br />
optimal gestalten kann. Denn<br />
eine Einschätzung zur künftigen Zinsentwicklung<br />
ist dabei ein zentrales Entscheidungskriterium!<br />
Auf Wunsch liefert Ihnen die BACA aufbereitete<br />
Analysen der bestehenden<br />
Positionen und Produktvorschläge und<br />
präsentiert diese in Ihren Gremien. Die<br />
aktuellsten Marktdaten, sodass Ihre<br />
Gemeinde stets am Puls der Zeit ist,<br />
sind selbstverständlich.<br />
Informationen:<br />
Christoph Schulz<br />
Abteilung Treasury Sales<br />
Telefon: 050505/82870<br />
E-Mail: christoph.schulz@<br />
ba-ca.com<br />
Mag. Wolfgang Figl<br />
Unternehmensfinanzierung und<br />
öffentlicher Sektor<br />
Telefon: 050505/44876<br />
E-Mail: wolfgang.figl@ba-ca.com<br />
E.E.
Der Sparkassen-Gemeindefinanzbericht<br />
2004 bringt eines klar auf den Punkt:<br />
Obwohl die kommunalen Finanzschulden<br />
in Plus kletterten (+1,6%) ging der Verschuldungsgrad<br />
zurück. Die Gemeinden<br />
investierten mehr als im Vorjahr und<br />
katapultierten somit die Investitionsquote<br />
auf satte 21% Plus.<br />
Anspannungen durch<br />
Steuerreform<br />
Die Steuerreform 2004/2005 lässt eine<br />
starke Anspannung der Gemeindefinanzen<br />
erwarten. Berechnungen zufolge verlieren<br />
die Gemeinden durch die Steuerreform<br />
6,5% der gesamten Ertragsanteile.<br />
Unverständlich für viele Kommunen ist,<br />
dass sich die Steuerreform nur zu rund<br />
15% durch zusätzliches Wachstum selbst<br />
finanziert und keine Abfederungsmaßnahmen<br />
zugunsten der Gemeinden vorgesehen<br />
sind. Das heißt, dass 85% der<br />
Kosten an den Gemeinden hängen bleiben<br />
werden.<br />
Beim Finanzausgleich<br />
heißt es zu verhandeln<br />
Ohne Gegensteuerung bei den Finanzausgleichsverhandlungen<br />
werden die Gemeinden<br />
mit erheblichen Ertragsanteilverlusten<br />
zu rechnen haben. Den Gesprächen mit Vertretern<br />
des BMF aus Sicht der Gemeinden<br />
eine große Bedeutung zu. Seit der letzten<br />
Steuerreform hat sich das Anteilsverhältnis<br />
stark zugunsten des Bundes verlagert. Die<br />
annähernd gleich hohe Belastung der<br />
Gemeinden gegenüber jener des Bundes ist<br />
unverhältnismäßig. So beträgt der Anteil<br />
der Gemeinden am Finanzausgleich<br />
6.203 Mio. Euro, oder 10 Prozent, wie das<br />
BMF in einer Präsentation verlautbarte.<br />
Die Aufgaben und<br />
das Geld<br />
Während die Gemeinden sich auf Ertragsanteilverluste<br />
einstellen, steigen sowohl<br />
Aufgaben als auch <strong>Ausgabe</strong>n erheblich.<br />
Die Palette der Gemeinde-Verpflichtungen<br />
ist so breit wie noch nie und reicht über<br />
Kinderbetreuung und Altenpflege bis hin<br />
zum öffentlichen Nahverkehr. Gleichzeitig<br />
steigen auch die Kosten für das Gesundheitswesen<br />
und die Sozialhilfe zum Teil<br />
um zweistellige Prozentsätze. Um diese<br />
Anforderungen bewältigen zu können,<br />
bedarf es moderner Finanzierungsmodelle.<br />
<strong>Kommunal</strong>e Aufgaben:<br />
Langfristige Finanzierung<br />
Österreichs Gemeinden haben mit Unterstützung<br />
der <strong>Kommunal</strong>kredit ihre Finanzierungen<br />
innerhalb weniger Jahre auf<br />
eine moderne Basis gestellt. Die jeweils<br />
besten international angewandten und in<br />
der Praxis bewährten Finanzierungsformen<br />
werden den Kommunen angeboten.<br />
Stichwort Finanzierung: dies ist insbeson-<br />
Wirtschafts-Info<br />
Pollutec East & Central Europe & Public Services/<strong>Kommunal</strong>messe<br />
Neue Wege für<br />
kommunale Finanzen<br />
Im Rahmen der ersten interregionalen <strong>Kommunal</strong>messe von 10.-12. 11. 2004<br />
im MessezentrumWienNeu werden den Kommunen Chancen und Wege aufgezeigt, gut<br />
beraten in die finanzielle Zukunft zu gehen.<br />
MessezentrumWienNeu: Erste interregionale <strong>Kommunal</strong>messe im November.<br />
dere hierbei wichtig, da Kommunen<br />
gegenüber den Privaten einen Ratingvorteil<br />
nutzen, der insbesondere vor dem<br />
Hintergrund Basel II zum Finanzierungsvorteil<br />
wird und die Zinsbelastung senkt.<br />
Bei der ersten interregionalen <strong>Kommunal</strong>messe,<br />
Pollutec & Public Services,<br />
kann Österreich seine Erfahrungen an die<br />
neuen EU-Nachbarländer weitergeben.<br />
Denn die größten Investitionssummen<br />
fallen in diesen Ländern im kommunalen<br />
Bereich an. Wasserver- und Entsorgung,<br />
Luftreinhaltung und Abfallentsorgung<br />
sind die wichtigsten Themen. Um den<br />
enormen Aufholbedarf decken zu können,<br />
müssen die neuen EU-Mitgliedsländer<br />
neue Finanzierungswege beschreiten.<br />
Informationen:<br />
Reed Messe Wien<br />
Messeleiter:<br />
Ing. Wolfgang Ambrosch<br />
Tel.: 01/ 727 20 - 351<br />
public-services@messe.at<br />
pollutec@messe.at<br />
www.public-services.at<br />
www.pollutec.at<br />
KOMMUNAL 79<br />
Foto: MBG/Rappersberger<br />
E.E.
ONE BUSINESS<br />
VORSPRUNG INKLUSIVE.<br />
ONE BUSINESS | LÖSUNGEN, SO<br />
BESONDERS WIE IHRE GEMEINDE.<br />
ANGEBOTE<br />
NACH MASS<br />
0800 699 999<br />
BUSINESS@ONE.AT<br />
WWW.ONE.AT<br />
So wie kein Mensch dem anderen gleicht, ist auch jede Gemeinde verschieden:<br />
vor allem hinsichtlich Größe, Anzahl der Gemeindebediensteten, Bevölkerungsstruktur<br />
und Kommunikationsverhalten. Ihre Gemeinde braucht daher nicht<br />
irgendeinen Tarif, sondern einen maßgeschneiderten. Auf Wunsch analysiert<br />
Ihr ONE Business Berater das Telefonieverhalten in Ihrer Gemeinde und macht<br />
Ihnen ein Angebot, das speziell auf die Bedürfnisse abgestimmt ist. Damit auch<br />
Ihre Gemeinde das Optimierungspotenzial nutzen kann. Weitere Informationen<br />
erhalten Sie auf www.one.at/gemeinde.
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
Alten- und Pflegeheime: Vorarlberg geht neue Wege<br />
Benevit hilft Gemeinden bei Pflege<br />
DORNBIRN<br />
Der Vorarlberger Gemeindeverband<br />
hat 2002 die gemeinnützigeBenevit-Pflegemanagement<br />
GmbH gegründet.<br />
Die Gesellschaft unterstützt<br />
und berät Gemeinden<br />
beim Bau und Betrieb von<br />
Alten- und Pflegeheimen.<br />
Benevit bietet Beratung bei<br />
der Entwicklung neuer Konzepte,<br />
bei Bauvorhaben und<br />
der Betriebsführung von<br />
Alten- und Pflegeheimen an,<br />
sowie Fort- und Weiterbildung<br />
des Personals. Betreiber kön-<br />
Gehaltserhöhung<br />
Bescheidene<br />
Politiker<br />
WIEN<br />
Die Gehälter der Politiker<br />
werden ab 1. Juli um ein<br />
Prozent angehoben. Damit<br />
beweisen die Volksvertreter<br />
laut Rechnungshof – abermals<br />
– Bescheidenheit, pendeln<br />
doch die Erhöhungen in<br />
„normalen“ Jobs, also für<br />
Lohn- und Gehaltsabschlüsse,<br />
heuer generell rund um die<br />
Zwei-Prozent-Marke.<br />
Mahnfeuer: Für die Schutzgebiete in den Alpen<br />
Von WIEN bis NIZZA<br />
Auch 2004 will „Feuer in den<br />
Alpen“ ein alpenpolitisches<br />
Ausrufezeichen setzen. Diesmal<br />
stehen die Schutzgebiete<br />
der Alpen im Vordergrund.<br />
Die Mahnfeuer sind<br />
ausserdem ein Sym-<br />
E-Government: Erfolgreicher Export<br />
WIEN<br />
Die Schweizerischen<br />
Bundesbahnen (SBB)<br />
setzen seit März 2004<br />
die in Österreich für<br />
das Fundwesen entwickelte<br />
E-Government<br />
Lösung „fundamt.gv.at“<br />
auf ihrem Streckennetz<br />
ein. Dieser neue Service<br />
wurde von den Passagieren<br />
der SBB sofort<br />
nach dem Start äußerst<br />
positiv angenommen<br />
nen aber auch verschiedene<br />
Leistungen des Unternehmens<br />
in Anspruch nehmen, von Reinigung<br />
über Einkauf und<br />
Catering bis zur Gebäudeverwaltung<br />
und Heimleitung.<br />
Nach rund eineinhalb Jahren<br />
des Bestehens der Gesellschaft<br />
kann Benevit-Geschäftsführer<br />
Kaspar Pfister eine beachtliche<br />
Bilanz vorweisen. Die<br />
Pflegemanagement GmbH<br />
betreibt mittlerweile in Vorarlberg<br />
zwei Heime in Rankweil<br />
und Alberschwende und<br />
wurde von beiden Gemein-<br />
„Fundamt goes Suisse“<br />
Feuer in den Alpen<br />
und häufig genutzt. Pro<br />
Monat werden rund<br />
9.000 Verlustmeldungen<br />
eingebracht und<br />
rund 4.500 Fundgegenstände<br />
erfasst. Mit „fundamt.gv.at“<br />
wurde ab 1.<br />
Februar 2003 in Österreich<br />
das Fundwesen<br />
revolutioniert. Städte,<br />
Gemeinden und Business<br />
Partner nutzen<br />
bereits intensiv diese<br />
Anwendung.<br />
Putzen für mehr<br />
Tauchzonen im<br />
Salzkammergut.<br />
den mit dem Neubau von<br />
Heimen beauftragt.<br />
Und Benevit hat sich bereits<br />
bis in andere Bundesländer<br />
herumgesprochen. Im Juli<br />
2003 hat Benevit ein Altersund<br />
Pflegeheim in Wiener<br />
Neustadt und ein Pflegeheim<br />
in Mayerling übernommen.<br />
„Inwieweit sich die intelligente<br />
Planung eines Hauses<br />
auf den effizienten und sparsamen<br />
Betrieb auswirkt, zeigt<br />
sich erst, wenn das Heim in<br />
Betrieb ist,“ gibt Kaspar Pfister<br />
aber zu bedenken.<br />
bol der Solidarität zwischen<br />
den Alpenländern und -regionen.<br />
Sie sollen in der Nacht<br />
vom 14./15. August von Wien<br />
bis Nizza möglichst zahlreich<br />
lodern. Infos unter http://<br />
www.feuerindenalpen.org<br />
Nahversorgung<br />
Greissler weiter<br />
auf dem Rückzug<br />
Bundesforste: Unter Wasser putzen<br />
Wenn Taucher tauchen<br />
SALZKAMMERGUT<br />
Die Österreichische<br />
Bundesforste AG (ÖBf)<br />
und die IG Tauchen<br />
haben einen Vertrag<br />
unterzeichnet, in dem<br />
die Nutzung vor allem<br />
der schönsten Salzkammergut-Seen<br />
für den<br />
Tauchsport geregelt<br />
wird. Beide Seiten<br />
gewinnen durch den<br />
Vertrag: an den meisten<br />
Seen werden die Tauch-<br />
Kaspar Pfister, Benevit-<br />
Geschäftsführer: „Die durch<br />
Benevit erzielten Einsparungen<br />
werden erst langfristig in<br />
den Gemeindebudgets spürbar<br />
sein.“<br />
WIEN<br />
Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte<br />
ist 2003 um 166<br />
gesunken. Derzeit bringen<br />
Greissler nur mehr 10 Prozent<br />
des Umsatzes der Lebensmittelhändler.<br />
Der Rückgang geht<br />
vor allem auf das Konto kleiner<br />
Anbieter (Geschäfte bis<br />
250 m 2 ), große Flächen legen<br />
hingegen zu. Das ergab eine<br />
Studie von AC Nielsen.<br />
zonen erweitert, im<br />
Gegenzug sorgen die<br />
Taucher für die Sauberkeit<br />
der Seen, ein<br />
besonderes Anliegen<br />
der Bundesforste. Der<br />
5-Jahres-Vertrag<br />
umfasst die acht<br />
Gewässer Altausseersee,<br />
Augstsee, Erlaufsee,<br />
Gleinkersee, Grundlsee,<br />
Hallstättersee, Vorderer<br />
Gosausee und Vorderer<br />
Langbathsee.
Porträt<br />
Helga Hammerschmied, Bürgermeisterin von Leogang<br />
Konsequente Arbeit<br />
als Erfolgsbasis<br />
Bis zur Wahl im März 2004 war das Amt des Bürgermeisters in Salzburg fest in<br />
Männerhand. Heute sind es landesweit drei Frauen, die ihrem Ort vorstehen. Eine von<br />
ihnen ist Helga Hammerschmied. Sie wurde am 31. März 2004 von Bezirkshauptfrau<br />
HR Dr. Rosemarie Drexler als Bürgermeisterin von Leogang angelobt.<br />
◆ Walter Grossmann<br />
Bgm. Helga Hammerschmied zieht<br />
das Resümee der ersten Wochen nach<br />
ihrer Wahl: „Seit meinem Amtsantritt<br />
am 1. April kommen rund um die Uhr<br />
Leute aus allen Bereichen zu mir,<br />
bringen ihre Anliegen vor oder<br />
machen ihren Antrittsbesuch. Davon<br />
bin ich sehr positiv überrascht, denn<br />
ich sehe, dass ich als Bürgermeisterin<br />
toll akzeptiert werde.“ Um ganz für<br />
ihre Gemeinde da zu sein, verzichtete<br />
Helga Hammerschmied auf ihren Sitz<br />
im Salzburger Landtag, dem sie eine<br />
halbe Legislaturperiode angehört<br />
hatte und den sie auch weiterhin auf<br />
einem sicheren Listenplatz innegehabt<br />
hätte. „Schon bei meiner Kandidatur<br />
habe ich den Leogangerinnen und<br />
Leogangern versprochen, im Falle<br />
meiner Wahl zur Bürgermeisterin,<br />
ganz für die Gemeinde da zu sein und<br />
mein Landtagsmandat zur Verfügung<br />
zu stellen“, sagt Hammerschmied.<br />
Und was sie verspricht, das hält sie<br />
auch.<br />
Politikerin aus<br />
Leidenschaft<br />
Es war ein langer politischer Weg bis<br />
die gebürtige Saalfeldnerin, die seit<br />
ihrem achten Lebensjahr in Leogang<br />
beheimatet ist, die höchste Verantwortung<br />
in ihrer Gemeinde übertragen<br />
bekam. Begonnen hatte Hammerschmied<br />
ihre politische Tätigkeit als<br />
Ausschussmitglied der SPÖ-Ortsorganisation<br />
Leogang im Jahr 1980. Vier Jahre<br />
später war sie erstmals Mitglied der<br />
82 KOMMUNAL<br />
Helga Hammerschmied, Bürgermeisterin von<br />
Leogang im Pinzgau.<br />
Gemeindevertretung. 1994 wurde sie<br />
zur Vizebürgermeisterin gewählt, eine<br />
Funktion, die sie zehn Jahre lang ausübte.<br />
Ihre Schwerpunkte waren – und<br />
sind es weiterhin – die Gemeindefinanzen,<br />
der Sozialausschuss (als Vorsitzende),<br />
der Bauausschuss und der Tourismusausschuss.<br />
Besonderes Anliegen<br />
war ihr auch die Jugendarbeit in den<br />
Vereinen und so gibt es heute einen<br />
Ausschuss, in dem Angelegeheiten die<br />
Jugend, den Sport und die Vereine<br />
betreffend, behandelt werden.<br />
Leogang in<br />
eigener Sache<br />
Einen Beitrag zum Erfolg, dass die bisher<br />
stets die Minderheit bildende SPÖ<br />
in Leogang erstmals die Mehrheit<br />
schaffte, lieferte laut Bürgermeisterin<br />
Hammerschmied die von ihr 1981<br />
mitgegründete Ortszeitung: „Leogang<br />
in eigener Sache“ (L.I.E.S.). Das<br />
Sprachrohr der Leoganger Sozialdemokraten<br />
L.I.E.S. sei stets ein gutes<br />
Instrument gewesen, um auf Anliegen,<br />
die sonst wahrscheinlich nicht gehört<br />
worden wären, hin zu weisen. „Diese<br />
Zeitung hat mitgeholfen, dass wir<br />
schlussendlich die Mehrheit geschafft<br />
haben“, ist sich Hammerschmied<br />
sicher und fügt hinzu, worauf sie den<br />
Wahlerfolg noch zurückführt: „Unsere<br />
Botschaften – auch in der Wahlwerbung<br />
– haben wir selbst erarbeitet.<br />
Von Leogangern für Leoganger. Die<br />
Leoganger haben das gespürt und<br />
geschätzt.“ Sie sei sicher, „Wähler<br />
spüren das sofort, wenn jemand nicht<br />
identisch mit seinen Aussagen ist.“ Sie<br />
legte Wert auf eine „sehr positive Wahlwerbung<br />
und kein politisches Hickhack.“<br />
Der respektvolle Umgang mit den politischen<br />
Mitbewerbern sei ihr immer schon<br />
ein Anliegen gewesen, ebenso dass Auseinandersetzungen<br />
auf sachlicher Ebene<br />
statt finden.
Im Leoganger Gemeindeamt steht die Tür von Bürgermeisterin Hammerschmied für<br />
die Probleme und Anliegen der Bürger offen.<br />
Möglichkeit zur<br />
Gestaltung<br />
„Als Vizebürgermeisterin kann man sich<br />
etwas wünschen, aber als Bürgermeisterin<br />
mit politischer Mehrheit kann man<br />
gestalten“, beschreibt die sportliche<br />
Naturliebhaberin den wesentlichen<br />
Unterschied zwischen ihrer politischen<br />
Vergangenheit und der Gegenwart und<br />
Zukunft. „Das Amt der Bürgermeisterin<br />
ist mein Beruf, daher kann ich mich<br />
Problemen und Anliegen der Bürger viel<br />
besser widmen“, sagt Hammerschmied.<br />
Um genau sehen zu können, wo in der<br />
Gemeinde der Schuh drückt, sei der<br />
Kontakt zur Bevölkerung das Um und<br />
Auf. Und dieser Kontakt sei naturgemäß<br />
viel intensiver, wenn sie vor Ort sei. „Ich<br />
habe einen viel besseren Überblick, was<br />
in der Gemeinde passiert, da ich im<br />
Gemeindegebiet präsent bin“, umreißt<br />
die erfahrene Politikerin ihre zeitlichen<br />
Prioritäten. Schon als Vizebürgermeisterin<br />
sei sie zu allen Veranstaltungen im<br />
Ort eingeladen gewesen und erlebte das<br />
rege Vereinsleben Leogangs intensiv mit.<br />
Ein Vereinsleben, das toll und beispielgebend<br />
sei.<br />
Aufrechterhaltung der<br />
Infrastruktur<br />
Ein besonderes Anliegen ist der Bürgermeisterin,<br />
„den Trend aufzuhalten, dass<br />
im ländlichen Raum Infrastruktur zerstört<br />
wird.“ Denn durch die Schließung<br />
von Gendarmerieposten, Postämtern,<br />
Gerichten und Finanzämtern, sowie<br />
durch Einsparungen im öffentlichen Verkehr,<br />
sinke die Attraktivität für jüngere<br />
Menschen, im Ort zu<br />
bleiben. Um diese Attraktivität<br />
aufrecht zu erhalten<br />
oder gar zu verbessern,<br />
arbeitet man in<br />
Leogang an den Grundvoraussetzungen.<br />
Um<br />
den Jungen den Wunsch<br />
nach einem eigenen<br />
Zuhause erfüllen zu können,<br />
werden Mietwohnungen<br />
geschaffen. Für<br />
ein kleines Einkaufszentrum,<br />
einem Markt für<br />
die Nahversorgung,<br />
wurde der Bebauungsplan<br />
bereits verabschiedet.<br />
Um weitere Arbeitsplätze<br />
im Ort zu schaffen,<br />
nennt Hammerschmied ein zusätzliches<br />
Gewerbegebiet als Ziel.<br />
Gemeinsam mehr<br />
erreichen<br />
»<br />
Gab es bis zur letzten <strong>Kommunal</strong>wahl<br />
in Salzburg keine einzige Bürgermei-<br />
Porträt<br />
sterin, sind es seit März 2004 gleich<br />
drei. Dass diese drei alle aus dem Pinzgau<br />
kommen, ist für Helga Hammerschmied<br />
nicht nur Zufall. „Wir Frauen<br />
sind im Pinzgau sehr gut vernetzt“,<br />
nennt sie einen der Gründe für den<br />
Erfolg. Drei bis viermal im Jahr fänden<br />
Frauenvernetzungstreffen statt. Diese<br />
seien überparteilich und böten die<br />
ideale Plattform für gegenseitige Motivation<br />
und Erfahrungsaustausch. „Wir<br />
haben keine Berührungsängste und<br />
sind miteinander in Kontakt“, so Hammerschmied.<br />
Als ganz wesentlichen<br />
Aspekt für den Erfolg von Frauen in<br />
der Politik nennt Bürgermeisterin<br />
Hammerschmied „konsequente<br />
Arbeit“.<br />
Keine Bittsteller<br />
Bürgermeisterin Helga Hammerschmied<br />
Leogang ist in Hinsicht auf die Schwierigkeiten<br />
der finanziellen Lage keine<br />
Ausnahme. Derzeit werden die Ressourcen<br />
für das Seniorenheim gebündelt.<br />
Der Um- und Ausbau ist dringend notwendig,<br />
denn die Pflegebedürftigen stellen<br />
die große Mehrheit der Bewohner<br />
des Senioren-<br />
heims. Nach<br />
ihren Wünschen<br />
für den<br />
anstehenden<br />
Finanzausgleich<br />
gefragt,<br />
antwortet<br />
Hammerschmied:<br />
„Ich<br />
hoffe, dass die<br />
«<br />
Gemeinden<br />
künftig nicht zu<br />
Bittstellern<br />
werden, dass<br />
sie autonom<br />
Gelder verwalten<br />
und weiterhin<br />
wichtiger<br />
Auftraggeber für die Wirtschaft bleiben<br />
können.“ Dem von manchen Seiten vorgetragenen<br />
Wunsch nach Gemeindezusammenlegungen<br />
kann sie freilich gar<br />
nichts abgewinnen. Jeder Mensch brauche<br />
seine Heimat, eine Zusammenlegung<br />
mache das Leben in erster Linie<br />
anonymer und „mindert die Motivation,<br />
mit zu tun.“<br />
Ich hoffe, dass die<br />
Gemeinden künftig nicht<br />
zu Bittstellern werden,<br />
dass sie autonom Gelder<br />
verwalten und weiterhin<br />
wichtiger Auftraggeber<br />
für die Wirtschaft<br />
bleiben können.<br />
Helga Hammerschmieds<br />
Wunsch an den kommenden<br />
Finanzausgleich<br />
Beginn der politischen Tätigkeit 1980 als Ausschussmitglied der SPÖ-Ortsorganisation<br />
Leogang; 1981 Mitgründerin der Ortszeitung L.I.E.S. (Leogang in eigener Sache); 1984<br />
erstmals Mitglied der Gemeindevertretung; von 1994 bis 2004 Vizebürgermeisterin;<br />
Bürgermeisterin seit 1.4.2004; Abgeordnete des Salzburger Landtags (bis 28.4.2004);<br />
Hobbys: Schitouren, Bergradeln, Bergsteigen, Tanzen, gute Musik (von echter Volksmusik<br />
bis zur Klassik).<br />
KOMMUNAL 83
Steiermark Spezial<br />
Gemeinden und die Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes<br />
Zusammenarbeit auch<br />
grenzüberschreitend<br />
Über die Frage Wirtschaftsstandort haben sich in der Südweststeiermark die vier<br />
Gemeinden Aibl, Eibiswald, Großradl und Pitschgau sowie die regionale Wirtschaft<br />
Gedanken gemacht. Das Ergebnis kann auf einen Nenner gebracht werden: Die<br />
Wirtschaftsregion Eibiswald bietet ein professionelles Standortmanagement.<br />
◆ Dr. Wolfgang Weber<br />
In einem ersten Prozessschritt wurde<br />
von der regionalen Wirtschaft ein Positionspapier<br />
ausgearbeitet, in welchem die<br />
eigenen Bedürfnisse und Schwerpunkte<br />
für die Entwicklung der Region dargelegt<br />
wurden. Alle Aktivitäten werden<br />
auf die identifizierten Stärkefelder –<br />
Elektronik, Mechatronik, Metallverarbeitung<br />
und Präzisionstechnik – ausgerichtet.<br />
Eine Steuerungsgruppe, die für die<br />
Erarbeitung und<br />
Realisierung der<br />
Maßnahmenbündel<br />
verantwortlich ist,<br />
hat sich formell als<br />
Verein konstituiert<br />
und setzt sich aus<br />
den vier Gemeinden<br />
sowie drei Vertretern<br />
aus der Wirtschaft<br />
zusammen. Als<br />
Geschäftsführer des<br />
Vereines konnte DI<br />
Hans-Jörg Gasser – Geschäftsführer des<br />
ansässigen Leitbetriebes Kendrion Bin-<br />
◆ Dr. Wolfgang Weber von GeoSys<br />
betreut das Projekt „Wirtschaftsregion<br />
Eibiswald/Radlje“<br />
84 KOMMUNAL<br />
der Magnete – gewonnen werden.<br />
Gemeinsam mit der externen Projektbetreuung<br />
der Firma GeoSys wurden fünf<br />
Maßnahmenbündel erarbeitet.<br />
Fünf Maßnahmen<br />
Ein Verein wird als<br />
strategische Drehscheibe<br />
für alle regionalwirtschaftlich<br />
relevanten Aktivitäten<br />
im Gebiet der vier<br />
Gemeinden fungieren.<br />
◆ Der neu gegründete Verein wird auch<br />
nach Abschluss der Entwicklungsphase<br />
als strategische Drehscheibe für alle regionalwirtschaftlichrelevanten<br />
Aktivitäten im<br />
Gebiet der vier<br />
Gemeinden fungieren.<br />
Dazu zählt ein<br />
zwischen den<br />
Gemeinden abgestimmtesFlächenmanagement<br />
ebenso wie<br />
die Festlegung der<br />
Modalitäten des <strong>Kommunal</strong>steuersplittings<br />
und die Verbesserung<br />
des Gründerklimas. Die operative<br />
Umsetzung hat eine<br />
eigene Gesellschaft inne,<br />
wobei die Aufgaben dieser<br />
Impulsgesellschaft über das<br />
bloße Errichten und Verwalten<br />
von Infrastruktur hinaus<br />
gehen. Dazu zählen unter<br />
anderem die Betreuung junger<br />
Unternehmen in der Startphase,<br />
der Aufbau von Netzwerken<br />
zwischen den regionalen<br />
Unternehmen einerseits<br />
und der Wirtschaft und der<br />
Öffentlichkeit andererseits, die<br />
Durchführung von Marketingaktivitäten<br />
für den Wirt-<br />
schaftsstandort Region Eibiswald (etwa<br />
durch gemeinsame Messeauftritte der<br />
regionalen Unternehmen) sowie die Beratung<br />
potenzieller Investoren und der Aufbau<br />
grenzüberschreitender Kooperationen.<br />
◆ Die Lage unmittelbar an der Grenze zu<br />
Slowenien wird als Chance wahrgenommen,<br />
da traditionell gute Kontakte auf<br />
wirtschaftlicher, politischer und auch<br />
gesellschaftlicher Ebene Kooperationen<br />
ermöglichen, die anderswo in dieser Form<br />
nicht möglich sind. In einer eigenen<br />
Arbeitsgruppe, die jeweils von Vertretern<br />
aus der Wirtschaft und der Politik<br />
beschickt wird, wurden eine Reihe von<br />
Maßnahmen ausgearbeitet, die der Vertiefung<br />
der Kooperation dienen. Die Unterzeichnung<br />
einer Partnerschaftserklärung<br />
anlässlich der EU-Beitrittsfeierlichkeiten<br />
am 1. Mai 2004 am Radlpass (KOMMU-<br />
NAL berichtete) unter Beisein von Frau<br />
Landeshauptmann Klasnic und EU-Kommissar<br />
Fischler legt ein<br />
formelles Bekenntnis<br />
zu dieser Zusammen-<br />
Zu dem Aktivitäten<br />
des Vereins<br />
zählt ein zwischen<br />
den Gemeinden<br />
abgestimmtes<br />
Flächenmanagement<br />
ebenso wie die<br />
Festlegung der<br />
Modalitäten des<br />
<strong>Kommunal</strong>steuersplittings.<br />
arbeit dar. Die Aufnahme<br />
von slowenischen<br />
Vertretern in den<br />
Verein der Wirtschaftsregion<br />
Eibiswald stellt<br />
den grenzüberschreitendenInformationstransfer<br />
sicher. Die<br />
konkrete Zusammenarbeit<br />
wird im Rahmen<br />
eines INTERREG<br />
IIIa-Projektes in den<br />
Bereichen Qualifikation,<br />
Logistik, Gründer-
Der Verein „Wirtschaftsregion Eibiswald/Radlje: (stehend) DI Hans-Jörg Gasser<br />
(GF Kendrion Binder Magnete), Mag. Dr. Wolfgang Weber (GeoSys, Projektbetreuung),<br />
KO Herbert Naderer (WK Deutschlandsberg), Franz Schilcher (Wirtschaftsplattform<br />
Region Eibiswald), (vorne) Bgm. Karl Galler (Gemeinde Aibl), Bgm. Ing. Karl<br />
Schober (Gemeinde Pitschgau), Bgm. Hildegard Franz (Gemeinde Eibiswald), Bgm.<br />
Christian Draxler (Gemeinde Großradl) .<br />
unterstützung und Standortmarketing<br />
vertieft. Als wichtigstes Anliegen gilt es<br />
nun, Synergieeffekte für die Unternehmen<br />
beiderseits der Grenze zu bewirken.<br />
Zu diesem Zweck werden in Form von<br />
persönlichen Interviews mit den<br />
Geschäftsführern der produzierenden<br />
Unternehmen der Region durchgeführt.<br />
Ziel ist es, mit dieser Befragung konkrete<br />
Kooperationspotenziale zu<br />
identifizieren und den<br />
Bedarf an zusätzlichen<br />
Initiativen in der Region<br />
herauszufiltern. Die vorbildhafte<br />
Wirkung von<br />
bereits bestehenden Wirtschaftsbeziehungen<br />
– wie<br />
etwa jene zwischen Kendrion<br />
Binder Magnete in<br />
Eibiswald und CNC<br />
Puπnik in Radlje – ist ein<br />
wesentlicher Faktor für<br />
den Erfolg des Ansinnens.<br />
Weiters wird in der<br />
Region eine Informationsdrehscheibe<br />
installiert, die<br />
auch von übergeordneten<br />
Institutionen wie etwa<br />
den Clusterorganisationen<br />
genutzt werden kann.<br />
Diese Projektidee wird mit der pilothaften<br />
Unterstützung einer grenzüberschreitenden<br />
Unternehmensneugründung verknüpft.<br />
◆ Als erstes sichtbares Zeichen der Wirtschaftsregion<br />
Eibiswald wird das Bauvorhaben<br />
eines Engineeringzentrums im<br />
Sommer 2004 realisiert. Auf insgesamt<br />
450 m 2 wird den regionalen Unternehmen<br />
hochwertige Infrastruktur für die<br />
Realisierung von Entwicklungs- und Kon-<br />
Die operative<br />
Umsetzung hat eine<br />
eigene Gesellschaft<br />
inne, wobei die<br />
Aufgaben dieser<br />
Impulsgesellschaft<br />
über das bloße<br />
Errichten und<br />
Verwalten von<br />
Infrastruktur<br />
hinaus gehen.<br />
struktionsleistungen zur Verfügung<br />
gestellt. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten<br />
Unternehmen und der LBS Eibiswald<br />
sowie die Forcierung von Qualifizierungsmaßnahmen<br />
unterstreichen den<br />
hohen Qualitätsanspruch des Zentrums.<br />
◆ Auch im Bereich der Produktion setzt<br />
die Region auf moderne Infrastruktur.<br />
2000 m 2 Produktionsfläche, 400 m 2<br />
Büros sowie Lagerflächen<br />
und Nebenräume stehen<br />
zur Verfügung. Neben der<br />
Ansiedlung von neuen<br />
Unternehmen werden<br />
eigene Flächen für Neugründer<br />
bereitgestellt.<br />
◆ Die Errichtung einer<br />
regionalen Logistikdrehscheibe<br />
mit spezieller<br />
grenzüberschreitender<br />
Ausrichtung ist die dritte<br />
Aktivität der Wirtschaftsregion<br />
Eibiswald, mit der<br />
neue Infrastruktur<br />
geschaffen wird. In<br />
enger Kooperation mit<br />
der Fachhochschule<br />
Joanneum wird ein<br />
zukunftsweisendes<br />
Geschäftsmodell entwickelt.<br />
Die notwendigen Flächen werden<br />
von der Wirtschaftsregion Eibiswald<br />
bereitgestellt.<br />
Die Realisierung der Vorhaben gelingt<br />
mit Unterstützung des Landes Steiermark,<br />
die Steirische Wirtschaftsförderung<br />
SFG forciert insbesondere den<br />
grenzüberschreitenden Charakter des<br />
Projektes, das damit zu einem wichtigen<br />
Mosaikstein in der Technologieachse<br />
Graz-Maribor wird.<br />
Foto: Ernst Horvath<br />
Brauchtum<br />
Steiermark Spezial<br />
Die Anwort auf die Frage „Was ist ein<br />
Klapotetz“ sehen unsere Leser im Bild<br />
oben: Das ist ein original Klapotetz.<br />
Das steirische „Windradl“<br />
Was bitte ist der<br />
„Klapotetz ?“<br />
In der <strong>Ausgabe</strong> Mai 2004 haben wir<br />
unter dem Titel „In der Südsteiermark<br />
verkündet der Klapotetz“ ein Porträt<br />
der Spielfelder Bürgermeisterin Heidun<br />
Walther gebracht. Und dieser Titel hat<br />
uns doch einige Anfragen eingebracht.<br />
Der „Klapotetz“ (das Wort stammt vom<br />
slowenischen „klapotati“ = klappern)<br />
dient seit Alters her den Weinbauern.<br />
Er vertreibt mit dem Lärm Vögel, die<br />
sich gerne an den Trauben vergreifen<br />
und ist das Wahrzeichen des südsteirischen<br />
Weinlandes. Über das Alter des<br />
Klapotetz ist nichts Genaues bekannt.<br />
Prof. Leopold Kretzenbacher führt in<br />
seinem Buch „Windradl und Klapotetz“<br />
1797 eine erste handschriftliche Notiz<br />
an. Mehr Infos auf der Homepage<br />
http://www.st-andrae-hoech.steiermark.at/tourismus/0540_klapotetz.htm<br />
KOMMUNAL 85
Blindtext Aus den Bundesländern<br />
& Blindtext<br />
86 KOMMUNAL<br />
BURGENLAND<br />
Grenzübergang<br />
2356 Protest-<br />
Unterschriften<br />
NICKELSDORF<br />
Die Gemeinden Nickelsdorf,<br />
Zurndorf, Gattendorf, Neudorf<br />
und Parndorf setzen<br />
ihren Protest gegen die Öffnung<br />
des B10-Grenzübergangs<br />
bei Nickelsdorf fort.<br />
Ausgangspunkt ist eine Vereinbarung<br />
zwischen Österreich<br />
und Ungarn, wonach<br />
beim „alten“ B10-Grenzübergang<br />
wieder eine Grenzübergangsstelle<br />
für den internationalen<br />
Personenverkehr zu<br />
errichten ist. „Damit wird der<br />
Mautflucht Tür und Tor<br />
geöffnet“, so LH Hans Niessl.<br />
Es sei zu befürchten, dass<br />
viele Fahrzeuge, die derzeit<br />
den Autobahn-Grenzübergang<br />
benutzen, auf die Bundesstraße<br />
ausweichen werden<br />
und somit wieder<br />
Zustände herrschen wie vor<br />
der Eröffnung der A4-Ostautobahn<br />
im Jahr 1994.<br />
KÄRNTEN<br />
Gedankenarsenal<br />
Gemeinden sind<br />
keine Preistreiber<br />
KLAGENFURT-LAND<br />
Zurückgewiesen wurde von<br />
den 19 Gemeindevertretern<br />
des Bezirkes Klagenfurt-<br />
Land die Kritik an der<br />
Gestaltung der Kanalgebühren.<br />
Vizepräsident und<br />
Bezirksobmann Bgm. Valentin<br />
Happe (Gemeinde<br />
Schiefling am See): „Die<br />
Gemeinden sind verpflichtet,<br />
einen ausgeglichenen<br />
Gebührenhaushalt zu<br />
führen, Körberlgeld wird<br />
hier keines verdient“.<br />
Zudem orten die Bürgermeister<br />
die Verantwortung für<br />
die zuletzt erfolgten<br />
Gebührenanhebungen beim<br />
Bund und beim Land. Ein<br />
erhöhter Altlastensanierungsbeitrag<br />
an den Bund,<br />
die LKW-Maut und die<br />
erhöhte Mineralölsteuer sind<br />
nur einige der „Preistreiber“.<br />
Gedankenarsenal<br />
Ideenspeicher<br />
„Stadtoffice“<br />
EISENSTADT<br />
Das Jahr 2004 steht im<br />
Burgenland ganz im Zeichen<br />
der Volkskultur. Dem Motto:<br />
„Volkskultur ist da!“ wurde<br />
mit der Eröffnung des<br />
„Stadtoffice“ in Eisenstadt<br />
einmal mehr Rechnung<br />
getragen.<br />
„Die burgenländische<br />
Volkskultur kennt viele<br />
Spielarten und viele Facetten,<br />
über die sich unser<br />
Land, sowohl in der<br />
geschichtlichen Entwicklung,<br />
als auch in der heutigen<br />
Erscheinungsform definieren<br />
und präsentieren<br />
kann“, betonte Kulturlandesrat<br />
Helmut Bieler.<br />
Das „Stadtoffice“ soll als<br />
Ausstellungsraum, Kommunikationszentrum,„Ideenspeicher<br />
und Gedankenarsenal"<br />
sowie als Depot und für<br />
Werbezwecke dienen.<br />
KLAGENFURT<br />
Die Erhöhung der Müllgebühren<br />
in einigen Kärntner<br />
Städte und Gemeinden ist<br />
fremdbestimmt. Die Gemeinden<br />
erfüllen nur einen gesetzlichen<br />
Auftrag.<br />
Wenn mehrere Kärntner<br />
Gemeinden ihre Müllgebühren<br />
derzeit anheben, so ist<br />
diese Preissteigerung nicht<br />
hausgemacht. Grundsätzlich<br />
sind die Gemeinden gesetzlich<br />
verpflichtet, einen ausgeglichenen<br />
Gebührenhaushalt<br />
zu führen. Kostensteigerungen,<br />
die fremdbestimmt sind,<br />
wirken sich daher auch direkt<br />
auf die Höhe der Müllgebühren<br />
aus.<br />
Der Präsident des Kärntner<br />
Gemeindebundes, Bgm. Hans<br />
Ferlitsch, und der Landesobmann<br />
des Österreichischen<br />
Städtebundes – Landesgruppe<br />
Kärnten, Bgm. Helmut Man-<br />
Förderung für Kinder-Nachmittagsbetreuung<br />
Sie müssen uns was wert sein<br />
GROSSWARASDORF<br />
Bei der Kinderbetreuung der<br />
3 bis 6-jährigen nimmt das<br />
Burgenland österreichweit<br />
einen Spitzenplatz ein. Für 98<br />
Prozent aller Kinder dieser<br />
Altersgruppe gibt es einen<br />
Betreuungsplatz in unseren<br />
Gemeinden, sagte Bildungs-<br />
Landesrätin Michaela Resetar,<br />
die auch für das Kindergartenwesen<br />
zuständig ist, anlässlich<br />
des Kindergartensymposions<br />
in Großwarasdorf. Im<br />
Burgenland gibt es insgesamt<br />
189 Kindergärten, die über<br />
7500 Kinder besuchen, die<br />
von 627 Kindergartenpädagoginnen<br />
und 187 Helferinnen<br />
bestens betreut werden.<br />
Ziel ist es, dass jeder Kindergartengruppe<br />
eine Helferin<br />
zur Verfügung gestellt werden<br />
kann. Ein diesbezüglicher<br />
Gesetzesentwurf ist bereits in<br />
Ausarbeitung, der auch „notwendige<br />
finanziellen Mittel<br />
Gemeinden wirtschaften verantwortungsvoll<br />
zenreiter listen nur einige dieser<br />
externen „Preistreiber“<br />
auf: „Der erhöhte Altlastensanierungsbeitrag,<br />
die LKW-<br />
Maut, die höhere Mineralölsteuer<br />
und die erhöhten Energieabgaben<br />
sind nur einige<br />
der wesentlichen Faktoren,<br />
die für das derzeitige Minus<br />
in den Gebührenkassen ver-<br />
für die Gemeinden als Kindergartenerhalter<br />
vorsieht“, so<br />
Resetar. „In diesem Zusammenhang<br />
begrüße ich auch<br />
die von der Bundesregierung<br />
initiierte und jetzt vom Nationalrat<br />
jetzt beschlossene<br />
Elternteilzeitregelung in<br />
Betrieben, die am 1. Juli 2004<br />
in Kraft tritt.“ Dieses Recht sei<br />
ein erster richtiger Schritt, um<br />
Familie und Beruf besser in<br />
Einklang bringen zu können.<br />
Michaela Resetar: „Daher<br />
wird einer meiner Schwerpunkte<br />
in der Kindergartenpolitik<br />
die verstärkte Förderungen<br />
von Horten sein.<br />
Diese Herausforderungen<br />
können nur partnerschaftlich,<br />
freiwillig und unter Einbindung<br />
der Gemeinden und der<br />
Eltern gelöst werden. Unsere<br />
Kinder müssen uns<br />
etwas Wert sein,<br />
denn sie sind<br />
unsere Zukunft.“<br />
Erhöhung der Müllgebühren fremdbestimmt<br />
Die Erhöhung der Müllgebühren<br />
in einigen Kärntner<br />
Gemeinden ist fremdbestimmt.<br />
antwortlich sind“. Die finanzielle<br />
Situation der Kommunen<br />
macht eine Bedeckung dieser<br />
zusätzlichen Kosten aus anderen<br />
Budgetmitteln unmöglich.<br />
Die divergierende Gestaltung<br />
der Gebühren bei den einzelnen<br />
Gemeinden ist auf die<br />
unterschiedliche Ausgangslage<br />
zurückzuführen. Die<br />
Siedlungsdichte, die Länge<br />
der Transportwege und<br />
zusätzliche Serviceleistungen<br />
der Gemeinden beeinflussen<br />
die Kalkulation. Zudem haben<br />
die meisten Gemeinden ihre<br />
Gebührensätze seit vielen Jahren<br />
nicht erhöht. Ferlitsch und<br />
Manzenreiter: „Die letzten<br />
Statistiken haben gezeigt,<br />
dass die Kärntner Gemeinden<br />
die sparsamsten Kommunen<br />
in ganz Österreich<br />
sind, sie wirtschaften<br />
äußerst verantwortungsvoll“.
NIEDERÖSTERREICH<br />
Belebung des ländlichen Raumes<br />
10 Millionen für Gemeinden<br />
ST. PÖLTEN<br />
Die niederösterreichischen<br />
Gemeinden sind wichtige<br />
Impulsgeber für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung des<br />
ländlichen Raumes. Eine<br />
Großzahl an Investitionen,<br />
speziell im Infrastrukturbereich,<br />
stärken die Bauwirtschaft<br />
und beleben den<br />
Arbeitsmarkt. Um die<br />
Gemeinden auch künftig bei<br />
der Umsetzung notwendiger<br />
Vorhaben zu unterstützen,<br />
setzt das Land Niederösterreich<br />
sein Fitnessprogramm<br />
für die Gemeinden weiter<br />
fort. Dafür wird der NÖ<br />
Landtag insgesamt 10 Millionen<br />
Euro zur Verfügung stellen,<br />
freut sich LAbg. Herbert<br />
Nowohradsky.<br />
Durch das bereits seit zwei<br />
Jahren erfolgreich laufende<br />
Fitnessprogramm für die NÖ<br />
Gemeinden konnten bisher<br />
Investitionen in Höhe von<br />
OBERÖSTERREICH<br />
Softwarepark Hagenberg<br />
Regionalverbünde<br />
Oberösterreich<br />
punktet<br />
LINZ<br />
Oberösterreich setzt im Kampf<br />
der Regionen um Betriebsansiedlungen<br />
verstärkt auf<br />
Gemeindegrenzen überschreitende<br />
Kooperationen wie der<br />
Softwarepark Hagenberg.<br />
Wirtschaftslandesrat Viktor<br />
Sigl forderte mit Hinweis auf<br />
die gestiegenen Herausforderungen<br />
durch den EU-Beitritt<br />
etwa Tschechiens schon<br />
seit langem eine aktive<br />
Standortpolitik gemeinsam<br />
mit den oö. Gemeinden, um<br />
in diesem Wettbewerb bestehen<br />
zu können.<br />
rund 150 Millionen Euro<br />
unterstützt werden. Für die<br />
Übernahme der ZwischenfinanzierungszinsenvorgezogenerGemeindeinvestitionen<br />
stellt das Land nun weitere<br />
zehn Millionen Euro zur<br />
Verfügung. Damit können<br />
unsere Gemeinden ihren<br />
eingeschlagenen Weg auch<br />
nach dem Tag der EU-Erweiterung<br />
erfolgreich fortsetzen,<br />
so Nowohradsky.<br />
Wie in der Formel Eins ist es<br />
auch im Zuge der EU-Erweiterung<br />
nicht nur wichtig in<br />
Poleposition zu stehen,<br />
sondern auch als Erster in<br />
die erste Kurve zu gehen.<br />
Wir in Niederösterreich<br />
haben mit dem 1. Mai<br />
unsere Anstrengungen<br />
zur Stärkung des Landes<br />
nicht beendet, sondern<br />
setzen sie auch künftig mit<br />
aller Kraft fort, betont<br />
Nowohradsky.<br />
LINZ<br />
Gerade jetzt ist Europa und<br />
seine Erweiterung in aller<br />
Munde. Nach dem Feiern<br />
geht es nun darum, die neuen<br />
Chancen zu erkennen und<br />
optimal zu nutzen. Dies gilt<br />
nicht nur für die Wirtschaft,<br />
sondern in gleichem Maße für<br />
die öffentliche Verwaltung.<br />
Österreich ist von seiner<br />
Randlage in das Zentrum<br />
Europas gerückt – ein gewichtiges<br />
Argument und bedeutende<br />
Aufwertung des Landes<br />
als Wirtschafsstandort.<br />
Reibungslos funktionierende<br />
und kompetente <strong>Kommunal</strong>verwaltungen<br />
mit modernem,<br />
europäischem Standard werden<br />
dazu beitragen, auftretende<br />
Strukturprobleme zu<br />
verringern und den WirtschaftsstandortOberösterreich<br />
langfristig zu stärken.<br />
Diese Stärkung ist auch eine<br />
Univ.Prof Dr. Christian Simhandl,<br />
LR Emil Schabl, Bgm.<br />
Hannes Fazekas und Ing. Hermann<br />
Koutek im Gespräch.<br />
Veranstaltung<br />
Depression füllt<br />
Rathaus<br />
SCHWECHAT<br />
„Allein am Publikumsinteresse<br />
kann man erahnen, welche<br />
große Rolle depressive<br />
Erkrankungen in unserem<br />
Umfeld spielen“, war Bürgermeister<br />
Hannes Fazekas<br />
nach der Info-Veranstaltung<br />
der „Österreichischen Gesellschaft<br />
für Depressive Erkrankungen“-<br />
ÖGDE überzeugt.<br />
Um die 120 Besucher waren<br />
Mitte Mai ins Rathaus<br />
gekommen. Jedenfalls sterben<br />
zur Zeit in Österreich<br />
mehr Menschen durch Suezid<br />
als an Verkehrsunfällen.<br />
wichtige Unterstützung für<br />
die neuen Aufgaben innerhalb<br />
der neuen Grenzen.<br />
Da der wirtschaftliche<br />
Anspruch an die Gemeinden<br />
ständig wächst, bietet ein<br />
neues Bildungsangebot zum<br />
richtigen Zeitpunkt eine willkommene<br />
Unterstützung.<br />
Auf Initiative der Gemeindeabteilung<br />
des Landes Oberösterreich<br />
wurde gemeinsam<br />
vom BFI OÖ und der AVIANA<br />
Consulting ein spezielles Bildungsangebot<br />
für eine wirtschaftliche<br />
fundierte <strong>Kommunal</strong>verwaltung<br />
entwickelt.<br />
Dadurch bringt sich Oberösterreich<br />
in eine Vorreiterrolle.<br />
Dieses Angebot wendet<br />
sich an alle Behörden und<br />
behördennahe Einrichtungen<br />
wie Gemeinden, Landesverwaltungen<br />
und deren Mitarbeiter<br />
sowie an Politiker und<br />
Interessensvertreter.<br />
Aus den Bundesländern<br />
Kleinregionenfonds<br />
NÖ auf alternativen<br />
Wegen<br />
ST. PÖLTEN<br />
Mit der Errichtung eines speziellen<br />
Kleinregionenfonds<br />
geht Niederösterreich beim<br />
Standortmarketing zusätzlich<br />
zu den anderen angewandten<br />
Instrumenten recht innovative<br />
Wege.<br />
So unterstützt der mit 75.000<br />
Euro dotierte Kleinregionenfonds<br />
innovative Projekte im<br />
Rahmen der Zusammenarbeit<br />
von Kommunen. So<br />
haben beispielsweise zwei<br />
Kleinregionen im Raum<br />
Thayatal den Holz- und Energiepark<br />
Waldviertel initiiert.<br />
Oder im der Gemeinde<br />
Allentsteig wird ein Kompetenzzentrum<br />
für die „Generation<br />
50+“ verwirklicht.<br />
Potenzial zur Zusammenarbeit<br />
liegt besonders in<br />
den Bereichen Abwasser,<br />
Sozialversorgung<br />
und Freizeit.<br />
Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer effektiven Gemeindeverwaltung<br />
Der „Europäische <strong>Kommunal</strong>führerschein“<br />
Welche große Bedeutung diesem<br />
Qualifizierungsangebot<br />
beigemessen wird, zeigt sich<br />
in der Unterstützung des Projektes<br />
durch die Oberösterreichische<br />
Landesregierung<br />
sowie dem Gemeindebund<br />
und Städtebund.<br />
Die positive Resonanz auf die<br />
laufenden Ausbildungen in<br />
diesem Bereich – <strong>Kommunal</strong>-<br />
Diplomlehrgänge und<br />
Gemeindevertreter-Seminare<br />
– bestätigen die Richtigkeit<br />
des eingeschlagenen Weges.<br />
Die Lehrgänge für den neu<br />
entwickelten EMDL (European<br />
Municipal Driving<br />
Licence - Europäischer <strong>Kommunal</strong>führerschein)<br />
werden<br />
im September 2004 starten<br />
und die Basis für eine zeitgerechte,kostenbewusste<br />
und kundenfreundlicheVerwaltung<br />
bilden.<br />
KOMMUNAL 87
Blindtext Aus den Bundesländern<br />
& Blindtext<br />
88 KOMMUNAL<br />
SALZBURG<br />
LKW-Transit<br />
Schutz der Alpen<br />
durch Schiene<br />
SALZBURG<br />
Einen Schwerpunkt im Kampf<br />
gegen den Lkw-Transit will<br />
Verkehrsreferent LHStv Wilfried<br />
Haslauer in den kommenden<br />
fünf Jahren auf den<br />
kombinierten Verkehr legen:<br />
„Die Verlagerung des Güterverkehrs<br />
von der Straße auf<br />
die Schiene ist die einzige<br />
Möglichkeit, um angesichts<br />
des rasant wachsenden<br />
Warenverkehrs die ökologisch<br />
sensible Region der Alpen zu<br />
schützen“, stellte Haslauer<br />
Mitte Juni klar. „Die Tauernautobahn<br />
ist eine wichtige Verbindungsstrecke<br />
zu unseren<br />
neuen und zukünftigen EU-<br />
Nachbarn in Südost-Europa<br />
und zu den Adriahäfen Triest<br />
und Koper. Es ist daher davon<br />
auszugehen, dass der Warenverkehr<br />
durch unser Land<br />
künftig noch drastischer<br />
ansteigen wird“, so Haslauer.<br />
STEIERMARK<br />
Kinderbetreuung<br />
Neuer<br />
Modellversuch<br />
GRAZ<br />
Mit einer Verordnung zum<br />
Steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetz<br />
schuf das Land<br />
die juristischen Voraussetzungen<br />
zur Einführung eines<br />
neuen Kinderbetreuungsmodells,<br />
das für Mädchen und<br />
Buben von eineinhalb Jahren<br />
bis zum Ende der Volksschulzeit<br />
gelten wird. Der Anteil<br />
der „alterserweiterten Gruppen“<br />
ist in den Kindergärten<br />
mit zehn Prozent begrenzt.<br />
Bei einer Gruppenhöchstzahl<br />
von 20 Kindern dürfen bis zu<br />
sieben Mädchen und Buben<br />
im Alter von eineinhalb bis<br />
drei Jahren nach diesem<br />
Betreuungsmodell aufgenommen<br />
werden. Zur Installierung<br />
einer derartigen Kindergartengruppe<br />
müssen zumindest<br />
zwei Kinder zwischen drei<br />
und sechs Jahre alt sein.<br />
Erwachsenenbildung<br />
Preis für beste<br />
Innovation<br />
SALZBURG<br />
Seit 1975 wird der Innovationspreis<br />
des Landes alle<br />
zwei Jahre vergeben. Der<br />
erste Preis ist heuer mit 3.000<br />
Euro, der zweite Preis mit<br />
2.200 Euro dotiert. Bis zu<br />
einem Gesamtbetrag von<br />
7.500 Euro können Innovationspreise<br />
vergeben werden.<br />
Diese Innovationspreis des<br />
Landes wird für besondere<br />
Leistungen in der Erwachsenenbildung<br />
einschließlich des<br />
Öffentlichen Bibliothekswesens<br />
zuerkannt. Das Land<br />
Salzburg sieht in der Erwachsenenbildung,<br />
vor allem im<br />
Hinblick auf sinnerfüllte<br />
Lebensführung, politische und<br />
soziale Entwicklung sowie<br />
beruflichen und gesellschaftlichen<br />
Aufstieg ein großes<br />
öffentliches Anliegen. Die<br />
Frist zur Einreichung läuft bis<br />
30. Juni.<br />
WEIZ<br />
Zu einer interessanten<br />
Gesprächsrunde lud unlängst<br />
der Vorsitzende des BSA<br />
Weiz, Mag. Oswin Donnerer,<br />
ein. So referierte die Umweltexpertin<br />
der Steirischen<br />
Arbeiterkammer Mag.<br />
Susanne Bauer zum Thema<br />
„Arbeitsplätze durch Umweltschutz“.<br />
Mag. Bauer hat vor<br />
kurzem eine Studie abgefasst,<br />
in der die Möglichkeiten zur<br />
Schaffung von neuen Jobs im<br />
SALZBURG<br />
Angesichts des tiefsten Budgetlochs<br />
seit 1945 kündigte<br />
Finanzreferent LHStv Othmar<br />
Raus an, dass das Amt<br />
enger zusammenrücken<br />
müsse. Ziel sei es, angemietete<br />
Flächen frei zu machen<br />
und die betroffenen Dienststellen<br />
in bestehenden Amtsgebäuden<br />
unterzubringen.<br />
Jeder eingesparte Quadratmeter<br />
bringt monatlich zwölf<br />
Euro zur Linderung der Budgetnot.<br />
Das Amt der Salzburger<br />
Landesregierung hat<br />
Dienststellen in eigenen<br />
Gebäuden aber auch in angemieteten<br />
Räumlichkeiten<br />
untergebracht. Auf Grund<br />
des Abbaus von Dienstposten<br />
hat sich in den vergangenen<br />
Jahren eine Reduzierung der<br />
Belegungsdichte von Amtsgebäuden<br />
ergeben. Diesen<br />
Raum will Raus nun nutzen,<br />
um das Amt enger zusam-<br />
Der Vorsitzende des BSA Weiz Mag. Oswin Donnerer und Mag.<br />
Susanne Bauer von der steirischen Arbeiterkammer mit einigen<br />
Vertretern des BSA Weiz.<br />
Gesprächsrunde in Weiz zeigt auf<br />
Arbeitsplätze durch Umweltschutz<br />
Ideen zur Reduzierung der Bürokosten<br />
Amt muss zusammenrücken<br />
Umweltbereich analysiert<br />
werden. Nach einer Bestandsaufnahme<br />
bereits bestehender<br />
steirischer Umweltinitiativen<br />
wird in der Studie die<br />
Forderung nach einer besseren<br />
Vernetzung dieser<br />
Umweltakteure aufgestellt. Es<br />
sollte eine „Sustainable Styria<br />
GmbH“ gegründet werden,<br />
dadurch könnten sich für die<br />
Steiermark konkrete Wirtschaftschancen<br />
im Bereich<br />
Nachhaltigkeit eröffnen.<br />
menrücken zu lassen. Durch<br />
die Zusammenlegung von<br />
Dienststellen sollen auch<br />
Betriebskosten gespart werden.<br />
Die Betreuung externer<br />
Dienststellen ist in der Regel<br />
teurer, als wenn diese in<br />
einem bestehenden größeren<br />
Amtsgebäude untergebracht<br />
werden. Ein Ziel ist auch,<br />
lukrativ verwertbare Immobilien<br />
des Landes zu räumen,<br />
um darin gebundenes Kapital<br />
zu mobilisieren.<br />
Raus kündigte an, dass die<br />
Planungen bis Herbst unter<br />
Einbindung der Landesamtsdirektion<br />
und der Abteilungen<br />
erfolgen werden. Einzeladressen<br />
werden zugunsten<br />
von Übersiedlungen in<br />
größere Amtsgebäude aufgegeben<br />
werden müssen. Ausdrücklich<br />
nahm<br />
Raus auch Politikerbüros<br />
nicht von<br />
diesem Zwang aus.<br />
Steirische Regionen<br />
Wider das<br />
Kirchturmdenken<br />
Das Motto „Kooperieren statt<br />
konkurrieren“ wünscht sich<br />
Gemeindereferent LH-Stv.<br />
Mag. Franz Voves als Leitmotiv<br />
zukünftiger Gemeindepolitik.<br />
„Die Gemeinden geraten<br />
von den verschiedensten<br />
Seiten her unter Druck und<br />
müssen mit ständig sinkenden<br />
Einnahmen fertig werden“,<br />
bringt Voves die Ist-<br />
Situation auf den Punkt. Um<br />
dem zu begegnen, müssten<br />
die Gemeinden verstärkt<br />
zusammenarbeiten. Und das<br />
könnte, so Voves, mit der<br />
Schaffung von sechs steirischen<br />
Regionen – Graz und<br />
Graz-Umgebung, Obersteiermark<br />
Ost, Obersteiermark<br />
West, Liezen, Weststeiermark<br />
und<br />
Oststeiermark –<br />
unterstützt und<br />
erreicht werden.
TIROL<br />
Neuer Behindertenbeirat des Landes<br />
Stärkung für Betroffene<br />
INNSBRUCK<br />
In den letzten beiden Jahrzehnten<br />
des Bestehens<br />
des Behindertenbeirates<br />
waren<br />
Menschen mit<br />
Behinderung selbst<br />
in diesem Gremium<br />
kaum vertreten.Soziallandesrätin<br />
Christa<br />
Gangl schlug der<br />
Landesregierung<br />
deshalb eine Neu-<br />
besetzung vor.<br />
Nunmehr sind<br />
Betroffene wie<br />
auch Frauen entsprechend<br />
vertreten. „Die Aufgabe<br />
des Beirates ist es, die<br />
Regierung zu beraten. Dass<br />
Betroffene selber viele Auswirkungen<br />
unserer Gesellschaft<br />
anders erleben als Nicht-Betroffene,<br />
liegt auf der Hand. Deshalb<br />
bin ich froh, dass die Landesregierung<br />
meinem Vor-<br />
Offene Jugendarbeit<br />
„Ohne euch<br />
geht gar nichts“<br />
WOLFURT<br />
„Ohne euch geht überhaupt<br />
nichts“: unter diesem Motto<br />
stand eine Veranstaltung für<br />
Menschen, die sich in der Offenen<br />
Jugendarbeit engagieren.<br />
In der Offenen Jugendarbeit in<br />
Vorarlberg sind das 74 Jugendarbeiter<br />
hauptamtlich in den<br />
rund 40 Jugendzentren und -<br />
treffs beschäftigt. Rund 500<br />
Personen engagieren sich<br />
ehrenamtlich. LH Sausgruber<br />
und LR Greti Schmid würdigten<br />
im Wolfurter CUBUS dieses<br />
Engagement: „Die Projekte in<br />
den Treffs und Jugendzentren<br />
sind nur mit den ehrenamtlich<br />
Tätigen möglich. Gerade die<br />
Offene Jugendarbeit hat in den<br />
letzten Jahren sehr stark an<br />
Bedeutung gewonnen. Dafür<br />
stehen sinnvolle und ausgezeichnete<br />
Projekte“, führte die<br />
Landesrätin an.<br />
Edgar Kopp, Bürgermeister<br />
von Rum.<br />
Foto: VLK/Wirth<br />
schlag gefolgt ist und wir nun<br />
eine stärkere Vertretung von<br />
Menschen mit einer<br />
Behinderung, aber<br />
auch Frauen, im Beirat<br />
vorfinden. Ich<br />
erhoffe mir viele<br />
nützliche Anregungen<br />
von diesem Gremium,<br />
dem ich für<br />
die kommende Aufgabe<br />
alles Gute wünsche“,<br />
betont Soziallandesrätin<br />
Christa<br />
Gangl. Die Mitglieder<br />
des Behindertenbeirates<br />
sind: DSA Kathrin<br />
Lorenz, Dr. Helmut<br />
Rochelt, Reg.Rat Georg Leitinger,<br />
Simon Huber, Mag. Karin<br />
Flatz, Marianne Hengl, Dr. Gabi<br />
Kirchmair, Dr. Franz Jäger,<br />
Maria Kranebitter, Bgm.-Stv. HR<br />
DI Eugen Sprenger, Tirols<br />
Gemeindebundvizepräsident<br />
Bgm. Edgar Kopp, Dr. Ursula<br />
Gidl, Dr. Christian Bidner.<br />
Lokalaugenschein am Bezauerbach:<br />
Bgm. Georg Fröwis,<br />
LSth. Dieter Egger, Martin<br />
Weiss und Thomas Blank.<br />
Schutz & Natur<br />
Kein Gegensatz<br />
BEZAU<br />
In Bezau wird ein umfassendesGewässerbetreuungskonzept<br />
realisiert, um sowohl die<br />
Hochwassersicherheit als<br />
auch den ökologischen<br />
Zustand des Bezauer- und des<br />
Grebenbaches zu verbessern.<br />
Bei der Präsentation des Projektes<br />
sprach Landesstatthalter<br />
Dieter Egger von einem<br />
weiteren Beispiel dafür, „dass<br />
die Interessen von Schutzwasserbau<br />
und von Natur und<br />
Umwelt gut vereinbar sind“.<br />
Bauvorhaben Kaisertal<br />
Drei Millionen<br />
Förderung<br />
EBBS<br />
„Mit fast drei Millionen Euro<br />
fördern wir im Bezirk Kufstein<br />
die Gemeinde Ebbs mit dem<br />
Bauvorhaben ‚Kaisertal’ aus<br />
dem Sonderprogramm zur<br />
Verkehrserschließung des<br />
ländlichen Raums und nehmen<br />
dieses Projekt zusätzlich<br />
auf“, erklärte LH van Staa.<br />
Dieser Beschluss wird noch<br />
dem Landtag zur Genehmigung<br />
zugeleitet. Derzeit<br />
besteht die Anbindung des<br />
Kaisertals an den Wirtschaftsraum<br />
Inntal nur aus einem<br />
Fußweg und einer Materialseilbahn<br />
– immerhin wohnen<br />
in zehn Haushalten derzeit 30<br />
Personen mit Hauptwohnsitz,<br />
in fünf landwirtschaftlichen<br />
Betrieben werden über 180<br />
Rinder gehalten, zusätzlich<br />
noch 140 aus dem Inntal über<br />
den Sommer auf fünf Almen<br />
in diesem Gebiet.<br />
VORARLBERG<br />
686.000 Euro Strukturförderung<br />
BREGENZ<br />
Auf Antrag von LH Sausgruber<br />
hat das Land eine weitere Ausschüttung<br />
von Strukturförderungsmitteln<br />
beschlossen.<br />
Dadurch erhalten finanzschwächere<br />
Gemeinden<br />
Beiträge von über 686.000<br />
Euro zur Finanzierung wichtiger<br />
kummunaler Infrastrukturprojekte.<br />
Herbert Sausgruber:<br />
„Die Bemühungen des Landes,<br />
gemeinsam mit dem Vorarlberger<br />
Gemeindeverband über<br />
den Strukturfonds finanzschwachen<br />
Gemeinden zu<br />
unterstützen, laufen sehr erfolgreich.“<br />
Als Beispiele nannte<br />
Sausgruber: die Errichtung<br />
eines Bühnenanbaus beim<br />
Mehrzweckgebäude in der<br />
Gemeinde Möggers, den<br />
Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges<br />
in Bürserberg sowie die<br />
Errichtung einer Löschwasserversorgungsanlage<br />
in Zwi-<br />
Aus den Bundesländern<br />
Erlebnisbergwerk<br />
Steinöl als<br />
Naturheilmittel<br />
ACHENSEEREGION<br />
In Tirol wird seit mehr als<br />
100 Jahren Steinöl aus<br />
Ölschiefern als Naturheilmittel<br />
gewonnen. Ein gläserner<br />
„Berg“ in der Region Achensee<br />
gewährt Einblick in<br />
diese Tradition. Der Berg ist<br />
dem Logo des Betriebes und<br />
einem historischen Bergwerk<br />
nachempfunden. Das<br />
Herzstück ist eine funktionierende<br />
Schwelanlage, die<br />
zeigt, wie aus dem harten<br />
Ölschiefer das „schwarze<br />
Gold“ rinnt. Weitere Eindrücke<br />
vermittelt eine<br />
„Steinöl-Show“ in fünf Sprachen.<br />
Der Glasberg kann<br />
auch für Veranstaltungen<br />
wie Vernissagen oder Musikabende<br />
genutzt<br />
werden und eignet<br />
sich als Schlechtwetter-Programm<br />
für Gäste.<br />
Impulse für Kommunen<br />
schenwasser und in Stallehr<br />
die Errichtung eines Sportplatzes.<br />
Der Strukturfonds wurde<br />
von LH Sausgruber gemeinsam<br />
mit dem Vorarlberger<br />
Gemeindeverband 1997 initiiert,<br />
um finanzschwachen und<br />
strukturbedürftigen Gemeinden<br />
zu helfen. Gemeinden bis<br />
1300 Einwohner erhalten<br />
generell 20 %; Gemeinden<br />
von 1301 bis 3000 Einwohner<br />
15 %; Gemeinden von 3001<br />
bis 5000 Einwohner zehn Prozent<br />
an Förderung. Die Strukturförderung<br />
je Projekt ist mit<br />
maximal 200.000 Euro<br />
begrenzt. Bisher erhielten 470<br />
Projekte mit einem Volumen<br />
von rund 181,4 Mio. Euro eine<br />
Förderungszusage. Die<br />
Summe der zugesagten Mittel<br />
beläuft sich auf rund<br />
14,9 Mio. Euro, davon<br />
sind etwa 12,5 Mio<br />
bereits ausbezahlt.<br />
KOMMUNAL 89
Blindtext Info-Mix & Blindtext<br />
Gemeindebund-Jubilare<br />
Die runden Geburtstage des Jahres 2004<br />
Drei Landesgeschäftsführer<br />
führen die Liste an<br />
WIEN<br />
Der Österreichische Gemeindebund<br />
feiert 2004 wieder<br />
etlicht runde Geburtstage.<br />
So begeht Hofrat Dr. Friedrich<br />
Lechner seinen 85.<br />
Geburtstag. Er gehörte 1947<br />
zu den Gründern des OberösterreichischenGemeindebundes<br />
und war bis 1984<br />
dessen Landesgeschäftsführer.<br />
Regierungsrat Dir. Alfred<br />
Schöggl feiert seinen 80-er.<br />
Der langjährige Bürgermeister<br />
der Stadt Mariazell folgte<br />
1979 dem legendären Albert<br />
Hammer als Landesgeschäftsführer<br />
des Steiermärkischen<br />
Gemeindebundes nach.<br />
Univ.Prof. Dr. Hans Neuhofer<br />
ist der 75-er der „Runden“.<br />
Er übernahm 1984 in<br />
Oberösterreich die Geschäfte<br />
von Friedrich Lechner und<br />
erwarb sich einen weit über<br />
die Grenze Österreichs hinausgehenden<br />
Ruf als „Doyen<br />
der österreichischen <strong>Kommunal</strong>wissenschaften“.<br />
Es gibt 2004 keinen 70-er zu<br />
feiern, dafür aber ein Reihe<br />
prominenter 65-er: An der<br />
Spitze zu nennen ist der<br />
1. Vizepräsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
und Präsident des Steiermärkischen<br />
Gemeindebundes,<br />
Bürgermeister Hermann<br />
Kröll. Der langjährige<br />
Schladminger Gemeindechef<br />
führt seit 1992 mit großem<br />
Erfolg den steirischen Verband.<br />
Günther Pumberger führte<br />
ab 1992 den oberösterreichischen<br />
Verband als Präsident,<br />
trat aber 2002 als Bürgermeister<br />
und als Präsident zurück.<br />
Vor allem seine Leistungen<br />
auf europäischer Ebene sind<br />
in Erinnerung geblieben.<br />
Den 65-er feiern noch Edgar<br />
Kopp, Bürgermeister von<br />
Rum und Vizepräsident des<br />
Tiroler Gemeindeverbands<br />
90 KOMMUNAL<br />
sowie Andreas Kinzl, Bürgermeister<br />
a.D. von Oberndorf<br />
.<br />
Die Runde der 60-er wird<br />
2004 von Dietmar Pilz,<br />
Finanzexperte des Österreichischen<br />
und des Steiermärkischen<br />
Gemeindebundes<br />
und von Helmut Lackner,<br />
Landesgeschäftsführer des<br />
Kärntner Gemeindebundes<br />
angeführt.<br />
Den 60-er feiern weiters<br />
Bgm. Fritz Knotzer aus Traiskirchen<br />
in NÖ, Bgm. a.D.<br />
Hans Rauscher aus Tamsweg,<br />
Bgm. Alfred Grandits<br />
aus Stinatz und der Vizepräsident<br />
des Steiermärkischen<br />
Gemeindebundes Bgm. Prof.<br />
Bernd Stöhrmann aus Mitterndorf<br />
im Mürztal.<br />
Die 55-er des Jahres sind der<br />
Oggauer Bürgermeister und<br />
Präsident der sozialdemokratischen<br />
Gemeindevertreter in<br />
Burgenland, Ernst Schmid,<br />
der Kärntner Vizepräsident<br />
Vinzenz Rauscher, Bürgermeister<br />
von Hermagor sowie<br />
Prof. Mag. Matthias Hemetsberger,<br />
Bürgermeister von<br />
Seeham.<br />
Die 50-er werden angeführt<br />
von Mag. Wilfried Berchtold,<br />
Präsident des Vorarlberger<br />
Gemeindeverbandes und Bürgermeister<br />
von Feldkirch. Weiter<br />
feiern diesen Runden die<br />
Bürgermeister Johann Pichler<br />
(Heidenreichstein),<br />
Robert Hammer (Unterlamm),<br />
Karl Lackner (Donnersbach)<br />
sowie der burgenländische<br />
sozialdemokratische<br />
Vizepräsident Johann Nussgraber<br />
aus Kemeten.<br />
Der Gütternbacher Bürgermeister<br />
Leo Radakovits<br />
beschließt die Runde der<br />
Jubilare. Er begeht heuer seinen<br />
45. Geburtstag.<br />
KOMMUNAL gratuliert allen<br />
Geburtstagskindern und<br />
wünscht für die Zukunft alles<br />
Gute und viel Erfolg.<br />
Personalia Niederösterreich<br />
Neue Abteilungsleiter im Land<br />
Neue Chefs für Naturschutz sowie<br />
Bau- und Raumordnungsrecht<br />
ST. PÖLTEN<br />
Das Amt der NÖ Landesregierung<br />
hat zwei neue<br />
Abteilungsleiter: Dipl.Ing.<br />
Wolfgang Urban folgt mit<br />
1. Juli Hofrat Dipl.Ing.<br />
Erich Wurzian als Leiter der<br />
Abteilung Naturschutz; Dr.<br />
Gerald Kienastberger wird<br />
Leiter der Abteilung Bauund<br />
Raumordnungsrecht.<br />
Er folgt damit auf Dr. Franz<br />
Xaver Wagner.<br />
Wolfgang Urban (Jahrgang<br />
1966) war bisher in der<br />
Abteilung Allgemeiner Baudienst<br />
tätig. Er studierte an<br />
der Universität für Bodenkultur<br />
Forst- und Holzwirtschaft<br />
und trat 1993 in das<br />
Amt der Salzburger Landesregierung<br />
ein. Er wechselte<br />
Personalia Salzburg<br />
Bürgermeisterkonferenz<br />
Obmann bestätigt<br />
SEEHAM<br />
Der Seehamer Ortschef Matthias<br />
Hemetsberger (ÖVP)<br />
wurde als Obmann der<br />
Flachgauer Bürgermeisterkonferenz<br />
wiedergewählt.<br />
Als Vorstands-Mitglieder des<br />
Salzburger Gemeindeverbandes<br />
wurden Bgm. Lud-<br />
Oberösterreich ehrt<br />
LINZ<br />
Das „Goldene Ehrenzeichen<br />
des Landes Oberösterreich“<br />
überreichte Landeshauptmann<br />
Dr. Josef Pühringer<br />
Anfang Mai 2004 an die ehemalige<br />
Präsidentin des Bundesrates<br />
Uta Barbara Pühringer.<br />
Ihre politische Karriere<br />
startete sie 1990 im Linzer<br />
Gemeinderat, wo sie bis 1994<br />
tätig war. In ihrer Zeit als<br />
Abgeordnete zum Oö. Landtag<br />
1996 und 1997 war sie<br />
unter anderem im Ausschuss<br />
im April 2004 ins Amt der<br />
NÖ Landesregierung.<br />
Dr. Gerald Kienastberger<br />
(Jahrgang 1956) studierte<br />
Jus und promovierte 1982<br />
zum Doktor der Rechtswissenschaften.<br />
1983 trat er in<br />
den NÖ Landesdienst ein.<br />
Seine berufliche Laufbahn<br />
begann er an den BezirkshauptmannschaftenKorneuburg<br />
und Gänserndorf.<br />
Ab 1986 war er drei Jahre<br />
lang wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter des Verfassungsgerichtshofes.<br />
Nach<br />
seiner Rückkehr ins Amt<br />
der NÖ Landesregierung<br />
wurde er 1997 stellvertretender<br />
Leiter der Abteilung<br />
Bau- und Raumordnungsrecht.<br />
wig Bieringer (Wals-Siezenheim),<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer<br />
(Hallwang) und<br />
Bgm. Matthias Hemetsberger<br />
bestätigt. Für den abgewählten<br />
Andreas Kinzl aus<br />
Oberndorf rückt Bgm. Hartmut<br />
Schremser aus Fuschl<br />
nach.<br />
Goldenes Ehrenzeichen des Landes<br />
Uta Barbara Pühringer geehrt<br />
für Bildung, Jugend, Kultur<br />
und Sport vertreten.<br />
1997 wurde Uta Barbara<br />
Pühringer in den Bundesrat<br />
entsandt, dem sie im ersten<br />
Halbjahr 2002 als Präsidentin<br />
vorstand.<br />
„Mit ihrem politischen Wirken<br />
und ihrem großen Einsatz für<br />
die Anliegen der Pflichtschullehrer<br />
hat sich Uta Barbara<br />
Pühringer um Oberösterreich<br />
bleibende Verdienste erworben“,<br />
so der Landeshauptmann<br />
in seiner Laudatio.
Wechsel im Salzburger Gemeindeverband<br />
Neuer Landesgeschäftsführer per 1. Juli 2004<br />
Dr. Hocker in Pension, Dr. Huber im Amt<br />
SALZBURG<br />
Am 1. Juli 2004 übernimmt<br />
Dr. Martin Huber, geboren<br />
1965, die Geschäftsführung<br />
des Salzburger Gemeindeverbandes.<br />
Martin Huber trat<br />
nach Absolvierung des rechtswissenschaftlichen<br />
Studiums<br />
Anfang 1991 als rechtskundiger<br />
Mitarbeiter in den Dienst<br />
des Salzburger Gemeindeverbandes<br />
ein. Er war seither<br />
unter anderem publizistisch<br />
tätig und hat sich als Koautor<br />
des anerkannten Kommentars<br />
zur Salzburger Gemeindeordnung<br />
einen Namen gemacht.<br />
Er ist Lektor für Gemeinderecht<br />
im Lehrgang für Public<br />
Management an der Fachhochschule<br />
Technikum Kärnten.<br />
Er gilt auch als hervorragender<br />
Kenner des Baurechtes<br />
und des Raumordnungsrechtes<br />
und ist federführend an<br />
der Entwicklung des Projektes<br />
E-Government tätig. Seit 1999<br />
ist Dr. Huber bereits stellvertretender<br />
Geschäftsführer des<br />
Salzburger Gemeindeverbandes<br />
und folgt nunmehr Dir. Dr.<br />
Franz Hocker in dieser Funktion<br />
nach, der am 30. Juni<br />
2004 in den Ruhestand tritt.<br />
Todesfall<br />
35 Jahre im Dienst<br />
Walter Scalet ist<br />
gestorben<br />
ÖTZ<br />
Walter Scalet, Tourismusdirektor<br />
in Ötz im Ötztal, ist<br />
gestorben. Nach 35 Jahren<br />
im Dienste des Tourismus<br />
seiner Heimatgemeinde und<br />
für das gesamte Ötztal war<br />
es ihm nur zwei Jahre vergönnt,<br />
die wohlverdiente<br />
Pension zu genießen.<br />
Der Ehrenzeichenträger der<br />
Gemeinde Ötz war viele<br />
Jahre Ortsfeuerwehrkommandant<br />
und Bezirksfeuerwehrinspektor.<br />
Seiner Familie,<br />
der er ein guter Ehemann,<br />
Vater und Großvater<br />
war, gilt unser Mitgefühl.<br />
Franz Hocker, geboren 1942,<br />
trat nach den rechtswissenschaftlichen<br />
Studien 1974 in<br />
den Dienst des Gemeindeverbandes<br />
und hat<br />
durch nunmehr 30<br />
Jahre die Salzburger<strong>Kommunal</strong>politik<br />
maßgeblich mitgestalten<br />
können.<br />
Er hat in dieser Zeit<br />
an mehrfachen<br />
Änderungen des<br />
Salzburger Baurechtes,<br />
des<br />
Umwelt- und<br />
Abfallrechtes, des<br />
Gemeinderechtes,<br />
des Sozialrechtes,<br />
aller Steuerrechte,<br />
des Fremdenverkehrsgesetzes<br />
und aller anderen<br />
für die Gemeinden maßgeblichen<br />
Rechtsmaterien<br />
entscheidend mitgewirkt.<br />
Bereits in den ersten Jahren<br />
hat er die Getränkesteuer-<br />
prüfstelle für die Salzburger<br />
Gemeinden ins Leben gerufen<br />
und geleitet, sie aber nunmehr<br />
selbst aus den bekannten<br />
Gründen wieder<br />
liquidieren müssen.<br />
Ein besonderes<br />
Anliegen waren ihm<br />
immer Strategien<br />
der Organisation<br />
und der Verbesserung<br />
der Gemeindeverwaltung.<br />
Im Rahmen<br />
des ÖsterreichischenGemeindebundes<br />
hat sich Dr.<br />
Hocker besonders<br />
um das Finanzwesen<br />
gekümmert und an<br />
den Vorbereitungen<br />
für die zahlreichen<br />
Finanzausgleichsverhandlungen<br />
mitgewirkt. Nicht zuletzt<br />
hat er dreimal, nämlich 1981,<br />
1990 und 1999 den Österreichischen<br />
Gemeindetag in<br />
Salzburg organisiert.<br />
Neuer Service für Gemeinden<br />
KOMMUNAL startet<br />
neues Online-Archiv<br />
Unter der Adresse<br />
www.kommunal.at/archiv<br />
finden Österreichs<br />
Gemeinden ein neues Service:<br />
Gemeinsam mit APA<br />
DeFacto, Österreichs größtem<br />
Medien-Archiv, baut<br />
Österreichs größtes Fachmagazin<br />
für <strong>Kommunal</strong>politik<br />
derzeit ein Archiv auf.<br />
Dr. Martin Huber<br />
Einfach, schnell und<br />
punktgenau können Interessierte<br />
mit einer Volltext-<br />
Suche in den Artikeln von<br />
KOMMUNAL recherchieren,<br />
suchen und surfen.<br />
Die bisher bestehenden<br />
Angebote auf www.<br />
kommunal.at bleiben<br />
natürlich bestehen.<br />
So sind Sie jederzeit über alles informiert<br />
Die KOMMUNAL-<strong>Ausgabe</strong>n<br />
seit Jänner 2002 als PDF<br />
www.kommunal.at<br />
Blindtext & Blindtext Info-Mix<br />
Auszeichnungen<br />
Der Herr<br />
Bundespräsident<br />
hat verliehen<br />
Mit Entschließung vom<br />
5. Mai 2004:<br />
Die Goldene Medaille für<br />
Verdienste um die Republik<br />
an Anton Pabel,<br />
ehem. Gemeinderat der<br />
Marktgemeinde Hellmonsödt<br />
/ OÖ sowie an Hubert<br />
Zellinger, ehem. Gemeinderat<br />
der Marktgemeinde<br />
Offenhausen / OÖ.<br />
Mit Entschließung vom<br />
12. Mai 2004<br />
Das Goldene Verdienstzeichen<br />
der Republik an<br />
Ing. Norbert Lindenbauer,<br />
ehem. Bürgermeister der<br />
Gemeinde Oftenring / OÖ<br />
und an Franz Mair, ehem.<br />
Bürgermeister der Gemeinde<br />
Redlham / OÖ.<br />
Das Silberne Verdienstzeichen<br />
der Republik an<br />
Kurt Schindlauer, ehem.<br />
Vizebürgermeister der<br />
Gemeinde Oberwang / OÖ<br />
und an Robert Charvat,<br />
ehem. Gemeinderat der<br />
Marktgemeinde Brunn am<br />
Gebirge / NÖ.<br />
Die Goldene Medaille für<br />
Verdienste um die Republik<br />
an Johann Hausleitner,<br />
ehem. Gemeinderat der<br />
Gemeinde Oberwang / OÖ<br />
und an Franz Schragl sowie<br />
an Karl Kremair, beide<br />
ehem. Gemeinderäte der<br />
Gemeinde Oftenring / OÖ.<br />
Mit Entschließung vom<br />
18. Mai 2004<br />
Die Goldene Medaille für<br />
Verdienste um die Republik<br />
an Christine Schistek,<br />
ehem. Gemeinderätin der<br />
Gemeinde Burgkirchen / OÖ<br />
KOMMUNAL 91
Info-Mix<br />
Charta der Dörfer<br />
Die Konferenz war<br />
dem Thema „Wasser“<br />
gewidmet.<br />
Innviertler waren beim „Kulturdorf 2000“<br />
Kirchheim grüßt Paxos<br />
KIRCHHEIM / PAXOS<br />
Am 19. Oktober 2000 fasste<br />
der Gemeinderat der<br />
Gemeinde Kirchheim im Innkreis<br />
den Beschluss, der sogenannten<br />
„Foundation of cultural<br />
villages of Europe“ oder<br />
auch „Charta der Dörfer“ beizutreten.<br />
Damit ist Kirchheim<br />
als erste und einzige<br />
Gemeinde Österreichs Mitglied<br />
dieser internationalen<br />
Organisation, die es sich zum<br />
Ziel gesetzt hat, die Förderung<br />
des dörflichen Lebens und der<br />
ländlichen Entwicklung voranzutreiben.<br />
Kürzlich fand auf der griechischen<br />
Insel Paxos die diesjährige<br />
Konferenz der Bürgermeister<br />
unter Leitung von<br />
Bürgermeister Hans Hartl<br />
statt. Mit dieser Konferenz<br />
wurden offiziell die Feierlichkeiten<br />
zum „Kulturdorf Europas<br />
2004“ eröffnet.<br />
Die Einwohner der Insel Paxos<br />
– südlich von Korfu gelegen –<br />
lebten früher von ihren Olivenbäumen<br />
aus denen Öl<br />
gepresst und Seife hergestellt<br />
wurde. Inzwischen hat längst<br />
der Tourismus die Landwirtschaft<br />
als erste Einnahmenquelle<br />
verdrängt. Paxos setzt<br />
noch immer auf einen angepassten,<br />
„sanften“ Tourismus<br />
im Gegensatz zum Massentourismus<br />
auf Korfu.<br />
Die Konferenz war dem<br />
Thema „Wasser“ gewidmet.<br />
Paxos hat keine Brunnen, es<br />
lebt vom Regenwasser. Dieses<br />
kostbare Gut wird in Zisternen<br />
und Staubecken aufgefangen<br />
92 KOMMUNAL<br />
und trotz aller Sparmaßnahmen,<br />
mit dem durchschnittlichen<br />
Wasserverbrauch eines<br />
Österreichers würden in den<br />
griechischen Haushalten nur<br />
eine Person lediglich 200 Tage<br />
des Jahres auskommen.<br />
Gerade in der Sommersaison<br />
ist daher die Bewusstmachung<br />
dieser Tatsachen eine wichtige<br />
Aufgabe der Einwohner.<br />
In den nächsten Monaten<br />
wird jedes der 11 Kulturdörfern<br />
Paxos einen Besuch<br />
abstatten. Im Juli findet eine<br />
Jugendprojekt statt, bei dem<br />
dieses Mal die Jugendlichen in<br />
ein archäologisches Projekt<br />
eingebunden werden. Im<br />
Oktober wird dann eine Kirchheimer<br />
Abordnung den langen<br />
Luft- und Seeweg auf sich<br />
nehmen, um mit den 2500<br />
Bewohner der Insel zu feiern,<br />
zu musizieren, Erfahrungen<br />
auszutauschen, zu tanzen und<br />
zu spielen.<br />
Die Kirchheimer wollen ab<br />
2005 mit der Hauptschule<br />
Mettmach zusammen ein<br />
gemeinsames EU- Schulprojekt<br />
mit den Schulen aus fünf<br />
bis sechs Kultur-Dörfern starten.<br />
Die ersten Planungen<br />
dazu wurden ebenfalls<br />
gemacht. In Paxos wurden<br />
auch neue Ideen für 2010<br />
gesammelt, wo Kirchheim als<br />
Kulturdorf des Jahres die<br />
europäische Bühne betreten<br />
wird.<br />
Nähere Infos über die „Charta<br />
der Dörfer“ finden Sie auf der<br />
Homepage der Gemeinde<br />
Kirchheim www.kirchheim.at<br />
In Nebelberg sind die „Geehrten“ in der ersten Reihe, die Gratulanten<br />
stellten sich hinten an.<br />
Gemeinde ehrt<br />
Ehrenbürger und Verdienstnadel verliehen<br />
22 Jahre Bürgermeister<br />
NEBELBERG<br />
Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde<br />
an Altbürgermeister<br />
ÖkRat Josef Märzinger<br />
und der Goldenen Verdienstnadel<br />
an den Pfarrer<br />
aus Peilstein, Konsistorialrat<br />
Andreas Fischer, dankte die<br />
Gemeinde Nebelberg für verdiente<br />
Leistungen.<br />
Josef Märzinger lenkte 22<br />
Jahre die Geschicke der<br />
Gemeinde Nebelberg und<br />
war 34 Jahre lang aktiv im<br />
Gemeinderat. In dieser Zeit<br />
wurden viele Projekte verwirklicht<br />
und die aufstrebende<br />
Entwicklung von<br />
Nebelberg eingeleitet. In der<br />
156jährigen Geschichte der<br />
Gemeinde wurde die Ehrenbürgerwürde<br />
erst sechs Mal<br />
vergeben. Bürgermeister Otto<br />
Blick über die Grenzen<br />
Österreichische Sparkassen tagten in Prag<br />
Feldkirch erfolgreichste Kasse<br />
WIEN / FELDKIRCH / PRAG<br />
Nur wenige Tage nach der<br />
EU-Erweiterung hielten die<br />
österreichischen Sparkassen<br />
als bisher einzige internationale<br />
Finanzgruppe ihre Jahrestagung<br />
bereits in einem der<br />
neuen Beitrittsländer ab. Der<br />
47. Sparkassentag, der vom<br />
17. bis 19. Mai zum ersten<br />
Mal in Prag stattfand, stand<br />
unter dem Motto „Die Sparkassen<br />
im Neuen Europa“.<br />
Mehr als 300 Topmanager aus<br />
62 österreichischen Sparkassen<br />
und ihren Tochterunternehmen<br />
aus der Tschechischen<br />
Republik, Slowakei und<br />
Ungarn diskutierten mit<br />
Experten über die wichtigsten<br />
bankpolitischen Entwicklungen,<br />
Trends und Chancen in<br />
Zentraleuropa.<br />
Pfeil in seiner Laudatio: „Die<br />
höchste Gemeindeauszeichnung<br />
sollte eine Würdigung<br />
der Leistungen und gleichzeitig<br />
eine Überraschung zum<br />
65. Geburtstag sein.“<br />
Die Ortschaften Heinrichsberg<br />
und Vordernebelberg<br />
der Gemeinde Nebelberg<br />
gehören zum Pfarrgebiet von<br />
Peilstein. Für das seelsorgerische<br />
Wirken wurde daher<br />
Pfarrer Andreas Fischer mit<br />
der Goldenen Verdienstnadel<br />
ausgezeichnet, welche bisher<br />
erst drei Mal vergeben<br />
wurde. Im Rahmen dieser<br />
Feier wurden auch die ausgeschiedenen<br />
Gemeinderäte<br />
Max Kasper, August Pühringer<br />
und Josef Zinöcker mit<br />
einer Anerkennungsurkunde<br />
bedacht.<br />
Im Mittelpunkt der Tagung<br />
standen u.a. Fragen zur strategischen<br />
Positionierung und<br />
Zukunft der Sparkassengruppe<br />
im erweiterten Heimmarkt,<br />
zur Markenpolitik, zur<br />
gesellschaftlichen Verantwortung<br />
der Sparkassen sowie zur<br />
Rolle der Ethik im modernen<br />
Management.<br />
Erstmals am Sparkassentag<br />
wurde auch der „Sparkassen-<br />
Award“ verliehen. Im faszinierenden<br />
Ambiente der Spanischen<br />
Halle im Hradschin<br />
hoch über der „Goldenen<br />
Stadt“ wurden die drei erfolgreichsten<br />
Sparkassen jeder<br />
Ranggruppe prämiert. Zum<br />
Gesamtsieger und damit<br />
besten Sparkasse Österreichs<br />
wurde die Sparkasse Feldkirch<br />
gekürt.
Geburtstag Salzburg<br />
Bürgermeister Josef Aschauer, ein 50-er<br />
Neuer Bürgermeister hat bisher<br />
Herausforderungen gut gemeistert<br />
SCHEFFAU<br />
Anfang Mai vollendete der<br />
neue Scheffauer Bürgermeister<br />
und Vorstands-Vorsitzende<br />
der Tennengauer Versicherung,<br />
Josef Aschauer, sein<br />
50. Lebensjahr. Als Gratulanten<br />
stellten sich die beiden<br />
ÖVP-Landtagsabgeordneten<br />
des Tennengaus, Michael<br />
Neureiter und Sepp Schwarzenbacher,<br />
ein: Sie betonten,<br />
Sepp Aschauer habe in den<br />
ersten beiden Monaten seiner<br />
Verantwortung als Bürgermeister<br />
„die aktuellen Herausforderungen<br />
gut gemeistert“<br />
– vor allem als „Problemmanager“<br />
beim Projekt<br />
einer Klärschlammverbrennung<br />
in Scheffau.<br />
Aschauer hat 1981 das elterliche<br />
Esslgut in Scheffau über-<br />
Der neue Vorstand: Mag.Wolfgang Lidl, Bgm.Christoph Stark,<br />
Ing.Karl Reisenhofer, Bernhard Pilz, Wolfgang Wurm, Dir.Josef Tändl<br />
Neue Führung im TIP-Citymanagement<br />
Wichtiger Partner der Stadt<br />
GLEISDORF<br />
Das TIP-Citymanagement ist<br />
die Ansprechstelle für alle<br />
Wirtschaftstreibenden der<br />
Stadt Gleisdorf und Informationsbüro<br />
für BesucherInnen<br />
der Region. Darüber hinaus<br />
beschäftigt sich das TIP-<br />
Citymanagement mit der Vermarktung<br />
und weiteren<br />
Bekanntmachung Gleisdorfs<br />
und ist damit wichtiger Partner<br />
der Stadtgemeinde.<br />
Nach einer öffentlichen Aus-<br />
Foto: Renz<br />
Personalia Steiermark<br />
nommen. Von 1991 bis 2001<br />
war er stellvertretender<br />
Obmann der Tennengauer<br />
Versicherung, war seit 2001<br />
Die Gratulanten Michael Neureiter<br />
(links), der Jubilar und<br />
Sepp Schwarzenbacher.<br />
deren Obmann und ist seit<br />
2004 Vorstands-Vorsitzender.<br />
Seit der Bürgermeisterwahl<br />
2004 ist Josef Aschauer<br />
„Chef“ seiner Heimatgemeinde<br />
Scheffau.<br />
schreibung und einem Auswahlverfahren<br />
erfolgte im<br />
Februar dieses Jahres ein<br />
Hearing mit insgesamt acht<br />
BewerberInnen. Als eindeutiger<br />
Sieger ging aus diesen<br />
zweiteiligen Bewerbergesprächen<br />
ein Mann hervor:<br />
Mag. Wolfgang Lidl.<br />
Der 42-jährige Mag. Lidl ist<br />
Gleisdorfer und seit Jahren<br />
selbst erfolgreicher Unternehmer.<br />
Im April folgte auch die<br />
Neuwahl des Vorstandes.<br />
Ein Blick nach Südtirol<br />
Info-Mix<br />
Ein 50-er beim Südtiroler Gemeindetag 2004<br />
Auch in Südtirol läuft<br />
Finanzauskommen aus<br />
ST. MARTIN IN THURN /<br />
SAN MARTIN DE TOR<br />
Am Pfingstsamstag lud der<br />
Südtiroler Gemeindenverband<br />
„seine“ Bürgermeister aus 116<br />
Gemeinden zum diesjährigen<br />
Das Präsidium des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes<br />
Gemeindetag nach St. Martin<br />
in Thurn / San Martin de Tor<br />
im ladinischen Gadertal am<br />
Fuße des Peitler Kofels. Der<br />
Gemeindetag bildete heuer den<br />
würdigen Rahmen, der Gründung<br />
des Verbandes vor 50<br />
Jahren zu gedenken.<br />
Der Präsident des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes, der Bürgermeister<br />
von Meran Franz<br />
Alber, hob die Einsetzung des<br />
„Rates der Gemeinden“ im vergangenen<br />
Jahr hervor. Dieses<br />
Gremium gibt Gutachten zu<br />
allen Gesetzesvorschlägen des<br />
Landes und zu den Verwaltungsmaßnahmen<br />
der Landesregierung<br />
ab, wenn sie die<br />
Interessen der Gemeinden<br />
betreffen.<br />
Danach sprach Alber auch die<br />
Finanzzuweisungen des Landes<br />
an die Gemeinden an. Das dreijährige<br />
Finanzabkommen zwischen<br />
dem Land Südtirol und<br />
den Gemeinden läuft im Herbst<br />
aus. Bei Landeshauptmann Dr.<br />
Luis Durnwalder, der auch das<br />
Gemeindereferat innehat,<br />
wurde beantragt, auch für die<br />
nächsten drei Jahre die beste-<br />
hende Koppelung der Zuweisungen<br />
an die Gemeinden an<br />
die Steuereinnahmen des Landes<br />
im selben Ausmaß zu<br />
bestätigen. Alber hat weiters<br />
auf die Verabschiedung der<br />
neuen Gemeindeordnung<br />
samt<br />
Wahlordnung und<br />
Regelung der<br />
Amtsentschädigungen<br />
gedrängt,<br />
damit die Neuregelung<br />
noch vor<br />
den Gemeinderatswahlen<br />
im<br />
nächsten Jahr<br />
wirksam wird.<br />
Wie üblich ging<br />
LH Durnwalder<br />
auf die aufgeworfenen Fragen<br />
ein und nahm dazu Stellung.<br />
Die Zusicherungen des Landeshauptmanns<br />
in Bezug auf die<br />
Finanzierung in den nächsten<br />
Jahren und die Neuregelung<br />
der Gemeindeordnung wurde<br />
von den Teilnehmern des<br />
Gemeindetages mit Genugtuung<br />
zur Kenntnis genommen.<br />
Für den Österreichischen<br />
Für den Tiroler Gemeindeverband<br />
gratulierten Präsident<br />
Bgm. Rauch und Vizepräsident<br />
Bgm. Fankhauser Franz Alber<br />
zum „50-er“.<br />
Gemeindebund überbrachten<br />
Präsident Hubert Rauch und<br />
Vizepräsident Günther Fankhauser<br />
vom Tiroler Gemeindeverband<br />
Grüße. Und sie gratulierten<br />
Franz Alber „zum 50-er“<br />
des Südtiroler Verbandes.<br />
KOMMUNAL 93
Info-Mix<br />
KOMMUNAL<br />
Kuriose Ortsnamen<br />
Von Affenhausen bis Zipfel - ein „Orts“buch<br />
Prost auf die Gesundheit<br />
– aber nicht zu viel<br />
Unser Ortsbuch hätte zum<br />
Thema „Hölle“ und „Teufel“<br />
einiges zu bieten (der Flecken<br />
Hölle liegt in der Seewinkel-<br />
Gemeinde Illmitz, der Teufelsgraben<br />
im oö. Kronstorf). Mit<br />
dem Ausflug nach Gruft und<br />
Jenseits im letzten KOMMU-<br />
NAL wollen wir es aber dabei<br />
bewenden lassen. Es sieht<br />
nämlich so aus, als ob der<br />
94 KOMMUNAL<br />
Sommer endlich Einzug hält<br />
im Lande. Und da denkt doch<br />
wohl so mancher eher an<br />
einen gut bestückten Griller<br />
und – vor allem – an ein<br />
kühlendes Getränk. Und dazu<br />
hat unser Ortsbuch wieder was<br />
zu sagen. Seltsam, dass es uns<br />
damit wieder nach Niederund<br />
Oberösterreich verschlägt.<br />
Mag. Hans Braun<br />
Vorsicht mit dem „Trinkfass“,<br />
wenn man in „Kotzendorf“ ist<br />
„Trinkfass ist in Taufkirchen<br />
schon seit Generationen ein<br />
Begriff – und wir hoffen, dass<br />
wir Trinkfassler den Taufkirchnern<br />
alle Ehre machen und<br />
der Name noch recht lange<br />
Bestand hat.“ So lautet das<br />
Credo des Rudolf Angermair,<br />
Bürgermeister a.D. und Landwirt<br />
aus Passion.<br />
Der Trinkfasshof im Gebiet<br />
der Gemeinde Taufkirchen an<br />
der Trattnach, Bezirk<br />
Grießkirchen, wurde 1417<br />
errichtet. Wie im Hausruckviertel<br />
üblich, ist auch bei den<br />
Trinkfasslern der Most das<br />
Hofgetränk Nummero eins.<br />
„Aber heutzutage mehr Süssmost<br />
wegen dem Alkohol,<br />
sonst könnte es passieren,<br />
dass man am Nachmittag das<br />
Feld nicht mehr findet.“<br />
Die Trinkfassler sind gemütliche<br />
Leute. Eine Halbe Most,<br />
Speck oder ein Bratl zur<br />
Jause auch für die Besucher<br />
und die Welt ist in Ordnung.<br />
Und das rauschende Fest<br />
kürzlich mit dem Kirchenchor?<br />
„Ein paar Mostfassln<br />
haben wir gezwickt, g’soffen<br />
wurde bis spät in die Nacht.<br />
Aber Trinker sind wir keine,<br />
des war halt ein Ausrutscher.“<br />
Und damit weiter nach Niederösterreich<br />
in den Bezirk<br />
Horn. Nach Kotzendorf bei<br />
Gars am Kamp. „Früher waren<br />
wir Kotzendorfer harte Burschen.<br />
Wir haben viel gestritten<br />
und gerauft, dass wir in<br />
Kotzendorf, die Reitergemeinde<br />
im nördlichen Niederösterreich<br />
ist 1300 Jahre alt.<br />
der Nonndorfer Volksschule –<br />
Kotzendorf hatte nie eine –<br />
immer ein paar Minuten länger<br />
bleiben mußten, damit die<br />
anderen Kinder sicher nach<br />
Hause können.“<br />
Heute: 25 Hausnummern,<br />
eine verschlossene Kapelle, die<br />
letzte Buschenschank seit Jahren<br />
gesperrt und seit dem<br />
strengen Winter 1986 auch<br />
kein „Kotzendorfer Tröpferl“<br />
mehr. Da darf einen die Antwort<br />
des Ortsvorstehers auf<br />
die Frage nach seinem letzten<br />
Rausch nicht verwundern:<br />
„Gestern“, gibt er reumütig zu.<br />
Aus Franz Dürnsteiner,<br />
“Von Affenhausen bis Zipfel –<br />
Österreichs wundersame<br />
Ortsnamen”, Edition Löwenzahn,<br />
ORF 1994.<br />
Sachbuch<br />
Wörter der Jahre ‘71-’02<br />
Von „aufmüpfig“<br />
bis „Teuro“<br />
Besserwessi, Reformstau, Millennium,<br />
Schwarzgeldaffäre –<br />
alle Jahre wieder steht die<br />
Aktion „Wort des Jahres“ im<br />
Mittelpunkt des öffentlichen<br />
Interesses.<br />
Der neue<br />
vierte Band<br />
„Von aufmüpfig<br />
bis Teuro –<br />
Die Wörter<br />
der Jahre<br />
1971–2002“<br />
aus der Reihe<br />
„Thema<br />
Deutsch“, welche die Dudenredaktion<br />
zusammen mit der<br />
Gesellschaft für deutsche<br />
Sprache herausgibt, vermittelt<br />
wissenswerte und hintergründige<br />
Informationen rund um<br />
die Aktion und erläutert sämtliche<br />
Jahreswörter von 1971<br />
bis 2002 in alphabetischer<br />
Reihenfolge. Ein chronologischer<br />
Überblick über die<br />
„Wörter des Jahres“ und ein<br />
ausführliches Register<br />
beschließen den Band. Das<br />
345 Seiten starke Buch ist ab<br />
sofort für 25 Euro im Handel<br />
erhältlich.<br />
Aus dieser Reihe sind bereits<br />
erschienen: Band 1: „Die<br />
deutsche Sprache zur Jahrtausendwende“,<br />
Band 2: „Name<br />
und Gesellschaft – Soziale<br />
und historische Aspekte der<br />
Namengebung und Namenentwicklung“<br />
und Band 3:<br />
„Deutsch – Englisch –<br />
Europäisch – Impulse für eine<br />
neue Sprachpolitik“.<br />
Das Buch<br />
Duden – Thema Deutsch,<br />
Band 4. „Von „aufmüpfig“<br />
bis Teuro – Die Wörter<br />
der Jahre 19971 bis<br />
2002“, Herausgegeben<br />
von der Dudenredaktion<br />
und der Gesellschaft für<br />
deutsche Sprache, 1. Auflage,<br />
345 Seiten, Kartoniert,<br />
ISBN 3-411-04201-X<br />
Ladenpreis 25,00 e [D]<br />
oder 25,70 e [A], Dudenverlag<br />
Mannheim, Leipzig,<br />
Wien, Zürich 2003<br />
„Lach“-Buch<br />
G’schichtln zum Lachen<br />
Die österreichische<br />
Anekdote<br />
„Sprechtag beim (alten)<br />
Salzburger Landeshauptmann<br />
Haslauer. Eine<br />
65jährige, adrette Dame<br />
ringt mit den Händen und<br />
sagt unentwegt: „Ich trau’<br />
mich nicht, Ihnen mein<br />
Anliegen zu sagen. ...“ Nach<br />
langem Hin und her rückt<br />
sie dann doch mit ihrem<br />
Begehren<br />
heraus: „Wissen’s,<br />
ich bin<br />
seit 15 Jahren<br />
Witwe.<br />
Mir fehlt halt<br />
ein Mann,<br />
und da sie so<br />
viele Menschenkennen,<br />
habe ich<br />
mir gedacht,<br />
sie kennen<br />
einen für<br />
mich.“ Haslauer: „Ja, wie alt<br />
soll er denn sein?“ Die<br />
Dame: „Wenn er g’waschen<br />
is’, kann er bis 90 sein.“<br />
Das ist nur eine der erheiternden<br />
Episoden, die Johannes<br />
Kunz in seinem Buch<br />
beschreibt. Ein weitere noch:<br />
„Die alte Kärntner Herzogsstadt<br />
St. Veit hatte jahrelang<br />
einen sehr trinkfesten „Vize“.<br />
Alsbald die beliebte Quizfrage:<br />
Warum ist der St. Veiter<br />
Hauptplatz so sauber?“ „ Weil<br />
jeden Abend der Vize mit<br />
einem Fetzen d’rübergeht.“<br />
Aber eigentlich könnten sich<br />
beide Anekdoten auch in der<br />
einen oder anderen österreichischen<br />
Gemeinde so<br />
abgespielt haben.<br />
Das Buch<br />
J. Kunz, „Die österreichische<br />
Anekdote“,<br />
Molden Verlag 1998,<br />
296 Seiten, 28,90 Euro,<br />
Restauflage<br />
ISBN: 3-85485-016-6<br />
Bestellungen per E-Mail<br />
vertrieb@molden.at<br />
Fax: 01/533 26 49<br />
Telefon: 01/533 26 39