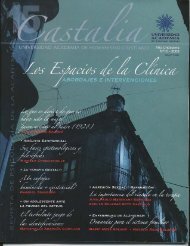PDF-Vollversion
PDF-Vollversion
PDF-Vollversion
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Menschliche ist daher nicht vom Biologischen oder vom Sozialen her<br />
auszulegen, sondern vom Seinsverständnis.<br />
Nach dem daseinsanalytischen Verständnis wird der Mensch dann krank, wenn er<br />
sich unfrei und in seinem menschlichen Dasein bedroht fühlt. Er wird auch krank,<br />
indem er sich seiner Endlichkeit des In-der-Welt-Sein und seinem Gewissen<br />
verschließt (Holzhey-Kunz, 2008). In der Krankheit sind nicht nur einzelne Organe<br />
betroffen, sondern das ganze Dasein ist beeinträchtigt. Dem Menschen wird die<br />
Möglichkeit des Todes bewusst, denn Krankheit weist auf die Beschränktheit und<br />
Vergänglichkeit hin. Folglich gehört zum Dasein als ein Ganzes schließlich auch das<br />
Sein zum Tode. Das heißt, das Sterblichsein ist ein tragender Wesenszug des<br />
menschlichen Daseins und zählt ebenfalls zum Leben. Gesundheit meint hingegen<br />
die Gesamtheit der gegebenen Verhaltensmöglichkeiten eines Menschen im freien<br />
Vollzug. Gesundsein bedeutet auch offen sein für Krankheit, denn ein krampfhaftes<br />
Sichwehren gegen Krankwerden durch Vermeiden von Kontakten wirkt selbst<br />
krankhaft. Krankheit bedeutet letztlich immer einen Verlust an menschlicher Freiheit<br />
(Holzhey-Kunz, 2008).<br />
Die Daseinsanalyse lehnt jegliche spekulativen Hypothesen von psychischer<br />
Krankheit als Störung des Trieb- und Affektlebens ab. Ebenso verzichtet sie auf die<br />
psychodynamischen Modelle der Verdrängung, Regression und des Unbewussten.<br />
„Wo von Dasein gesprochen wird, hat der Begriff des Unbewussten keinen Platz<br />
mehr.“ (Kohli-Kunz, 1975, zitiert nach Condrau, 2003, S.152). Aus<br />
daseinsanalytischer Sicht haben psychische Symptome einen Sinn und führen die<br />
Betroffenen bei der therapeutischen Klärung zu sich selbst und zum Grund ihres<br />
Leidens. Holzhey-Kunz (2008), die sich der Psychoanalyse wieder annähert,<br />
verbindet Freuds These, dass psychopathologische Symptome einen unbewussten<br />
Sinn haben, mit existenzphilosophischen Erkenntnissen. Demnach kann psychisches<br />
Leiden nicht nur ein Leiden an unverarbeiteten Erfahrungen aus der Kindheit<br />
bedeuten, sondern auch ein Leiden am eigenen Sein. Seelisches Leiden wird nach<br />
daseinsanalytisch-hermeneutischer Auslegung als ein agierender Umgang mit dem<br />
eigenen Sein aufgefasst, es kann aber auch Ausdruck struktureller Störungen sein.<br />
Prinzipiell ist unter seelischem Leid eine Form von unfreiem Existieren hinsichtlich<br />
der jeweiligen Um- und Mitwelt zu verstehen.<br />
38