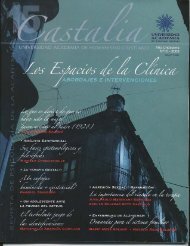PDF-Vollversion
PDF-Vollversion
PDF-Vollversion
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
für die therapeutische Arbeit und die vertrauensvolle Atmosphäre und die Beziehung<br />
zwischen Therapeutin und Klientin.<br />
Aus der personenzentrierten Psychotherapie entwickelten sich weiterführende<br />
Ansätze, die einerseits auf begegnungsorientierten bzw. dialogischen Sichtweisen,<br />
aber auch auf konstruktivistischen und kommunikationstheoretischen Perspektiven<br />
sowie auf lern- und kognitionspsychologischen Ausrichtungen beruhen (Schmid,<br />
2009). Ebenfalls gibt es eine klinisch-prozessorientierte und differenzielle<br />
Schwerpunktsetzung in Bezug auf die Auseinandersetzung mit störungsspezifischen<br />
Vorgehensweisen. Die Focusing-Therapie, welche sich von Rogers Ansätzen<br />
entfernt hat, kann beispielsweise als verwandte Therapierichtung gezählt werden.<br />
Mittlerweile findet man das personenzentrierte Konzept auch außerhalb der<br />
Psychotherapie, wie in der Beratung, Supervision, Coaching, Sozialarbeit, Seelsorge,<br />
Organisationspsychologie oder in der Arbeitswelt.<br />
Widerstandskonzept der personenzentrierten Psychotherapie<br />
Im Gegensatz zu den tiefenpsychologischen Konzeptionen, findet in der<br />
personenzentrierten Psychotherapie der Begriff Widerstand relativ wenig Beachtung<br />
und wird in der einschlägigen Literatur eher selten erwähnt. Einige<br />
personenzentrierte Autoren bemängeln mittlerweile das Fehlen eines differenzierten<br />
Widerstandskonzepts in ihrer psychotherapeutischen Ausrichtung und messen<br />
Widerständen gegenwärtig mehr Bedeutung bei (Fischer, 2001). Widerstand tritt in<br />
der personenzentrierten Therapie nicht in gleicher Weise in Erscheinung, wie in der<br />
Psychoanalyse, da es bei diesem Ansatz nicht um eine detektivische Haltung geht,<br />
den anderen zu überführen. Der Schwerpunkt des Therapieprozesses liegt vielmehr<br />
in einem Vertrauensverhältnis als entscheidenden Wirkfaktor.<br />
Rogers (1942, zitiert nach Pfeiffer, 1981) setzt sich lediglich in seinen frühen<br />
Schriften mit den Widerstandsphänomen auseinander und bestätigt den Widerstand<br />
als einen Teil der Psychotherapie. Jedoch bezieht er sich hierbei nicht auf den<br />
Terminus Widerstand aus der Psychoanalyse. Er vertritt den Standpunkt, dass<br />
Widerstand „...weder ein unvermeidlicher noch ein wünschenswerter Teil der<br />
Psychotherapie ist; vielmehr ergibt er sich in erster Linie aus einer mangelhaften<br />
Technik, mit den Problem- und Gefühlsäußerungen der Klienten umzugehen.“<br />
46