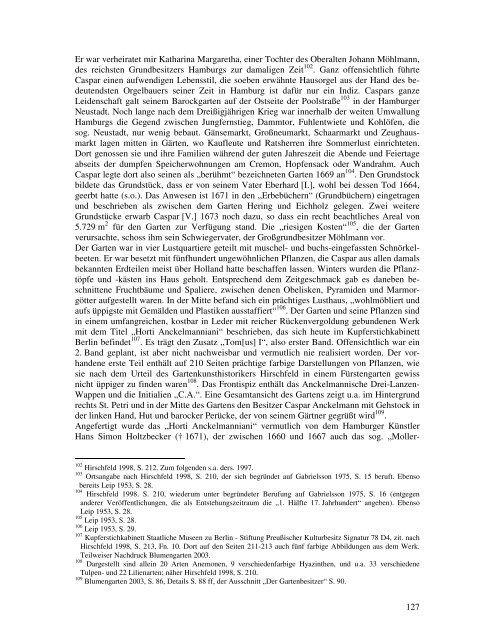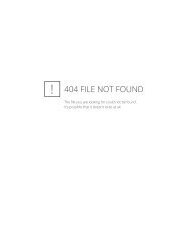Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Er war verheiratet mir Katharina Margaretha, einer Tochter des Oberalten Johann Möhlmann,<br />
des reichsten Grundbesitzers Hamburgs zur damaligen Zeit 102 . Ganz offensichtlich führte<br />
Caspar einen aufwendigen Lebensstil, die soeben erwähnte Hausorgel aus der Hand des bedeutendsten<br />
Orgelbauers seiner Zeit in Hamburg ist dafür nur ein Indiz. Caspars ganze<br />
Leidenschaft galt seinem Barockgarten auf der Ostseite der Poolstraße 103 in der Hamburger<br />
Neustadt. Noch lange nach dem Dreißigjährigen Krieg war innerhalb der weiten Umwallung<br />
Hamburgs die Gegend zwischen Jungfernstieg, Dammtor, Fuhlentwiete und Kohlöfen, die<br />
sog. Neustadt, nur wenig bebaut. Gänsemarkt, Großneumarkt, Schaarmarkt und Zeughausmarkt<br />
lagen mitten in Gärten, wo Kaufleute und Ratsherren ihre Sommerlust einrichteten.<br />
Dort genossen sie und ihre Familien während der guten Jahreszeit die Abende und Feiertage<br />
abseits der dumpfen Speicherwohnungen am Cremon, Hopfensack oder Wandrahm. Auch<br />
Caspar legte dort also seinen als „berühmt“ bezeichneten Garten 1669 an 104 . Den Grundstock<br />
bildete das Grundstück, dass er <strong>von</strong> seinem Vater Eberhard [I.], wohl bei dessen Tod 1664,<br />
geerbt hatte (s.o.). Das Anwesen ist 1671 in den „Erbebüchern“ (Grundbüchern) eingetragen<br />
und beschrieben als zwischen dem Garten Hering und Eichholz gelegen. Zwei weitere<br />
Grundstücke erwarb Caspar [V.] 1673 noch dazu, so dass ein recht beachtliches Areal <strong>von</strong><br />
5.729 m 2 für den Garten zur Verfügung stand. Die „riesigen Kosten“ 105 , die der Garten<br />
verursachte, schoss ihm sein Schwiegervater, der Großgrundbesitzer Möhlmann vor.<br />
Der Garten war in vier Lustquartiere geteilt mit muschel- und buchs-eingefassten Schnörkelbeeten.<br />
Er war besetzt mit fünfhundert ungewöhnlichen Pflanzen, die Caspar aus allen damals<br />
bekannten Erdteilen meist über Holland hatte beschaffen lassen. Winters wurden die Pflanztöpfe<br />
und -kästen ins Haus geholt. Entsprechend dem Zeitgeschmack gab es daneben beschnittene<br />
Fruchtbäume und Spaliere, zwischen denen Obelisken, Pyramiden und Marmorgötter<br />
aufgestellt waren. In der Mitte befand sich ein prächtiges Lusthaus, „wohlmöbliert und<br />
aufs üppigste mit Gemälden und Plastiken ausstaffiert“ 106 . Der Garten und seine Pflanzen sind<br />
in einem umfangreichen, kostbar in Leder mit reicher Rückenvergoldung gebundenen Werk<br />
mit dem Titel „Horti Anckelmanniani“ beschrieben, das sich heute im Kupferstichkabinett<br />
Berlin befindet 107 . Es trägt den Zusatz „Tom[us] I“, also erster Band. Offensichtlich war ein<br />
2. Band geplant, ist aber nicht nachweisbar und vermutlich nie realisiert worden. Der vorhandene<br />
erste Teil enthält auf 210 Seiten prächtige farbige Darstellungen <strong>von</strong> Pflanzen, wie<br />
sie nach dem Urteil des Gartenkunsthistorikers Hirschfeld in einem Fürstengarten gewiss<br />
nicht üppiger zu finden waren 108 . Das Frontispiz enthält das Anckelmannische Drei-Lanzen-<br />
Wappen und die Initialien „C.A.“. Eine Gesamtansicht des Gartens zeigt u.a. im Hintergrund<br />
rechts St. Petri und in der Mitte des Gartens den Besitzer Caspar Anckelmann mit Gehstock in<br />
der linken Hand, Hut und barocker Perücke, der <strong>von</strong> seinem Gärtner gegrüßt wird 109 .<br />
Angefertigt wurde das „Horti Anckelmanniani“ vermutlich <strong>von</strong> dem Hamburger Künstler<br />
Hans Simon Holtzbecker († 1671), der zwischen 1660 und 1667 auch das sog. „Moller-<br />
102 Hirschfeld 1998, S. 212. Zum folgenden s.a. ders. 1997.<br />
103 Ortsangabe nach Hirschfeld 1998, S. 210, der sich begründet auf Gabrielsson 1975, S. 15 beruft. Ebenso<br />
bereits Leip 1953, S. 28.<br />
104 Hirschfeld 1998. S. 210, wiederum unter begründeter Berufung auf Gabrielsson 1975, S. 16 (entgegen<br />
anderer Veröffentlichungen, die als Entstehungszeitraum die „1. Hälfte 17. Jahrhundert“ angeben). Ebenso<br />
Leip 1953, S. 28.<br />
105 Leip 1953, S. 28.<br />
106 Leip 1953, S. 29.<br />
107 Kupferstichkabinett Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz Signatur 78 D4, zit. nach<br />
Hirschfeld 1998, S. 213, Fn. 10. Dort auf den Seiten 211-213 auch fünf farbige Abbildungen aus dem Werk.<br />
Teilweiser Nachdruck Blumengarten 2003.<br />
108 Dargestellt sind allein 20 Arten Anemonen, 9 verschiedenfarbige Hyazinthen, und u.a. 33 verschiedene<br />
Tulpen- und 22 Lilienarten; näher Hirschfeld 1998, S. 210.<br />
109 Blumengarten 2003, S. 86, Details S. 88 ff, der Ausschnitt „Der Gartenbesitzer“ S. 90.<br />
127