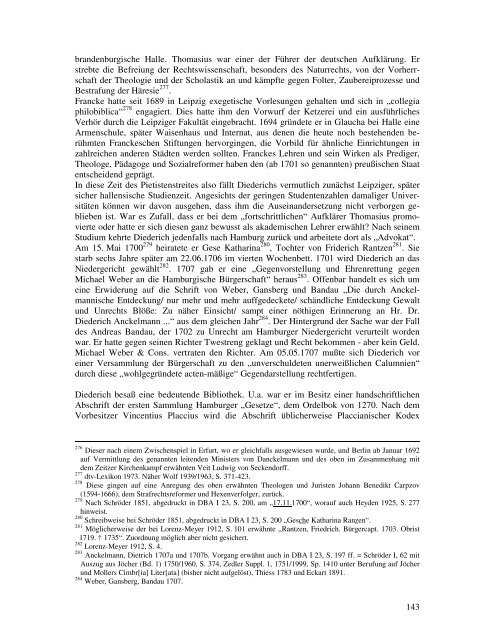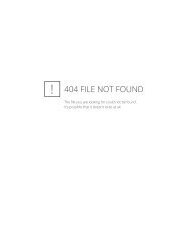Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
andenburgische Halle. Thomasius war einer der Führer der deutschen Aufklärung. Er<br />
strebte die Befreiung der Rechtswissenschaft, besonders des Naturrechts, <strong>von</strong> der Vorherrschaft<br />
der Theologie und der Scholastik an und kämpfte gegen Folter, Zaubereiprozesse und<br />
Bestrafung der Häresie 277 .<br />
Francke hatte seit 1689 in Leipzig exegetische Vorlesungen gehalten und sich in „collegia<br />
philobiblica“ 278 engagiert. Dies hatte ihm den Vorwurf der Ketzerei und ein ausführliches<br />
Verhör durch die Leipziger Fakultät eingebracht. 1694 gründete er in Glaucha bei Halle eine<br />
Armenschule, später Waisenhaus und Internat, aus denen die heute noch bestehenden berühmten<br />
Franckeschen Stiftungen hervorgingen, die Vorbild für ähnliche Einrichtungen in<br />
zahlreichen anderen Städten werden sollten. Franckes Lehren und sein Wirken als Prediger,<br />
Theologe, Pädagoge und Sozialreformer haben den (ab 1701 so genannten) preußischen Staat<br />
entscheidend geprägt.<br />
In diese Zeit des Pietistenstreites also fällt Diederichs vermutlich zunächst Leipziger, später<br />
sicher hallensische Studienzeit. Angesichts der geringen Studentenzahlen damaliger Universitäten<br />
können wir da<strong>von</strong> ausgehen, dass ihm die Auseinandersetzung nicht verborgen geblieben<br />
ist. War es Zufall, dass er bei dem „fortschrittlichen“ Aufklärer Thomasius promovierte<br />
oder hatte er sich diesen ganz bewusst als akademischen Lehrer erwählt? Nach seinem<br />
Studium kehrte Diederich jedenfalls nach Hamburg zurück und arbeitete dort als „Advokat“.<br />
Am 15. Mai 1700 279 heiratete er Gese Katharina 280 , Tochter <strong>von</strong> Friderich Rantzen 281 . Sie<br />
starb sechs Jahre später am 22.06.1706 im vierten Wochenbett. 1701 wird Diederich an das<br />
Niedergericht gewählt 282 . 1707 gab er eine „Gegenvorstellung und Ehrenrettung gegen<br />
Michael Weber an die Hamburgische Bürgerschaft“ heraus 283 . Offenbar handelt es sich um<br />
eine Erwiderung auf die Schrift <strong>von</strong> Weber, Gansberg und Bandau „Die durch Anckelmannische<br />
Entdeckung/ nur mehr und mehr auffgedeckete/ schändliche Entdeckung Gewalt<br />
und Unrechts Blöße: Zu näher Einsicht/ sampt einer nöthigen Erinnerung an Hr. Dr.<br />
Diederich Anckelmann ...“ aus dem gleichen Jahr 284 . Der Hintergrund der Sache war der Fall<br />
des Andreas Bandau, der 1702 zu Unrecht am Hamburger Niedergericht verurteilt worden<br />
war. Er hatte gegen seinen Richter Twestreng geklagt und Recht bekommen - aber kein Geld.<br />
Michael Weber & Cons. vertraten den Richter. Am 05.05.1707 mußte sich Diederich vor<br />
einer Versammlung der Bürgerschaft zu den „unverschuldeten unerweißlichen Calumnien“<br />
durch diese „wohlgegründete acten-mäßige“ Gegendarstellung rechtfertigen.<br />
Diederich besaß eine bedeutende Bibliothek. U.a. war er im Besitz einer handschriftlichen<br />
Abschrift der ersten Sammlung Hamburger „Gesetze“, dem Ordelbok <strong>von</strong> 1270. Nach dem<br />
Vorbesitzer Vincentius Placcius wird die Abschrift üblicherweise Placcianischer Kodex<br />
276<br />
Dieser nach einem Zwischenspiel in Erfurt, wo er gleichfalls ausgewiesen wurde, und Berlin ab Januar 1692<br />
auf Vermittlung des genannten leitenden Ministers <strong>von</strong> Danckelmann und des oben im Zusammenhang mit<br />
dem Zeitzer Kirchenkampf erwähnten Veit Ludwig <strong>von</strong> Seckendorff.<br />
277<br />
dtv-Lexikon 1973. Näher Wolf 1939/1963, S. 371-423.<br />
278<br />
Diese gingen auf eine Anregung des oben erwähnten Theologen und Juristen Johann Benedikt Carpzov<br />
(1594-1666), dem Strafrechtsreformer und Hexenverfolger, zurück.<br />
279<br />
Nach Schröder 1851, abgedruckt in DBA I 23, S. 200, am „17.11.1700“, worauf auch Heyden 1925, S. 277<br />
hinweist.<br />
280<br />
Schreibweise bei Schröder 1851, abgedruckt in DBA I 23, S. 200 „Gesche Katharina Ranzen“.<br />
281<br />
Möglicherweise der bei Lorenz-Meyer 1912, S. 101 erwähnte „Rantzen, Friedrich. Bürgercapt. 1703. Obrist<br />
1719. † 1735“. Zuordnung möglich aber nicht gesichert.<br />
282<br />
Lorenz-Meyer 1912, S. 4.<br />
283<br />
Anckelmann, Dietrich 1707a und 1707b. Vorgang erwähnt auch in DBA I 23, S. 197 ff. = Schröder I, 62 mit<br />
Auszug aus Jöcher (Bd. 1) 1750/1960, S. 374, Zedler Suppl. 1, 1751/1999, Sp. 1410 unter Berufung auf Jöcher<br />
und Mollers Cimbr[ia] Liter[ata] (bisher nicht aufgelöst), Thiess 1783 und Eckart 1891.<br />
284<br />
Weber, Gansberg, Bandau 1707.<br />
143