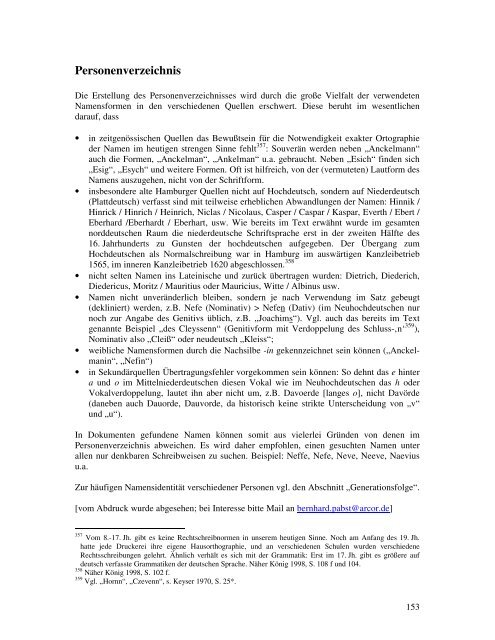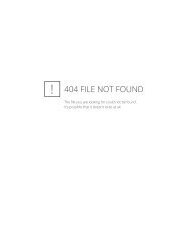Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Familienforschung Pabst - Familienforschung von Bernhard Pabst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Personenverzeichnis<br />
Die Erstellung des Personenverzeichnisses wird durch die große Vielfalt der verwendeten<br />
Namensformen in den verschiedenen Quellen erschwert. Diese beruht im wesentlichen<br />
darauf, dass<br />
• in zeitgenössischen Quellen das Bewußtsein für die Notwendigkeit exakter Ortographie<br />
der Namen im heutigen strengen Sinne fehlt 357 : Souverän werden neben „Anckelmann“<br />
auch die Formen, „Anckelman“, „Ankelman“ u.a. gebraucht. Neben „Esich“ finden sich<br />
„Esig“, „Esych“ und weitere Formen. Oft ist hilfreich, <strong>von</strong> der (vermuteten) Lautform des<br />
Namens auszugehen, nicht <strong>von</strong> der Schriftform.<br />
• insbesondere alte Hamburger Quellen nicht auf Hochdeutsch, sondern auf Niederdeutsch<br />
(Plattdeutsch) verfasst sind mit teilweise erheblichen Abwandlungen der Namen: Hinnik /<br />
Hinrick / Hinrich / Heinrich, Niclas / Nicolaus, Casper / Caspar / Kaspar, Everth / Ebert /<br />
Eberhard /Eberhardt / Eberhart, usw. Wie bereits im Text erwähnt wurde im gesamten<br />
norddeutschen Raum die niederdeutsche Schriftsprache erst in der zweiten Hälfte des<br />
16. Jahrhunderts zu Gunsten der hochdeutschen aufgegeben. Der Übergang zum<br />
Hochdeutschen als Normalschreibung war in Hamburg im auswärtigen Kanzleibetrieb<br />
1565, im inneren Kanzleibetrieb 1620 abgeschlossen. 358<br />
• nicht selten Namen ins Lateinische und zurück übertragen wurden: Dietrich, Diederich,<br />
Diedericus, Moritz / Mauritius oder Mauricius, Witte / Albinus usw.<br />
• Namen nicht unveränderlich bleiben, sondern je nach Verwendung im Satz gebeugt<br />
(dekliniert) werden, z.B. Nefe (Nominativ) > Nefen (Dativ) (im Neuhochdeutschen nur<br />
noch zur Angabe des Genitivs üblich, z.B. „Joachims“). Vgl. auch das bereits im Text<br />
genannte Beispiel „des Cleyssenn“ (Genitivform mit Verdoppelung des Schluss-‚n‘ 359 ),<br />
Nominativ also „Cleiß“ oder neudeutsch „Kleiss“;<br />
• weibliche Namensformen durch die Nachsilbe -in gekennzeichnet sein können („Anckelmanin“,<br />
„Nefin“)<br />
• in Sekundärquellen Übertragungsfehler vorgekommen sein können: So dehnt das e hinter<br />
a und o im Mittelniederdeutschen diesen Vokal wie im Neuhochdeutschen das h oder<br />
Vokalverdoppelung, lautet ihn aber nicht um, z.B. Davoerde [langes o], nicht Davörde<br />
(daneben auch Dauorde, Dauvorde, da historisch keine strikte Unterscheidung <strong>von</strong> „v“<br />
und „u“).<br />
In Dokumenten gefundene Namen können somit aus vielerlei Gründen <strong>von</strong> denen im<br />
Personenverzeichnis abweichen. Es wird daher empfohlen, einen gesuchten Namen unter<br />
allen nur denkbaren Schreibweisen zu suchen. Beispiel: Neffe, Nefe, Neve, Neeve, Naevius<br />
u.a.<br />
Zur häufigen Namensidentität verschiedener Personen vgl. den Abschnitt „Generationsfolge“.<br />
[vom Abdruck wurde abgesehen; bei Interesse bitte Mail an bernhard.pabst@arcor.de]<br />
357 Vom 8.-17. Jh. gibt es keine Rechtschreibnormen in unserem heutigen Sinne. Noch am Anfang des 19. Jh.<br />
hatte jede Druckerei ihre eigene Hausorthographie, und an verschiedenen Schulen wurden verschiedene<br />
Rechtsschreibungen gelehrt. Ähnlich verhält es sich mit der Grammatik: Erst im 17. Jh. gibt es größere auf<br />
deutsch verfasste Grammatiken der deutschen Sprache. Näher König 1998, S. 108 f und 104.<br />
358 Näher König 1998, S. 102 f.<br />
359 Vgl. „Hornn“, „Czevenn“, s. Keyser 1970, S. 25*.<br />
153