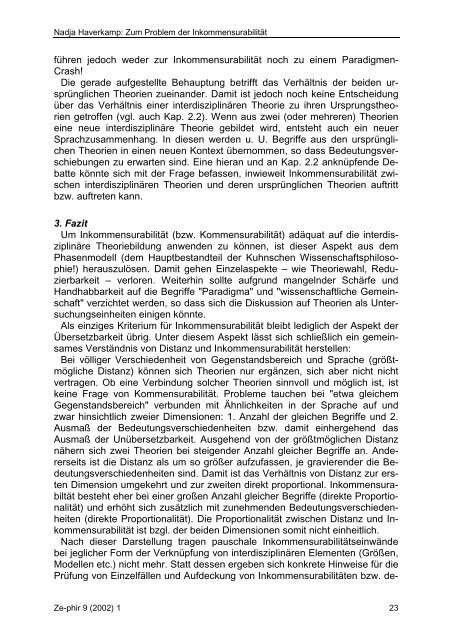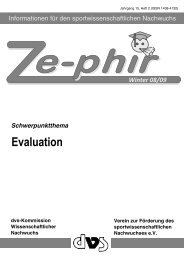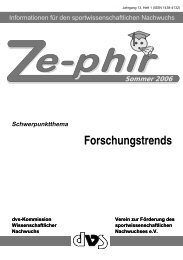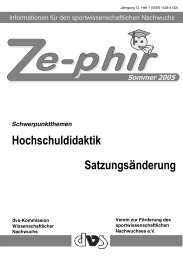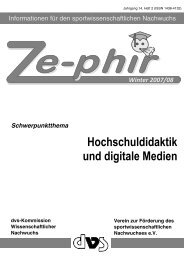Download (PDF) - Sportwissenschaftlicher Nachwuchs
Download (PDF) - Sportwissenschaftlicher Nachwuchs
Download (PDF) - Sportwissenschaftlicher Nachwuchs
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nadja Haverkamp: Zum Problem der Inkommensurabilität<br />
führen jedoch weder zur Inkommensurabilität noch zu einem Paradigmen-<br />
Crash!<br />
Die gerade aufgestellte Behauptung betrifft das Verhältnis der beiden ursprünglichen<br />
Theorien zueinander. Damit ist jedoch noch keine Entscheidung<br />
über das Verhältnis einer interdisziplinären Theorie zu ihren Ursprungstheorien<br />
getroffen (vgl. auch Kap. 2.2). Wenn aus zwei (oder mehreren) Theorien<br />
eine neue interdisziplinäre Theorie gebildet wird, entsteht auch ein neuer<br />
Sprachzusammenhang. In diesen werden u. U. Begriffe aus den ursprünglichen<br />
Theorien in einen neuen Kontext übernommen, so dass Bedeutungsverschiebungen<br />
zu erwarten sind. Eine hieran und an Kap. 2.2 anknüpfende Debatte<br />
könnte sich mit der Frage befassen, inwieweit Inkommensurabilität zwischen<br />
interdisziplinären Theorien und deren ursprünglichen Theorien auftritt<br />
bzw. auftreten kann.<br />
3. Fazit<br />
Um Inkommensurabilität (bzw. Kommensurabilität) adäquat auf die interdisziplinäre<br />
Theoriebildung anwenden zu können, ist dieser Aspekt aus dem<br />
Phasenmodell (dem Hauptbestandteil der Kuhnschen Wissenschaftsphilosophie!)<br />
herauszulösen. Damit gehen Einzelaspekte – wie Theoriewahl, Reduzierbarkeit<br />
– verloren. Weiterhin sollte aufgrund mangelnder Schärfe und<br />
Handhabbarkeit auf die Begriffe "Paradigma" und "wissenschaftliche Gemeinschaft"<br />
verzichtet werden, so dass sich die Diskussion auf Theorien als Untersuchungseinheiten<br />
einigen könnte.<br />
Als einziges Kriterium für Inkommensurabilität bleibt lediglich der Aspekt der<br />
Übersetzbarkeit übrig. Unter diesem Aspekt lässt sich schließlich ein gemeinsames<br />
Verständnis von Distanz und Inkommensurabilität herstellen:<br />
Bei völliger Verschiedenheit von Gegenstandsbereich und Sprache (größtmögliche<br />
Distanz) können sich Theorien nur ergänzen, sich aber nicht nicht<br />
vertragen. Ob eine Verbindung solcher Theorien sinnvoll und möglich ist, ist<br />
keine Frage von Kommensurabilität. Probleme tauchen bei "etwa gleichem<br />
Gegenstandsbereich" verbunden mit Ähnlichkeiten in der Sprache auf und<br />
zwar hinsichtlich zweier Dimensionen: 1. Anzahl der gleichen Begriffe und 2.<br />
Ausmaß der Bedeutungsverschiedenheiten bzw. damit einhergehend das<br />
Ausmaß der Unübersetzbarkeit. Ausgehend von der größtmöglichen Distanz<br />
nähern sich zwei Theorien bei steigender Anzahl gleicher Begriffe an. Andererseits<br />
ist die Distanz als um so größer aufzufassen, je gravierender die Bedeutungsverschiedenheiten<br />
sind. Damit ist das Verhältnis von Distanz zur ersten<br />
Dimension umgekehrt und zur zweiten direkt proportional. Inkommensurabiltät<br />
besteht eher bei einer großen Anzahl gleicher Begriffe (direkte Proportionalität)<br />
und erhöht sich zusätzlich mit zunehmenden Bedeutungsverschiedenheiten<br />
(direkte Proportionalität). Die Proportionalität zwischen Distanz und Inkommensurabilität<br />
ist bzgl. der beiden Dimensionen somit nicht einheitlich.<br />
Nach dieser Darstellung tragen pauschale Inkommensurabilitätseinwände<br />
bei jeglicher Form der Verknüpfung von interdisziplinären Elementen (Größen,<br />
Modellen etc.) nicht mehr. Statt dessen ergeben sich konkrete Hinweise für die<br />
Prüfung von Einzelfällen und Aufdeckung von Inkommensurabilitäten bzw. de-<br />
Ze-phir 9 (2002) 1 23