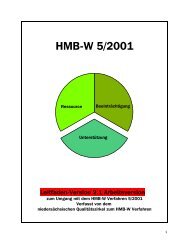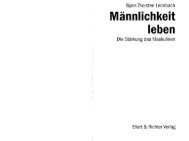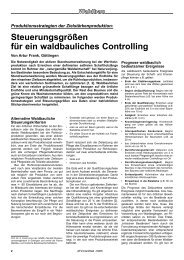3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
otschaft: Niemand will dir deine Körperlichkeit nehmen, es<br />
gibt aber auch andere, die wollen etwas von dir, auch wenn sie<br />
nicht so stark sind <strong>und</strong> fühlen sich wohler, wenn du dich zurücknimmst.<br />
Auch dann erhältst du Anerkennung! Drohgebärden<br />
sind aber oft Teil der Sprache der Jugendlichen, ein Umwegverhalten,<br />
mit dem sie erst ihren Raum abstecken (dabei<br />
oft hilflos sind) <strong>und</strong> dann etwas damit mitteilen. Die Mitarbeiter<br />
fühlen sich in dem Maße nicht bedroht, in dem sie merken,<br />
dass die Jugendlichen die Beziehung zu ihnen brauchen. Dominante<br />
Körperlichkeit wird ja vor allem auch dann demonstriert,<br />
wenn die Jugendlichen periodisch zeigen wollen, dass sie<br />
noch da sind <strong>und</strong> dass sie beachtet werden wollen.<br />
Jugendliche hängen Idolen nach. Sie gehören zur Szenerie der<br />
Unwirklichkeit (das Unwirkliche wirklich machen) der Pubertät.<br />
Idole kann man den Jugendlichen pädagogisch nicht nehmen,<br />
wenn man es versucht, ist die Wirkung eher kontraproduktiv.<br />
Idole symbolisieren Wünsche, Träume <strong>und</strong> Sehnsüchte<br />
der Jugendlichen im pubertären Spannungsfeld. Die Erreichbarkeit<br />
dieser Träume spielt in der Unwirklichkeit der Pubertät<br />
keine Rolle. Deswegen sind sie auch gegen pädagogische Beeinflussungen<br />
weitgehend immun. Sozialarbeiter sind keine<br />
Idole, sie können aber Vorbilder sein. Diese Vorbildwirkung<br />
entwickelt sich nach Erfahrung der Wiener Jungenarbeiter<br />
weniger in der normativen Vorbildwirkung - also vor allem<br />
moralisch-ethisch -, sondern eher funktionell. Es beeindruckt<br />
die Jungen, dass es „ihr" Jugendarbeiter geschafft hat mit dem,<br />
was er mit ihnen macht, einen Job zu kriegen, der den Jugendlichen<br />
auch noch zugute kommt. Man kann von ihm profitieren<br />
<strong>und</strong> mit der Zeit spielt sich auch das Gefühl ein, dass er<br />
wichtig für einen ist. Dann kann auch sein Verhalten für einen<br />
selbst attraktiv werden, wird man neugierig wie er sich als<br />
Mann, der sich von den gängigen Männerbildern der Väter,<br />
Lehrer, älterer Fre<strong>und</strong>e u.a. unterscheidet, verhält. Zu Idolen<br />
werden meist Schauspieler, Popstars, Fußballer. Bei Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergr<strong>und</strong> - auch bei denen, die hier geboren<br />
sind - sind die Idole sehr stark an die Heimatländer geb<strong>und</strong>en.<br />
Es sind die Idole der „interkulturellen Zwischenwelten"<br />
(Gemende 2003), die man als eigene` in dem Land<br />
braucht, in dem man zwar geboren ist, in dem man aber immer<br />
wieder fühlt, dass man nicht so richtig zum Zuge kommt.<br />
120<br />
as Homosexualitätstabu sitzt heute - trotz aller Liberalisierung<br />
- noch tief. Gerade in der inneren Auseinandersetzung<br />
<strong>des</strong> Jungen mit sich selbst <strong>und</strong> seinem Mannwerden, aber genauso<br />
im Kontrollhandeln der Eltern sowie im Integrations<br />
druck der sozialen Umwelt entfaltet es seine blockierenden<br />
psychosozialen Wirkungen. In ihm ist die Verkettung der sexuellen<br />
Natur <strong>des</strong> Menschen mit sozialen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Bezügen konfliktreich ausgeprägt. Dass dieses Tabu vor<br />
allem Jungen <strong>und</strong> junge Männer trifft, bei Mädchen eher übergangen<br />
wird, verweist auf die besondere Verfügbarkeit <strong>des</strong><br />
Mannes im industriekapitalistischen Verwertungsprozess.<br />
Nicht von ungefähr wurde das Homosexualitätstabu zu Beginn<br />
der industriellen Modernisierung <strong>und</strong> heterosexuellen<br />
Matrix der Arbeitsteilung virulent: „Die gleichgeschlechtliche<br />
Sexualpraxis wurde erst, als sie nicht mehr in eine zugespitzte<br />
Geschlechterdichotomie passte <strong>und</strong> sie zu sprengen drohte,<br />
massiv verrätselt. Die Konstruktion der Homosexualität bestand<br />
vor allem in der Etablierung eines Erklärungsbedarfs"<br />
(Hirschauer 1992, S. 338).<br />
Diese Spannung zur Heterosexualität ist bis heute das Gr<strong>und</strong>problem<br />
der Anerkennung der Homosexualität, aber auch der<br />
homosexuellen Lebensführung <strong>und</strong> Lebensbewältigung selbst,<br />
die darin befangen ist. Erst in der gegenwärtigen „modernwestlichen<br />
Homosexualität" beginnt sich dieser Konflikt zumin<strong>des</strong>t<br />
im subjektiven Sexualempfinden schwuler Männer<br />
aufzulösen. Die Menschen beziehen sich nun „in der vollen<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Geschlechts aufeinander. Der Schwule begehrt<br />
in dem anderen den Mann, die Lesbe in der anderen die Frau -<br />
<strong>und</strong> keine Zwischenstufe' [...] Als Mann deal Mann [...] in sexuelle<br />
Interaktion zu verstricken - erst das macht die schwule<br />
[...] Situation aus" (Lautmann 2002, S. 396).<br />
Auch die Psychoanalyse, die sich seit Freud um die Bestimmung<br />
der Homosexualität primär aus den frühkindlichen Objektbeziehungen<br />
heraus bemüht hat <strong>und</strong> damit genauso heterosexuell<br />
befangen blieb, schwenkt heute in ein multifaktorielles<br />
Erklärungsmodell ein, in dem anlagebedingte Faktoren, psychosexuelle<br />
Entwicklungsmuster <strong>und</strong> familiale <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Reaktionen aufeinander bezogen werden. Dabei