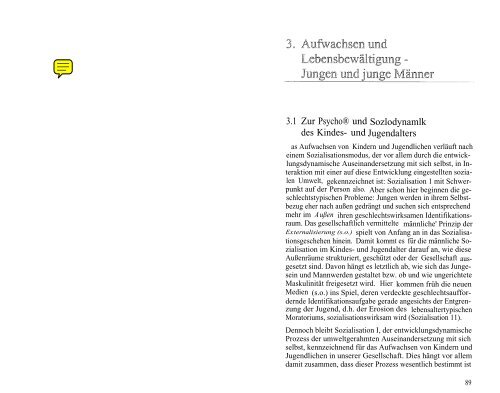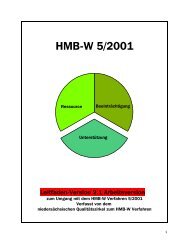3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>3.1</strong> <strong>Zur</strong> <strong>Psycho®</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozlodynamlk</strong><br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Jugendalters<br />
as Aufwachsen von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen verläuft nach<br />
einem Sozialisationsmodus, der vor allem durch die entwicklungsdynamische<br />
Auseinandersetzung mit sich selbst, in Interaktion<br />
mit einer auf diese Entwicklung eingestellten sozialen<br />
Umwelt, gekennzeichnet ist: Sozialisation 1 mit Schwerpunkt<br />
auf der Person also. Aber schon hier beginnen die geschlechtstypischen<br />
Probleme: Jungen werden in ihrem Selbstbezug<br />
eher nach außen gedrängt <strong>und</strong> suchen sich entsprechend<br />
mehr im Außen ihren geschlechtswirksamen Identifikationsraum.<br />
Das gesellschaftlich vermittelte männliche' Prinzip der<br />
Externalisierung (s.o.) spielt von Anfang an in das Sozialisationsgeschehen<br />
hinein. Damit kommt es für die männliche Sozialisation<br />
im Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Jugendalter darauf an, wie diese<br />
Außenräume strukturiert, geschützt oder der Gesellschaft ausgesetzt<br />
sind. Davon hängt es letztlich ab, wie sich das Jungesein<br />
<strong>und</strong> Mannwerden gestaltet bzw. ob <strong>und</strong> wie ungerichtete<br />
Maskulinität freigesetzt wird. Hier kommen früh die neuen<br />
Medien (s.o.) ins Spiel, deren verdeckte geschlechtsauffordernde<br />
Identifikationsaufgabe gerade angesichts der Entgrenzung<br />
der Jugend, d.h. der Erosion <strong>des</strong> lebensaltertypischen<br />
Moratoriums, sozialisationswirksam wird (Sozialisation 11).<br />
Dennoch bleibt Sozialisation I, der entwicklungsdynamische<br />
Prozess der umweltgerahmten Auseinandersetzung mit sich<br />
selbst, kennzeichnend für das Aufwachsen von Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Dies hängt vor allem<br />
damit zusammen, dass dieser Prozess wesentlich bestimmt ist<br />
89
durch das physische <strong>und</strong> psychische Entwicklungs- <strong>und</strong> Reifungsgeschehen,<br />
das in der Interaktion mit der sozialen Umwelt<br />
sein eigentümliches Magnetfeld ausbildet. Deshalb will<br />
ich in einem ersten allgemeinen Schritt eine thematisch entsprechende<br />
Gr<strong>und</strong>schicht' anlegen, auf der dann das Argumentationsgebäude<br />
männlicher Sozialisation im Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendalter errichtet werden kann.<br />
Kinder müssen von Geburt an anerkannt bekommen, dass sie<br />
aus sich selbst heraus etwas sind, sie müssen fühlen können,<br />
dass das was aus ihnen kommt, nicht von vornherein abgewertet<br />
wird, sie brauchen die Erfahrung, dass ihre Gefühle aufgenommen<br />
werden <strong>und</strong> außen etwas bewirken, indem auf sie<br />
eingegangen wird, wie sie sind. Das meint Donald Winnicotts<br />
egriff von der „fördernden Umwelt" (1984). Rigide soziale<br />
Anpassung <strong>und</strong> Abwertung der kindlichen Gefühle erzeugt<br />
innere Hilflosigkeit, die abgespalten, von der abstrahiert werden<br />
muss <strong>und</strong> die sich dann als Hass auf das Schwache in sich<br />
selbst <strong>und</strong> Hass auf alles Hilflose, Schwache, fremde in der<br />
Umwelt äußert (so das Modell nach Gruen). Winnicott sieht in<br />
ähnlicher Weise die frühe Spannung von Aggressivität <strong>und</strong><br />
Kreativität: Wenn das Kind spürt, dass es seine Umwelt mit<br />
erschaffen kann, indem diese es versteht <strong>und</strong> seine Impulse<br />
aufnimmt <strong>und</strong> ihm neu (nun in der Interaktion sozial eingeb<strong>und</strong>en)<br />
zurückgibt, dann entsteht eine kreative Gefühlsspannung,<br />
in der das Aggressive der selbstbezogenen, narzisstischen<br />
Äußerung aufgeht. Aggressivität muss ja immer als auf<br />
die Wahrung der psychophysischen Integrität <strong>des</strong> Selbst bezogene<br />
Aktivität verstanden werden. Dieses Behauptungsmotiv<br />
durchzieht die gesamte Sozialisation <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Jugendalters.<br />
Krappmann/®swald (1995) sehen z.B. das Verhalten<br />
von Schulkindern untereinander <strong>und</strong> den Kindergruppen durch<br />
dieses leibseelische Integritätsprinzip gesteuert <strong>und</strong> deuten die<br />
Aggression in Kindergruppen untereinander in diesem Sinne<br />
als Versuche der gegenseitigen Wahrung von räumlichen Integritätszonen.<br />
Solche selbstbezogene Aggressivität prägt<br />
auch das Bewältigungsverhalten in kritischen Lebenssituationen.<br />
So wird plausibel, wie eng das Problem der IIandlungsfcihigkeit<br />
in solchen Lebenssituationen rückgeb<strong>und</strong>en ist an<br />
die triebstrukturell gespeiste Aggressivität als Verteidigung<br />
<strong>des</strong> Selbst, <strong>und</strong> dass diese einem näher ist als die einzuhalten-<br />
9®<br />
de Norm. Vor allem Winnicott hat immer wieder darauf insistiert,<br />
dass Aggressivität erst einmal als triebgeb<strong>und</strong>ene Aktivität<br />
zu verstehen ist <strong>und</strong> dass es auf die Umwelt ankommt, wie<br />
sie diese Aggressivität zulässt <strong>und</strong> ob es ihr gelingt, mit zu<br />
helfen, Aggressivität in Kreativität umzuwandeln.<br />
Aggressive Aktivitäten (als sozial gerichtete Triebimpulse)<br />
entwickeln sich dann kreativ, wenn das Kind die soziale Umwelt,<br />
auf die sich seine Aktivität richtet als „unzerstörbar"<br />
(Winnicott) erfährt. Das heißt, seine (nach außen „zerstörerisehen")<br />
aggressiven Impulse werden für das Kind nicht gefährlich,<br />
schlagen nicht unvermittelt zurück, werden aufgenommen<br />
<strong>und</strong> in dieser nun an die Umwelt geb<strong>und</strong>ene Aufnahme<br />
zurückgegeben. Das Kind kann also mit seinen Aggressionen<br />
experimentieren, erfährt dabei Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Grenzen, entwickelt eine Gewissheit <strong>des</strong> Selbst, die nicht immer<br />
wieder neu aufgebaut werden muss, weil ja in ihm die Erfahrung<br />
<strong>des</strong> „begrenzten" Experimentierenkönnens gewachsen<br />
ist.<br />
Antisoziale Tendenzen dagegen treten dann ein, wenn das<br />
Kind seine Umwelt als zerstörbar erfährt, das heißt wenn seiner<br />
Aggression nichts entgegengesetzt wird, wenn die aggressiven<br />
Impulse für das Kind grenzenlos werden <strong>und</strong> irgendwann<br />
- aus einer nicht mehr überschaubaren Umwelt heraus<br />
auf ein nicht mehr beherrschbares Selbst - zurückschlagen.<br />
ies ist im Kinder-Familien-Bezug vor allem dann zu erwarten,<br />
wenn das Kind die bisher als unzerstörbar erlebte Umwelt<br />
verliert: Z.B. beim Auseinanderbrechen der Familie, bei extremer<br />
Entfremdung der Eltern, aber auch bei stetig zunehmender<br />
Inkonsistenz <strong>und</strong> Unüberschaubarkeit der Familienabläufe<br />
<strong>und</strong> der dadurch für das Kind entstehenden alltäglichen<br />
Überforderungskonstellationen. So büßt das Find eine familiale<br />
Umwelt ein, .,die dem Kind die Erforschung zerstörerischer<br />
Aktivitäten im Bezug auf Trieberfahrungen ermöglichte"<br />
(Winnicott, zit. nach Davis/Wallbridge 1983, S. 126).<br />
Das Gefühl <strong>des</strong> Verlustes einer unzerstörbaren Umwelt kann<br />
bei Kindern vor allem dann aufkommen, wenn Ängste <strong>und</strong><br />
Verwirrungen im Hinblick auf die Beziehungen zu Menschen,<br />
die einem nahe sind („Objektverluste") entstehen. Sie werden<br />
belastet, weil sie nun selbst die Kontrolle übernehmen sollen,<br />
9 1
die für sie vorher in der unzerstörbaren Umwelt gegeben war.<br />
In dieser diffusen Überforderung schlagen die Aggressivitätsantriebe<br />
auf das Kind zurück: Sowohl als Ängste angesichts<br />
<strong>des</strong> Kontrollverlustes als auch als Erfahrung der schutzlosen<br />
Preisgabe <strong>des</strong> Selbst, da die Aggression nicht mehr von sich<br />
aus bewältigbar erscheint.<br />
Selbstwert <strong>und</strong> Selbstbehauptung werden wieder zu fragilen<br />
ezügen, wenn das Kind aus der Familie <strong>und</strong> der familialen<br />
Nachwelt heraustritt <strong>und</strong> sich gleichermaßen seine „zweite"<br />
fördernde Umwelt machen muss. Gerade weil es als Kind im<br />
Alter von 10-14 Jahren schon früh beginnt sich von der Herkunftsfamilie<br />
abzulösen - gleichzeitig aber auf sie immer noch<br />
angewiesen bleibt -, gerät es in eine ambivalente Situation.<br />
Auch wenn in der Familie die Zuwendungsbalance klappt,<br />
muss das Kind auch „draußen" sozial-emotionale Anerkennung<br />
finden können. Gerade Jungen sind - spätestens im mittleren<br />
Kin<strong>des</strong>alter - zunehmend am außerfamilialen Nahraum<br />
orientiert. Finden sie dort keine das Selbst bestärkenden <strong>und</strong><br />
ermutigenden sozialen Bezüge, sind sie auf Wege angewiesen<br />
bzw. von solchen Wegen angezogen, die abseits der sozial legitimen<br />
<strong>und</strong> konformen Zugänge liegen, um Aufmerksamkeit<br />
<strong>und</strong> soziale Zuwendung zu erreichen. In der in diesem Alter<br />
bereits ausgeprägten Gleichaltrigenkultur finden sich solche<br />
sozial entmutigten Jungen dann oft in Cliquen, welche das<br />
psychosozial gesuchte abweichende Verhalten organisieren<br />
<strong>und</strong> ermutigend zurückspiegeln können. Dies alles wird dadurch<br />
verstärkt, dass es sich hier um ein frühpubertäres Alter<br />
handelt, in dem der fragile Übergangszustand der körperlichseelischen<br />
Entwicklung den Selbstbehauptungsdrang verstärkt<br />
<strong>und</strong> den biografisch bisher erworbenen Selbstwert schwächt.<br />
Der narzisstische Schub in der Pubertät in die Unwirklichkeit<br />
<strong>des</strong> Ichs verfängt sich so in einer bereits aufgebauten antisozialen<br />
Tendenz, wodurch das antisoziale <strong>und</strong> abweichende Verhalten<br />
für diese Kinder „unwirklich", d.h. den Realitätsprinzipien<br />
<strong>und</strong> Definitionen einer rationalen gesellschaftlichen<br />
Umwelt entzogen <strong>und</strong> daher wenig zugänglich ist.<br />
In der Jugendphase gerät der Selbstbehauptungstrieb - nach<br />
der Latenzzeit', in der sich die Intimsphäre ausbildet (vgl.<br />
Milhoffer 2000) - in der leibseelischen Eruption der Pubertät<br />
92<br />
aus der psychosozialen Balance <strong>und</strong> erfährt eine aggressive<br />
Freisetzung. Es spielen sich nun Dinge ab, die wir aus der<br />
Aggressionsthematik der frühen Kindheit kennen, die sich aber<br />
in der Adoleszenz nicht einfach wiederholen, sondern aus<br />
einem Selbst hervorbrechen, das inzwischen - über die Kindheit<br />
hinaus - sozial geworden ist, dieses Gewordensein aber<br />
nicht begreifen, für sich in Anspruch nehmen kann, weil es<br />
sich von seiner familialen Form lösen muss. Das Selbst ist nun<br />
gezwungen neu zu werden <strong>und</strong> - im Übergang von der emotionalen<br />
Geborgenheit der Familie zur rationalen Selbstständigkeitswelt<br />
der gesellschaftlichen Kultur, die sich nun in qualifikationsgerichteten<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Arbeitsstrukturen manifestiert<br />
(Erdheim 1988) -, aus sich selbst heraus eine Lebensperspektive<br />
zu finden. Diese Suche richtet sich - im Schwebe<strong>und</strong><br />
Isolationszustand <strong>des</strong> Ablösenmüssens von einer vorangegangenen<br />
Realität (familiales Selbst) <strong>und</strong> im Suchen nach<br />
einer noch nicht feststehenden oder gekannten Realität (gesellschaftlich<br />
gerichtetes Selbst) - an dem eigenen „unfertigen"<br />
Zustand als Jugendliche(r) <strong>und</strong> damit an einer psychischen<br />
<strong>und</strong> sozialen „Unwirklichkeit" (Winnicott) aus. Dieses<br />
Unwirkliche ist aber die Wirklichkeit <strong>des</strong> Selbst. Getragen<br />
von einem in der Pubertät freigesetzten Aggressions-<br />
(Selbstbehauptungs-)trieb entsteht so jugendlicher Protest mit<br />
potentiell antisozialer Tendenz. Der ungehemmte Narziss wird<br />
zum hauptsächlichen Orientierungssinn, das unwirkliche<br />
Selbst zum Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt einer Welt in die man nicht<br />
mehr <strong>und</strong> noch nicht gehört (Erdheim 1988). Das von Karl<br />
Mannheim (1965) aufgestellte Theorem, die moderne Jugend<br />
zeichne sich durch Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Alten<br />
<strong>und</strong> durch Bereitschaft für alles Neue aus (egal in welche<br />
ichtung es zeigt), hat hier seinen tiefenstrukturellen Gr<strong>und</strong>.<br />
iese Unwirklichkeit <strong>des</strong> Selbst strukturiert den inneren Protest,<br />
der nun aus der Familie heraustritt <strong>und</strong> sich - nicht mehr<br />
nur als Abwehr wie in der Kindheit - in die neue soziale<br />
Selbstständigkeit verlängert. Dem innerlich Unwirklichen entspricht<br />
äußerlich das von der gesellschaftlichen Wirklichkeit<br />
Abweichende, ihr Entgegengesetzte: „Weil alles in der<br />
Schwebe ist, fühlen sie sich unwirklich <strong>und</strong> tun <strong>des</strong>halb gewisse<br />
Dinge, die sie als wirklich empfinden <strong>und</strong> die nun allzu<br />
93
wirklich sind im Sinne, dass die Gesellschaft davon betroffen<br />
wird" (Winnicott, zit. nach Davis/Wallbridge 1983, S. 172).<br />
3.2 Dis Aufwachsen von Jungen e<br />
ein Strukturmodell<br />
Jungen müssen sich - anders als Mädchen - früh aus der symbiotischen<br />
Geborgenheit bei der Mutter lösen, um die Orientierung<br />
an einer männlichen Geschlechteridentität zu finden<br />
(vgl. Benjamin 1990) <strong>und</strong> werden dann auch in der Pubertät<br />
mit einer entsprechend anderen körperlich-seelischen Dramaturgie<br />
konfrontiert. Der Zweifel, ob man „ein richtiger Mann<br />
ist", sitzt im Durchschnitt bei Jungen <strong>und</strong> Männern tief.<br />
Die frühkindliche Suche nach männlicher Geschlechteridentität<br />
ist also zuerst durch das Bindungs-/Ablösungsverhältnis<br />
zur Mutter <strong>und</strong> dann durch das - mit ihm konkurrierenden <strong>und</strong><br />
ihn zugleich suchende - Verlangen nach dem „männlichen"<br />
Vater (oder einer vergleichbaren männlichen Bezugsperson)<br />
bestimmt. Für viele Jungen ist es aber schwer über den Vater -<br />
oder eine ähnlich nahe männliche Bezugsperson - jene Alltagsidentifikation<br />
zu bekommen, die er braucht, um in ein<br />
ganzheitliches - Stärken <strong>und</strong> Schwächen gleichermaßen verkörpern<strong>des</strong><br />
- Mannsein hineinwachsen zu können. Die Männer<br />
sind ja nicht nur räumlich (zum Beispiel über die Berufsrolle),<br />
sondern oft auch „mental" abwesend, wenn sie zu Hause sind,<br />
sich aber wenig um die häusliche Beziehungsarbeit kümmern.<br />
Diese obliegt meist der Mutter, die sich dem Jungen in ihren<br />
Stärken <strong>und</strong> Schwächen zeigt. Die Schwächen <strong>des</strong> Vaters <strong>und</strong><br />
seine alltäglichen Nöte <strong>des</strong> Mannseins - z.B. das Ausgesetztsein<br />
<strong>und</strong> die Verletzungen im Beruf - werden dagegen für den<br />
Jungen selten sichtbar. So erhält er ein einseitiges Vaterbild,<br />
das durch die „starken" Männerbilder, die der Junge mit zunehmendem<br />
Alter über die Medien wahrnimmt, noch verfestigt<br />
wird. Dies führt bei ihm zwangsläufig zur Idolisierung <strong>des</strong><br />
Mannseins <strong>und</strong> zur Abwertung <strong>des</strong> Gefühlsmäßigen, Schwachen,<br />
„Weiblichen", da er die eigenen weiblichen Gefühlsanteile,<br />
die er ja seit der frühkindlichen Verschmelzung mit der<br />
Mutter in sich trägt, immer weniger ausleben kann. Diesen<br />
Zusammenhang hat Nancy Chodorow in ihrem Modell der<br />
„IJmwegidentifkation" systematisiert (s. Kasten). Neuere Väterstudien<br />
(s.u.) zeigen, dass sich eine höhere Beziehungs- <strong>und</strong><br />
damit alltägliche Vorbildqualität entwickelt, wenn Väter zeitlich<br />
<strong>und</strong> emotional intensiver in der Sphäre der Familie auftauchen.<br />
Freilich hat sich dabei noch nicht viel Gr<strong>und</strong>legen<strong>des</strong><br />
an der Struktur väterlichen Familienengagements im Sinne<br />
männlicher Beziehungs- <strong>und</strong> Hausarbeit geändert. Dazu<br />
braucht es auch gesellschaftliche Vorgaben der Anerkennung<br />
<strong>und</strong> Förderung männlicher Hausarbeit. Denn mit der Entgrenzung<br />
der Arbeitsgesellschaft lässt auch die „Feminisierung"<br />
der Erwerbsarbeit in diesem Zusammenhang ambivalente Folgen<br />
erwarten. Indem das Normalarbeitsverhältnis erodiert,<br />
prekäre Arbeitsverhältnisse im Sinne von mangelnder sozialer<br />
Sicherung, schlechter Bezahlung <strong>und</strong> Arbeitsplatzunsicherheit<br />
auch die Männer erreichen, werden sich viele erst recht an die<br />
traditionelle Erwerbsarbeit klammern, wenn die alternativen<br />
Bereiche der Hausarbeit keine anerkannte Männerrolle versprechen.<br />
Deshalb ist es schon in der Kindheit für den Jungen<br />
wichtig, eine Mutter zu erleben, die sowohl dem Vater als auch<br />
dem -Jungen gegenüber anerkannte Selbstständigkeit über die<br />
Familie hinaus verkörpert <strong>und</strong> damit signalisiert, dass sie dem<br />
Jungen auch soziale Rollenvorbilder anbieten kann. Dies ist<br />
wohl auch der Punkt, an dem die Forderung von Sozialpolitikerinnen,<br />
die Frau in der Familie müsse eine exit-option haben<br />
(das heißt materiell <strong>und</strong> sozial gegenüber dem Mann unabhängig<br />
sein können, wenn die Partnerschaft selbstbestimmt funktionieren<br />
soll), für das Aufwachsen <strong>und</strong> die Erziehung von Jungen<br />
bedeutsam ist. Ist die Mutter dagegen eher abhängig <strong>und</strong><br />
daher mit schwachem Selbstwertgefühl ausgestattet, kann sich<br />
bei ihr die unbewusste Tendenz verstärken, den Sohn als<br />
männlich stark erleben zu wollen. Gleichzeitig ist sie aber in<br />
dieser Zumutung an den Jungen auch wieder nicht eindeutig.<br />
„Je wertloser sich die Frau als Subjekt fühlt, <strong>des</strong>to größer<br />
werden ihre Widerstände sein, sich auf die vielfältigen Anforderungen<br />
<strong>des</strong> außerordentlich komplexen Prozesses der Symbiose<br />
<strong>und</strong> ihrer Auflösung einzulassen, <strong>des</strong>to schwerer fällt es<br />
ihr, das Kind aus der Symbiose zu entlassen, weil die Verheißungen<br />
unerfüllt geblieben sind". Der Junge „soll ihren (unbewussten)<br />
Ängsten von Sinnentleerung <strong>und</strong> Identitätsverlust<br />
entgegenwirken, indem er unerfüllte erwachsene Bedürfnisse<br />
94 95
efriedigen helfen soll, was er nicht kann" (Menzel 1993, S.<br />
16). Diese gespürte Überforderung kann den Jungen weiter in<br />
den Sog der Idolisierung <strong>des</strong> Männlichen <strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong><br />
Weiblichen treiben lassen.<br />
96<br />
Umwegidentifikation<br />
Die alltägliche Bindungsintensität der Mutter <strong>und</strong> die mangelnde<br />
Alltagspräsenz <strong>des</strong> Vaters erschweren dem kleinen<br />
Jungen die männliche Geschlechteridentifikation, zu der ihn<br />
nicht zuletzt die frühe körperliche Entdeckung seines geschlechtlichen<br />
Andersseins zwingt. Da die Prozesse der Identitätsfindung<br />
von den Möglichkeiten der Alltogsidentifikation<br />
abhängig sind, rückt die Mutter als alltagspräsentes Identifikationsobjekt<br />
zwangsläufig in den Mittelpunkt der kindlichen<br />
Suche nach männlicher Geschlechteridentität. Die Mutter verhält<br />
sich hier meist ambivalent: Auf der einen Seite will sie<br />
den Sohn sich „als Mann" entwickeln sehen, andererseits kann<br />
sie aber - über das Mutter-Kind-Verhältnis hinaus - keine<br />
männlichkeitsauffordernde Geschlechterbeziehung zum Jungen<br />
bei sich zulassen. Der kleine Junge spürt, dass er von der<br />
Mutter gleichzeitig „zum Mann" ermuntert <strong>und</strong> zurückgewiesen<br />
wird. In dieser zwiespältigen Beziehungskonstellation ist<br />
der Junge - weil die Mutter ja alltagsverfügbares Identifikationsobjekt<br />
ist - auf eine „Umwegidentifikation" angewiesen<br />
(Ilagemann-White 1954, S. 90ff). „Mann sein" wird an dem<br />
gemessen, was man an sich selbst <strong>und</strong> den Männern seiner<br />
Umgebung sieht - bei sich selbst vor allem den Penis, bei den<br />
„großen" Männern das maskulin-dominante Auftreten -, <strong>und</strong><br />
mit dem verglichen, was die Mutter hat bzw. nicht hat. So<br />
wird die Mutter als „Nicht-Mann" erkannt. Die prägnanteste<br />
Wahrnehmung dabei ist, dass die Frau keinen Penis hat (ebd.,<br />
S. 82), später gilt der Blick <strong>des</strong> Jungen dem weiblichen Habitus<br />
<strong>und</strong> dem Rollenverhalten der Mutter <strong>und</strong> anderer Frauen in<br />
der näheren Umgebung. Da der Vater nur partiell in seinen<br />
demonstrierten Stärken (Ausnahmeverhalten) präsent ist <strong>und</strong><br />
zudem die Mutter oft auch stellvertretend für ihn, aber in seinem<br />
Namen, agiert, erscheint der Vater übermächtig. Der alltägliche<br />
Zwang zur Umwegidentifikation <strong>und</strong> die Idolisierung<br />
<strong>des</strong> Männlichen gehen beim Jungen ineinander über. Nancy<br />
Ghodorow (1985) hat versucht, die Ablaufslogik dieser Um-<br />
wegdefnition aufzuschließen <strong>und</strong> ist dabei zu einem erweiterten,<br />
kummulativen Modell der Mann = blicht-Nicht-Mann gekommen.<br />
Danach läuft die männliche Geschlechtsidentifikation<br />
nicht direkt über die Mutter als blicht-Mann, sondern über<br />
die Distanzierung, Negation <strong>und</strong> Abwertung von den sichtbaren<br />
weiblichen <strong>und</strong> damit nicht männlichen Geschlechtsmerkmalen<br />
<strong>und</strong> Ausdrucksformen ab. So ist dem Jungen eine<br />
männliche Perspektive eröffnet, da über die Nicht-Nicht-<br />
Mann-Perspektive - in mathematischer Analogie (minus mal<br />
minus ist gleich plus) - eine positive Wendung zur „männlichen<br />
Identifikation am Weiblichen" hin möglich wird.<br />
Eben aus diesem strukturellen Zwang zur Umwegidentifikation<br />
resultieren die Antriebe zur Idolisierung <strong>des</strong> Männlichen<br />
<strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen, die dann später durch die soziale<br />
<strong>und</strong> mediale Umwelt verstärkt oder reduziert werden<br />
können. Eine Gegensteuerung ist vor allem dann erfolgversprechend,<br />
wenn der Vater früh <strong>und</strong> alltäglich seinen ganzheitlichen<br />
Anteil an der Beziehung zum Jungen übernimmt, die<br />
Mutter dem Sohn als selbstständige <strong>und</strong> egalitäre Instanz gegenübertreten<br />
kann <strong>und</strong> in den begleitenden Institutionen der<br />
Kindererziehung auch genügend männliche Erzieher vorhanden<br />
sind. Ganz wird sich dieses tiefenwirksame Strukturmodell<br />
der Umwegidentifikation aber nie auflösen lassen, ist es<br />
doch an die Naturtatsache <strong>des</strong> Gebärenkönnens <strong>und</strong> die daraus<br />
folgende Mutter-Kind-Symbiose geb<strong>und</strong>en. Das können auch<br />
Väter bestätigen, die die Möglichkeit <strong>des</strong> Erziehungsurlaubs<br />
voll ausgeschöpft haben. Das bedeutet aber nicht, dass Jungen<br />
<strong>und</strong> Männer dieser tiefenstrukturell-funktional wirksamen<br />
Konstellation <strong>des</strong> Mannwerdens ohnmächtig ausgesetzt sind.<br />
Denn es handelt sich hier nicht um einen deterministischen<br />
Sachverhalt, sondern um eine Spannung, die biografisch produktiv<br />
bewältigt werden kann, auch wenn sich jeder Junge <strong>und</strong><br />
Mann im Verlauf seines Lebens immer wieder dabei ertappt,<br />
dass solche Idolisierungs- <strong>und</strong> Abwertungsgefühle bei ihm<br />
aufkeimen <strong>und</strong> ihn anrühren, auch wenn er sonst für sich in<br />
Anspruch nimmt, sie rational überw<strong>und</strong>en zu haben.<br />
Die Idolisierung <strong>des</strong> Männlichen <strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen<br />
wird auch durch das immer noch wirkende Homosexualitätstabu<br />
(s. Exkurs) eigentümlich verstärkt. Gerade weil ab<br />
97
Experten an die Jungen <strong>und</strong> den offenbarten Einstellungen der<br />
Jungen selbst. Die Ergebnisse legen die "These nahe, dass dort,<br />
wo Jungen ihre Jugend ausleben <strong>und</strong> sich mit sich selbst auseinandersetzen<br />
können, ihre - bisher sozial übergangenen - inneren<br />
Qualitäten frei werden können. Wenn allerdings in der<br />
Studie von gesellschaftlichen Bereichen die Rede ist, die jenseits<br />
der Jugendkultur liegen - zum Beispiel eben die Schule,<br />
die Berufsperspektive oder die kommunale Öffentlichkeit -<br />
haben die Jungen auch durchaus männliche Rollenbilder im<br />
Kopf: ,;Überraschend oft wird auch die hohe Bedeutung von<br />
Verantwortungsübernahme <strong>und</strong> Verantwortlichkeit genannt.<br />
Ein Mann sollte an die Zukunft denken <strong>und</strong> an die Familie`.<br />
[...] An manchen Stellen tauchen dabei Erwartungen an die<br />
Männlichkeit auf, die mit spezifischen Schwierigkeiten in<br />
Verbindung gebracht werden (können). So wird mit Blick auf<br />
die Bedrohung zwischen untergehen <strong>und</strong> ausgeschlossen werden<br />
auf das Spannungsverhältnis zwischen , Sich-durchsetzen-<br />
Können' <strong>und</strong> ,Sich-Integrieren' [...] verwiesen. An einigen<br />
Stellen wird betont, dass sich Männer im Griff haben müssen,<br />
also über ausreichende Selbstkontrolle verfügen sollen - dies<br />
allerdings nicht in Bezug auf Übergriffe oder Gewalt, sondern<br />
eher als Präsentation in der Öffentlichkeit oder gegenüber<br />
Mädchen" (ebd., S. 155/156).<br />
Auch bei diesen Jungen, die aktuell sehr stark, durch die Jugendkultur<br />
geprägt sind, hat sich bereits im Vorgriff auf einen<br />
männlichen Habitus eine Haltung ausgebildet, die sich auf das<br />
Erwachsenwerden bezieht, das ihnen ja bevorsteht. Hier zeigt<br />
sich, wie die Zweiseitigkeit der Jugendphase wirkt <strong>und</strong> was<br />
auch die Jugendforschung immer wieder betont: Dass Jugendliche<br />
zwar peer-orientiert in der Jugendkultur leben, aber immer<br />
auch in der Spannung zum Erwachsenwerden stehen.<br />
Maskuline Antriebe sind jugendkulturell überformt, Männlichkeitsbilder<br />
entsprechend aus der Gegenwart ,weggeschoben'<br />
aber dennoch wieder antizipiert. Dabei kommt es darauf<br />
an, ob die Jungen soziokulturell in der Tage sind, dieses Erwachsenwerden<br />
in jugendkultureller Unbefangenheit zu antizipieren<br />
oder ob Bewältigungsprobleme dieser Erwachsenenwelt<br />
schon in die Jugendzeit hineinragen. Denn vor allem<br />
dorrt, wo die Schatten der Arbeitswelt auftauchen <strong>und</strong> sich<br />
schon - wie in der Bildungskonkurrenz in der Schule, bei der<br />
100<br />
Suche nach einer Lehrstelle, beim Problem der Übernahme in<br />
einen Beruf, bei der Erfahrung von Arbeitslosigkeit in der<br />
Familie - andeuten, ahnen die Jungen, was ihnen als Männern<br />
einmal blüht. Jugendstudien, welche vor allem diese gesellschaftsbezogenen<br />
Segmente der Einstellungen von Jugendlichen<br />
ansprechen - zum Beispiel die zwölfte Shell-Studie Jugend<br />
1997 - haben dies deutlich gezeigt: Viele Jugendliche<br />
sind gespalten, sie möchten eigentlich ihre Jugendzeit ausleben,<br />
kommen aber nicht so richtig dazu, weil sie immer wieder<br />
<strong>und</strong> schon früh soziale Risiken <strong>und</strong> - da sie diese nicht<br />
kalkulieren können - Gefahren auf sich zukommen sehen. So<br />
stehen auch die Jungen heute mit einem Bein neben <strong>und</strong> mit<br />
dem anderen Bein schon mitten in der Gesellschaft. Deshalb<br />
ist auch ihre optimistische Gegenwartsorientierung (vgl. Jugend<br />
2002) so stark, sie dient dazu, diese Spaltung zu neutralisieren.<br />
So können zwar die Schatten der sozialen Risiken immer<br />
wieder vertrieben, Bedrohungen aber nicht aufgelöst werden.<br />
Setzt sich der soziale Bewältigungsdruck gegenüber der<br />
jugendkulturellen Unbefangenheit durch, dann kommen auch<br />
wieder maskuline Orientierungen ins Spiel. Dies wird vor allem<br />
aus der Praxis der Jugendarbeit berichtet, die es mit Jugendlichen<br />
aus sozial benachteiligten Milieus zu tun hat (vgl.<br />
dazu ausführlich Böhnisch/Funk 2002). Diese Jungen stehen<br />
früh unter Stress, <strong>und</strong> Stress ist eine Zustandsbefindlichkeit, in<br />
die sie getrieben werden, die bei ihnen typische Muster <strong>des</strong><br />
männlichen Bewältigungshandelns freisetzt. Sie versuchen<br />
Stress in hektisch wechselnden Aktivitäten zu vermindern -<br />
was den Stress oft noch erhöht - Aktivitäten, bei denen sie<br />
meinen, nicht unter Druck zu stehen. Spaß haben ist vor allem<br />
angesagt <strong>und</strong> - in der Dynamik der Abspaltung der eigenen<br />
Hilflosigkeit - wird es zum Spaß auf Mosten andere: Idolisierung<br />
männlicher Dominanz <strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen,<br />
Schwachen speisen dann ein Gemisch aus jugendkultureller<br />
Selbstinszenierung <strong>und</strong> Bewältigungsverhalten.<br />
Dieser Zusammenhang von Geschlechternivellierung <strong>und</strong> Jugendkultur<br />
bewegt sich allerdings immer noch in Sozialisation 1<br />
<strong>und</strong> lässt die andere - maskulinitätsauffordemde - Seite <strong>des</strong><br />
Einflusses der neuen Medien auf die Jugendlichen (Sozialisation<br />
11) weitgehend außer Acht. Jugendkultur <strong>und</strong> Medienkultur<br />
gehen aber heute ineinander über. Auf den ersten Blick
sieht es auch so aus, dass hier die Geschlechterdifferenz erst<br />
recht aufgehoben ist, da Mädchen die neuen Möglichkeiten<br />
der Medienkommunikation genauso gebrauchen wie Jungen.<br />
Die Jugendlichen sind interaktiv eingeb<strong>und</strong>en in die neue<br />
Technik <strong>und</strong> ständig wechselnde technologische Innovationen<br />
geben ihnen das Gefühl, an dieser Entwicklung gestaltend<br />
teilzuhaben, selbst treibender Faktor zu sein. Der Zwang, mithalten<br />
zu müssen, wird durch das Gefühl aufgewogen, dabei<br />
zu sein. So verschiebt sich die gesellschaftliche Orientierung<br />
„unter der Irland" auf die Sozialisationssphäre von Technik 11<br />
(vgl. Tully 2003). Männlichkeit die ja - wie Geschlechterbezüge<br />
überhaupt - , erst im Kontext <strong>des</strong> Sozialen ihre Bedeutung<br />
erhält, wird für die in der Dynamik <strong>und</strong> Ästhetik <strong>des</strong><br />
Gebrauchs der neuen Technik gefangenen' Jugendlichen belanglos.<br />
Maskulinität erscheint in modularen Bildern, die gefallen<br />
oder nicht gefallen, anziehen oder abstoßen, die aber<br />
nicht mehr sozial rückgeb<strong>und</strong>en sind. So werden die medialen<br />
Geschlechterbilder, die - ob soap oder action -, durchaus<br />
geschlechtsdifferente <strong>und</strong> geschlechtshierarchische Profile haben<br />
von vielen Jugendlichen weder als Männlichkeits- oder<br />
Weiblichkeitsmuster aufgenommen, sondern als Stilbilder, die<br />
einem dann eher sozial attraktiv denn problematisch erscheinen.<br />
Die zweite, verdeckte Ebene der Geschiechterhierarchie<br />
<strong>und</strong> Geschlechterdifferenzierung, die ja in der sozialen Umwelt<br />
strukturell weiter wirkt <strong>und</strong> auch die psychodynamische<br />
Auseinandersetzung der Jugendlichen mit sich selbst weiter<br />
beherrscht, wird nun in parasozialen Bildern vermittelt, welche<br />
die innere Spannung der Jugendlichen gleichzeitig aufnehmen<br />
<strong>und</strong> sie sozial unverbindlich <strong>und</strong> situativ auflösen. So<br />
werden Konstellationen gefördert, dass Jugendliche - vor allem<br />
in den Mittelschichten - geschlechtsnivellierend auftreten<br />
können, gleichzeitig in ihren maskulinen Anmutungen medial<br />
„bedient" werden <strong>und</strong> sich <strong>des</strong>halb nicht geschlechtsreflexiv<br />
verhalten brauchen. Auch so ist das Phänomen der „neuen<br />
Mädchen" <strong>und</strong> „neuen Jungen", die nichts von ihren feministischen<br />
Müttern <strong>und</strong> erst recht nichts von ihren männerbewegten<br />
`Tätern annehmen wollen, erklärbar. Jugend ist <strong>des</strong>halb<br />
nicht automatisch die zweite Chance der männlichen Soziallsation,<br />
weil auch hier schon die parasozialen Verdeckungen<br />
von Sozialisation 11 wirken. Augenfällig wird dies inzwischen<br />
1 0 2<br />
bei vielen Jungen vor allem aus der Unterschicht, die Maskulinität<br />
über ihren Körper ausdrücken, dies aber medial als Fitnessprogramm<br />
gespiegelt bekommen. Aus den Jugendhäusern<br />
wird berichtet, dass gerade die Jungen, die schon viel Geld für<br />
Muskelnahrung bis hin zu Anabolika ausgeben, sich eben<br />
nicht mehr als Machos anmachen lassen, sondern sich als<br />
Teilhaber einer Erfolgskultur fühlen, in der Durchsetzungsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> Maskulinität so ineinander übergehen, dass ein<br />
Lebensstil unter anderen daraus wird.<br />
Letztendlich ist also zu fragen, ob sich das pädagogische Vertrauen<br />
auf die geschlechternivellierende Kraft der Jugendkultur<br />
- die sich durchaus auch in den Jugendstudien der 1990er<br />
<strong>und</strong> beginnenden 2000er Jahre nachzeichnen lässt - nicht zu<br />
sehr den Haltungen der Unbefangenheit <strong>und</strong> dem Gegenwartsoptimismus<br />
aufsitzt, die ja für das Jugendalter charakteristisch<br />
sind. Denn gleichzeitig erhalten wir von der neuen Jugendforschung<br />
zunehmend Bef<strong>und</strong>e dahingehend, dass die Risiken<br />
der Arbeitsgesellschaft die Jugend erreicht haben, Jugendliche<br />
also früh mit sozialen Problemen konfrontiert werden<br />
- Konkurrenzdruck, Ausbildungsmisere -, von denen sie<br />
nach dem traditionellen Modell <strong>des</strong> Jugendmoratoriums eigentlich<br />
verschont sein sollten. Diese Entgrenzung der Jugend<br />
führt dazu, dass sich bei vielen Jugendlichen heute Orientierungsmuster<br />
entwickeln, die Stilelemente der Erwachsenen<strong>und</strong><br />
Jugendkultur miteinander verbinden. „Null Zoff <strong>und</strong> voll<br />
busy", so gibt sich diese Jugend (vgl. Zinnecker u.a. 2002),<br />
die eine Jugendzeit ohne Konflikte durchleben <strong>und</strong> dabei<br />
schon mit einem Bein in der Erwachsenengesellschaft stehen<br />
möchte. Flicht, weil sie schon Erwachsene sein wollen - da<br />
treffen sich die Ergebnisse der Jugendstudien mit denen von<br />
Winter/Neubauer -, sondern weil sie spüren, dass sie schon in<br />
der Jugendzeit Optionen auf später ausbilden müssen, obwohl<br />
sie sich von ihrem jugendkulturellen Empfinden her eigentlich<br />
dagegen sträuben. Entgrenzung der Jugend <strong>und</strong> Entgrenzung<br />
der Männlichkeit (s.o.) gehen dann ineinander über: Die Jungen<br />
empfinden sich noch nicht als angehende Männer, weil sie<br />
im Alltagsverhalten jugendkulturell gepolt sind, sie orientieren<br />
sich aber genauso an der Erfolgskultur der Erwachsenengesellschaft,<br />
in die - Sozialisation 11 - männlichkeitsauffordernde<br />
Elemente warenästhetisch eingeb<strong>und</strong>en sind, männli-<br />
103
che Dominanz aber nicht mehr stilprägend ist. Auch in diese<br />
Richtung kann die geschlechtsdiffuse Haltung der Jugendlichen<br />
gedeutet werden. Die geschlechtswirksame Auseinandersetzung<br />
mit sich selbst scheint sich nun - auch das ist ein Zeichen<br />
der Entgrenzung der Jugend - mehr in die Integritätsthematik<br />
der Altersphase der jungen Erwachsenen verschoben zu<br />
haben (vgl. Kap. 4.2).<br />
j „Balanciertes Jungeseln `<br />
Durch den Verlauf männlicher Sozialisation zieht sich die<br />
Problematik <strong>des</strong> „Verwehrtseins" der empathischen Potenziale,<br />
die Jungen haben, die aber unter dem latenten Druck der<br />
sozialisatorischen Außenfixierung oft nicht entfaltet werden<br />
können. Mehr noch: Je öfter solches verwehrt wird, <strong>des</strong>to eher<br />
bricht es in der Abspaltung dieser Frustration bei Überbetonung<br />
der maskulinen Seite auf. Wir können diesen gleichsam<br />
gesetzmäßigen Vorgang im Begriff der Bedürftigkeit (s.u.)<br />
aufschließen. Gleichzeitig drückt sich in diesen innerpsychisehen,<br />
aber sozial gerichteten Verarbeitungsprozessen eine typische<br />
Bewältigungsspannung aus: Die Jungen müssen immer<br />
wieder versuchen, ins Gleichgewicht zu kommen, handlungsfähig<br />
zu bleiben, um Selbstwert, soziale Anerkennung <strong>und</strong> soziale<br />
Wirksamkeit (als Voraussetzung positiver Identität) zu<br />
erreichen. Gunther Neubauer <strong>und</strong> Reinhard Winter sind in ihren<br />
pädagogisch-empirischen Zugängen zu Jungen immer<br />
wieder auf dieses balancierende Bewältigungsverhalten gestoßen<br />
<strong>und</strong> haben in diesem Zusammenhang ein sozialisatorischpädagogisches<br />
Modell <strong>des</strong> „balancierten Jungeseins" entwickelt.<br />
Es soll das Augenmerk auf die verdeckten, nicht zum<br />
Zuge kommenden Vermögen der Jungen richten, in den gezeigten<br />
Schwächen auch die verborgenen Stärken entdecken<br />
helfen. So kann die Defizitorientierung, die dem Blick auf das<br />
Aufwachsen von Jungen seit dem antisexistischen Diskurs der<br />
Frauenbewegung anhaftet, überw<strong>und</strong>en werden. „Ein Missverständnis<br />
wäre es allerdings, dass mit dem Modell schwierige<br />
Seiten oder problematisches Verhalten bei Jungen <strong>und</strong> Männern<br />
ausgeblendet oder verdeckt werden sollen, indem immer<br />
„nur das Positive" wahrgenommen wird. [...] Aber die Perspektive<br />
verändert bzw. erweitert sich mehr in die Richtung,<br />
was sein soll <strong>und</strong> was sein wird, wenn das Problematische an<br />
1 04<br />
Bedeutung verliert. [...] Das Modell betont gerade die Gestaltungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Potenziale, auch wenn sie (noch)<br />
nicht genutzt sind" (Winter/Neubauer 2002, S. 32).<br />
In diesem Sinne bietet das Modell Variablenpaare an, die diese<br />
wechselnden Balancen beschreiben: Jungen, die permanent<br />
aktiv sein müssen <strong>und</strong> unter Stress stehen, sich darzustellen,<br />
darf nicht die Reflexionsfähigkeit <strong>und</strong> das Vermögen zum<br />
Selbstbezug <strong>und</strong> Innehalten abgesprochen werden. Sie haben<br />
nur wenig Gelegenheiten <strong>und</strong> Ermunterungen dafür, das Vermögen<br />
ist verschüttet oder es handelt sich um ein Abspaltungs-<br />
<strong>und</strong> Kompensationsverhalten. Maskulin überzogenes<br />
Konflikt- <strong>und</strong> Stärkeverhalten darf nicht darüber hinwegtäusehen.,<br />
dass das Bedürfnis nach Schutz <strong>und</strong> nach dem Erleben<br />
von Grenzen ebenso vorhanden ist. Bei meiner Arbeit mit<br />
Wiener Jungenarbeitern (vgl. Verein Wiener Jugendzentren<br />
2002) habe ich das pädagogische Gespür der Praktiker für diese<br />
Bewältigungsbalance <strong>und</strong> die übergangenen Potenziale bei<br />
Jungen erlebt, wenn sie schilderten, dass Jungen, die sich in<br />
vielen Situationen <strong>des</strong> Jugendhauses anderen gegenüber verantwortungslos<br />
<strong>und</strong> abwertend aufführten, dann doch wieder -<br />
in anderen, für sie geschützten Situationen - ein ausgeprägtes<br />
Gefühl für Gerechtigkeit entwickeln. Der Bewältigungszwang,<br />
unter dem Jungen oft stehen <strong>und</strong> in dem sozial produktive Anteile<br />
zurückgedrängt werden, lässt sich an alltäglichen Situationen<br />
- wie hier in einem Jugendhaus - darstellen: „Wird der,<br />
primär von männlichen Jugendlichen bespielte Tischfußbailtisch<br />
einmal von weiblichen Jugendlichen genutzt, versammeln<br />
sich häufig recht schnell einige Burschen, die durch ihr<br />
Auftreten - abwertende Kommentare, „gute Tipps" usw. - die<br />
spielenden Mädchen verdrängen. Der Zwang, dem männlichen<br />
Rollenverständnis zu entsprechen, der Wunsch, ihre Fähigkeiten<br />
beim Tischfußball zu präsentieren, arbeiten gegeneinander.<br />
Weder legen die Mädchen darauf Wert, mit ihnen zu spielen,<br />
noch ihnen dabei zuzusehen - <strong>und</strong> die Ratschläge sind auch<br />
nicht willkommen. Die Verdrängung ist häufig das Resultat<br />
eines missglückten Versuchs, wahrgenommen zu werden. Dieses<br />
Bedürfnis auf andere Weise zu artikulieren stellt für viele<br />
Burschen eine zu große Hürde dar" (ebd., S. 46). Ein anderes<br />
Beispiel aus der Wiener Jugendarbeit zeigt wiederum, wie<br />
solch spannungsgeladenen Situationen sich so drehen können,<br />
105
dass sich die psychosoziale Balance bei den Jungen in Richtung<br />
eines positiven Erlebens sonst verschütteter <strong>und</strong> übergangener<br />
produktiver Fähigkeiten verschieben kann. Es ging um<br />
ein Projekt „Snowboardfahren": .,,Von der Burschengruppe,<br />
die daran teilnahm, beherrschte nur ein Jugendlicher diese<br />
Sportart. Auch die Betreuerlnnen waren mehr oder minder<br />
Anfängerinnen. So war das Projekt von vornherein darauf angelegt,<br />
dass eine Dynamik <strong>des</strong> gegenseitigen Helfens entstehen<br />
musste. Sehr schnell wurde deutlich, dass niemand ohne<br />
Unterstützung der anderen Burschen die ersten Schwünge bewältigte<br />
oder den Lift benutzen konnte. Die „kollektive Hilflosigkeit"<br />
sorgte mitunter für große Heiterkeit uröd führte zu einer<br />
Form der Gegenseitigkeit, die einmal nicht durch die übliche<br />
Konkurrenz zwischen Burschen, sondern durch wechselseitige<br />
Stützung, Weitergabe von Erfahrung <strong>und</strong> Aufmunterung<br />
geprägt war, Morgens <strong>und</strong> abends wurde in gemeinsamen<br />
Besprechungen erarbeitet, was sich in dieser Dynamik<br />
entwickelt hat <strong>und</strong> wie die Gruppe darauf aufbauen kann"<br />
(ebd., S. 104).<br />
Das Konzept <strong>des</strong> „balancierten Jungeseins" ist aus der Praxiserfahrung<br />
der Pädagogik heraus entwickelt <strong>und</strong> als sozialisatorische<br />
Hypothese in das Bewältigungsmodell integrierbar.<br />
Sein Vorzug dabei ist, dass es nicht normativ abgehoben (Wie<br />
könnte ein gelingen<strong>des</strong> Junge- <strong>und</strong> Mannsein aussehen?), sondern<br />
in eine Empirie eingebettet ist: Das, was Jungen alternativ<br />
vermögen, ist da, wenn auch verdeckt <strong>und</strong> übergangen<br />
<strong>und</strong> kann aufgeschlossen werden, braucht aber entsprechende<br />
interaktive <strong>und</strong> soziale Bedingungen. So ist die Gefahr eines<br />
naiv-konstruktivistischen Optimismus gebannt, denn die empirische<br />
Einbettung verweist letztlich wieder auf die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen <strong>und</strong> tiefenpsychischen Verstrickungen,<br />
in die Männlichkeit eingelassen ist <strong>und</strong> die maßgeblich<br />
dazu beitragen, dass Jungen <strong>und</strong> Männer in Abspaltungszwänge<br />
<strong>und</strong> Balanceprobleme der Handlungsfähigkeit kommen.<br />
106<br />
3,3 Der „triebbedrängte" Junge W<br />
fiefendilnensionen <strong>des</strong> Mainwerdens<br />
Die psychoanalytisch rückgeb<strong>und</strong>ene Sozialisationstheorie,<br />
wie sie hier vor allem in Anlehnung an 1Vancy Ghoderows Ansatz<br />
entwickelt wurde, schließt uns nicht nur auf, wie Jungen<br />
zu Männern sozial „gemacht" werden. Sie kann auch eine<br />
rücke zu den tiefenpsychischen Entwicklungsvorgängen<br />
schlagen, indem sie die inneren Bindungs- <strong>und</strong> Ablösungsprozesse<br />
zu den sozialen Zuschreibungen einerseits <strong>und</strong> ihren<br />
subjektiven Übernahmen durch die Jungen <strong>und</strong> Männer andererseits<br />
in Beziehung zu setzen vermag. Dennoch bleibt die<br />
tiefenpsychische, triebgedrängte Seite männlicher Sozialisation<br />
für sich unaufgeschlossen, da der psychoanalytischsoziologische<br />
Ansatz das Tiefenpsychische ins Soziale hineinzieht<br />
<strong>und</strong> dort die Entsprechungen sucht. Dies ist insoweit<br />
plausibel, als die tiefenpsychische Dimension erst im Vergeselischaftungsprozess<br />
freigesetzt (<strong>und</strong> gleichzeitig überformt)<br />
wird. Die Eigendynamik <strong>des</strong> Leib-Seelischen in seiner psychosexuellen<br />
Konstellation, die onto- <strong>und</strong> kulturgenetische<br />
Triebgedrängtheit <strong>des</strong> Männlichen wird also in dieser<br />
Perspektive zwar tangiert, aber nicht erfasst. Mass Jungen <strong>und</strong><br />
Männer männlich fühlen <strong>und</strong> von dieser Männlichkeit bisweilen<br />
„übermannt' werden, ohne dies psychosozial steuern zu<br />
können, ist mit dem Konzept der „Übernahme" sozialer Zuschreibungen<br />
<strong>und</strong> Deutungen nicht zu erklären. Hier wirkt<br />
vielmehr der Umstand, dass die Kategorie Geschlecht mehr<br />
als eine soziale, nämlich genauso eine leibgeb<strong>und</strong>ene Kategorie<br />
ist, die ihre somatische Eigenkraft entwickeln kann. Der<br />
Psychoanalytiker Fritz Morgenthaler spricht in diesem Zusammenhang<br />
vom „energetischen Potential", das in der<br />
„Triebhaftigkeit <strong>des</strong> Es" steckt, das drängend <strong>und</strong> „ungerichtet"<br />
ist (1984, S. 138). Marin ist diese Primärkategorie <strong>des</strong> Sexuellen<br />
abgesetzt von der psychosozialen Gesamtkategorie der<br />
Sexualität, die sich psychisch <strong>und</strong> sozial interaktiv in der Bewältigungsdynamik<br />
formt, in der sie aufgeht <strong>und</strong> in der sie besonders<br />
wirksam werden kann (vgl. dazu auch Reiche 1990).<br />
1n der Pubertät (s.u.) kommt dies wohl am spektakulärsten<br />
zum Ausdruck.<br />
107
Aber nicht nur in dieser Entwicklungsphase wirkt die psychosexuelle<br />
Eigenkraft <strong>des</strong> Geschlechts. Aus den Bef<strong>und</strong>en der<br />
modernen Stressforschung wissen wir, wie sich diese Primärkraft<br />
verselbstständigen <strong>und</strong> Befindlichkeit <strong>und</strong> Verhalten beeinflussen<br />
kann, wenn es darum geht, die körperlich-seelische<br />
Befindlichkeit einem wie immer auch gearteten somatischen<br />
Gleichgewicht zuzuführen. Wir spüren selbst, wie wir in kritischen<br />
Lebenssituationen, in denen die gewohnten psychischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Mechanismen der Orientierung <strong>und</strong> Handlungsregulierung<br />
versagen, in „Zustände" kommen, in denen wir<br />
uns nicht mehr erkennen oder fassungslos auf unsere körperlich-seelischen<br />
Reaktionen sind, die sich augenscheinlich aus<br />
unserer Selbstkontrolle gelöst haben.<br />
Deshalb kommt die Soziologie - auch wenn sie sich mit der<br />
Psychoanalyse verbündet - immer dort an ihre Grenzen, wo<br />
sie die subjektive Erfahrung <strong>des</strong> Geschlechtlichen im Emotionalen<br />
ortet <strong>und</strong> mit Begriffen wie „Betroffenheit" <strong>und</strong> „Zustandsbefindlichkeit"<br />
zu arbeiten versucht. Solche Begriffe<br />
verweisen zwar - soziologisch gesehen - auf einen nicht mehr<br />
erklärbaren „psychophysischen Rest", können diesen aber<br />
höchstens nur mit psychoanalytischen Assoziationen beschreiben,<br />
seine - freilich zum Sozialen hin gebrochene - Eigenmächtigkeit<br />
aber nicht erklären. Diese interdisziplinäre<br />
Problematik lässt sich am besten am Beispiel der sozialisationstheoretischen<br />
Verwendung <strong>des</strong> Paradigmas der Geschlechtsidentität<br />
darstellen.<br />
Im Gender-Diskurs wird in der Regel der Identitätsbegriff <strong>des</strong><br />
Symbolischen Interaktionismus verwendet. Dieser sucht die<br />
Verbindung von personaler Befindlichkeit <strong>und</strong> sozialem<br />
Standort der Person. Es wird eine Identitätsgleichung aufgemacht,<br />
in der ein Zusammenspiel von gesellschaftlichen Verhaltenserwartungen<br />
<strong>und</strong> individueller, personaler Selbstäußerung<br />
zu jener psychosozialen Balance führt, in der die Identität<br />
ein mit sich <strong>und</strong> anderen im Einklang Sein` darstellt. Im<br />
Mittelpunkt dieser von G. H. Mead (1973) entwickelten Identitätstheorie<br />
steht der „generalisierte Andere", in den das Ich<br />
sich über sprachliche Interaktion hineinzuversetzen hat, um<br />
seinen Platz <strong>und</strong> seine Zustandsgewissheit, sein Selbst im Sozialen<br />
zu finden. Indern ich lerne mich sozial zu verhalten, bin<br />
l 08<br />
ich <strong>und</strong> gewinne ich meine Sicherheit <strong>des</strong> Selbst. Das bedeutet<br />
nicht, dass ich mich einfach sozial anpasse. Vielmehr wird in<br />
diesem Identitätskonzept davon ausgegangen, dass ich mich<br />
mit meinen personalen Angelegenheiten <strong>und</strong> meinem Eigensinn<br />
in der Interaktion mit Anderen auseinandersetze, dass ich<br />
mir ein Bild von mir über die Anderen mache, dabei aber<br />
meine eigene Personalität <strong>und</strong> Individualität ausspiele.<br />
Doch in diesem Konzept bleibt ungeklärt, ob <strong>und</strong> wie das vorsoziale,<br />
triebgeprägte Ich (dem psychoanalytischen Es nahe),<br />
das im sozialen Ich (Me) aufgeht, seine vorsoziale Kraft verloren<br />
oder vielleicht doch behalten hat: „Meads Gedanken zu<br />
Identität fügen sich zu einem Interpretationsmodell, in dem<br />
die Identität vor allem durch die Erwartung <strong>und</strong> Faltung der<br />
Anderen gebildet wird. Wegen der großen Bedeutung, die das<br />
Lernen von Sprache <strong>und</strong> die kognitive Dimension menschlichen<br />
Daseins in ihm haben, kann man auch von einem Wissensmodell<br />
sprechen. Von der "Triebnatur <strong>des</strong> Menschen wird<br />
in ihm also abgesehen" (Gottschalch 1988, S. 117). Das Problem<br />
einer soziologischen Annäherung an das Selbst besteht im<br />
Gr<strong>und</strong>e also darin, dass sich trotz entsprechendem Anspruch<br />
der Moderne die vorsozialen Strukturen, welche die erste Natur<br />
<strong>des</strong> Menschen bilden, nicht rational <strong>und</strong> linear von der<br />
zweiten Natur her, dem Sozialen <strong>des</strong> Menschen, aufschließen<br />
<strong>und</strong> entsprechend integrieren lassen. Die sozialwissenschaftlichen<br />
Zivilisationstheoretiker - allen voran Norbert Elias<br />
(1976) - haben in diesem Zusammenhang ja gezeigt, dass der<br />
ökonomische fortschritt <strong>und</strong> die soziale Strukturierung der<br />
modernen Industriegesellschaften mit der Unterdrückung <strong>und</strong><br />
Kanalisierung der menschlich-kreatürlichen Triebstrukturen<br />
einher gegangen sind. Jede soziale Regel, je<strong>des</strong> Recht <strong>und</strong> jede<br />
Institution : so zitiert Wilfried Gottschalch (1988, S. 114)<br />
den Soziologen Helmut Plessner - „artikuliert, kanalisiert <strong>und</strong><br />
unterdrückt die entsprechenden Triebregungen". In dieser<br />
psychohistorischen Verortung der menschlichen Triebstrukturen<br />
wird deutlich, dass die menschlichen Triebe, „die aus unbekannten<br />
Tiefen stammen" (Gottschalch) nie für sich allein,<br />
sondern immer in der Spannung zum Sozialen gesehen werden<br />
müssen. Eben wegen dieser sozialen Spannung, in der das<br />
Triebverhalten steht, stecken in ihm auch Widerständigkeit,<br />
Eigensinn <strong>und</strong> Protest gegen Verdrängung <strong>und</strong> Entmündigung<br />
109
<strong>des</strong> Menschen im Zwangscharakter gesellschaftlicher Entwicklungsmuster.<br />
Dieses Triebhandeln wird vor allem in kritischen<br />
Lebenssituationen, wo man auf sich gestellt ist <strong>und</strong> die<br />
sozialen Bewältigungsressourcen weitgehend versagen, freigesetzt.<br />
Die Suche nach einer neuen psychosozialen Balance<br />
kann dann nicht von der sozialen Seite, sondern muss von der<br />
innerpsychischen Seite <strong>des</strong> Betroffenseins, der triebgedrängten<br />
Konstellation selbst ausgehen.<br />
An dieser Stelle wird von Gottschalch das Identitätskonzept<br />
von H. Erikson ins Spiel gebracht: „Was Erikson vor allem<br />
von Mead unterscheidet ist, dass er die menschlichen Triebschicksale<br />
<strong>und</strong> ihre Bedeutung nicht verkennt. Nicht nur Unzulänglichkeiten<br />
der Gesellschaft sind es, die zu Identitätskrisen<br />
fuhren, sondern auch Unzulänglichkeiten der menschlichen<br />
Natur." (ebd., S. 118). Soziales wird bei Erikson durch<br />
Triebabwehr gebildet <strong>und</strong> immer wird er durch Triebausbruch<br />
herausgefordert. Von der ödipalen Krise im frühkindlichen<br />
Alter bis zur Pubertätskrise im Jugendalter führt eine Triebspur<br />
durch die Sozialisation, an deren Ende Ich-Identität steht:<br />
Als Zustand, in dem ich mich sozial dazugehörig weiß,<br />
gleichzeitig aber fähig bin, mich als einmaliges Individuum zu<br />
fühlen <strong>und</strong> mich über dieses leibseelische Fühlen selbst zu bejahen.<br />
Dennoch bemängelt die neuere psychoanalytische Kritik an<br />
Eriksons Identitätsbegriff, dass er das, was Mead ins Soziale<br />
hinein projiziert - die Suche nach Gleichgewicht <strong>und</strong> Ordnung<br />
im Verhältnis von Ich <strong>und</strong> sozialer Umgebung - nun ins Innen<br />
<strong>des</strong> Menschen hinein verlegt: „Das Risiko sowohl auf dem<br />
Gebiet <strong>des</strong> theoretischen Denkens wie der klinischen Arbeit<br />
ist, dass ein Begriff wie Identität eine Kohärenz <strong>und</strong> eine<br />
Konsistenz ausdrücken kann, die nicht dem aktuellen Fluss<br />
<strong>und</strong> dem Widerspruch der inneren Welt- <strong>und</strong> Selbsterfahrung<br />
<strong>des</strong> Menschen entspricht. Ich denke, wir nehmen sowohl bei<br />
dein Patienten als auch bei uns selbst Erscheinungsweisen der<br />
Identität, oder was auch immer für Identität gehalten wird,<br />
wahr, um uns gegen die Erfahrung von verschiedenen <strong>und</strong><br />
konflikthaften Wünschen <strong>und</strong> unterschiedlichen <strong>und</strong> konfliktreichen<br />
Aspekten <strong>des</strong> Selbst zu schützen. Ideen wie die von<br />
der „Identität" dienen als stützende Verblendung angesichts<br />
<strong>des</strong> äußeren Zerfalls <strong>und</strong> <strong>des</strong> inneren Chaos. Eine der Möglichkeiten,<br />
wie „Identität" gedacht werden kann, ist in der Tat<br />
diese: Als eine notwendige Abwehr, als unvermeidlicher <strong>und</strong><br />
universeller Ausdruck <strong>des</strong> psychischen Bedürfnisses nach<br />
Ordnung <strong>und</strong> Kohärenz in der Sicht <strong>des</strong> Einzelnen von sich<br />
selbst" (May 1991, S. 176). Damit rückt - im Begriff der Abwehr<br />
- das Streben nach , Handlungsfähigkeit', wie es im Bewältigungskonzept<br />
zentral ist, vor den Begriff der Identität<br />
<strong>und</strong> wir können in der psychosexuellen Perspektive ein wesentliches<br />
Antriebselement der Psychodynamik <strong>des</strong> Bewältigungshandelns<br />
identifizieren. Gerade in kritischen Lebenssituationen<br />
<strong>und</strong> biografischen Brüchen zeigt sich, dass hinter<br />
der Fassade gesuchter Identität Triebbedrängungen lauern<br />
<strong>und</strong>, dass eine „feste Vorstellung von uns selbst [...] oft Abwehrcharakter<br />
[hat]. Wenn beispielsweise ein junger Mann in<br />
der analytischen Therapie sich allmählich auf das Gebiet ,homosexueller'<br />
Vorstellungen einlässt, beteuert er häufig, dass<br />
er sich aber über seine sexuelle Identität im Klaren sei <strong>und</strong><br />
keine Zweifel diesbezüglich kenne. Die Vorstellung von einer<br />
einzigen sexuellen Identität dient dazu, einige dieser Gedanken<br />
von der Erfahrung auszuschließen. Die feste Vorstellung<br />
der einen Identität macht vielmehr <strong>und</strong> kategorisch das Brechen<br />
der Barrieren zur Bedrohung" (ebd., S. 182). Hier lässt<br />
sich natürlich eine konstruktivistische Nachfrage stellen. Ist es<br />
nicht so, dass die therapeutische Intervention den sozialen<br />
ruck, heterosexuell zu sein, dekonstruiert <strong>und</strong> so das Heterosexuelle<br />
als sozial Durchgesetztes entlarvt? Natürlich spielt<br />
die dominante soziale Definition ihre Rolle. Aber dies reicht<br />
nicht an den tiefendynamischen Vorgang der Abwehr heran.<br />
Es ist nicht nur die äußere Bedrohung, die wirkt, sondern auch<br />
der innere Triebkonflikt, der aufgebrochen wird. Hier kommt<br />
es darauf an, welche Chancen der junge Mann in seiner bisherigen<br />
Biografie hatte, seine homoerotischen Anteile harmonisch<br />
- über erlernte Empathie <strong>und</strong> zugelassenen Selbstbezug -<br />
zu integrieren, um handlungsfähig zu bleiben oder zu werden.<br />
Die Suche nach männlicher Geschlechtsidentität, welche das<br />
Aufwachsen <strong>des</strong> Jungen in der psychoanalytisch-soziologischen<br />
Interpretationsperspektive durchzieht ist also auch durch<br />
naturgeb<strong>und</strong>ene, tiefenwirksame Gr<strong>und</strong>segmente bestimmt, deren<br />
Wirken freilich davon abhängt, wie sich die Entwicklung
<strong>des</strong> Jungen zum Mann in den personalen Beziehungs- <strong>und</strong> sozialen<br />
Umweltbedingungen gestaltet. Ob <strong>und</strong> inwieweit diese<br />
naturgeb<strong>und</strong>enen maskulinen Anteile entwicklungsbestimmend<br />
werden, hängt also in der Regel von den Chancen ab,<br />
diese Anteile produktiv zu integrieren <strong>und</strong> sozial auszubalancieren.<br />
Diese naturbezogenen Anteile wurzeln in der psychosexuellen<br />
Tiefenstruktur <strong>des</strong> Jungen. Bevor ich mich mit der<br />
arstellung dieses Modells auf das psychoanalytische Glatteis<br />
begebe, ist es mir wichtig, diese Argumentation im neueren<br />
psychoanalytischen Diskurs zu verorten. Ich folge hier einer<br />
Linie, die sich einerseits von der in der freudschen Trieblehre<br />
vorherrschenden Genitalfixierung („Peniszentriertheit") der<br />
frühen Kindheitsempfindungen löst <strong>und</strong> mehr den Symbolgehalt<br />
der Geschlechtsorgane in der frühen Mutter-Kind(-<br />
Vater)-Interaktion betont, andererseits aber die Bedeutung der<br />
psychosexuellen Auseinandersetzung mit der körpergenitalen<br />
Entwicklung nicht unterschlägt. Sicher ist das Sexuelle „geradezu<br />
prä<strong>des</strong>tiniert, f<strong>und</strong>amentale soziale Reaktionen zum<br />
Ausdruck zu bringen. Das Geheimnis' der Symbolbildung -<br />
<strong>und</strong> damit auch die Bedeutung der Genitalien für die Symbolik<br />
- liegt in dem komplizierten Zusammenhang von Körperliebkeit<br />
<strong>und</strong> Gesellschaftlichkeit begründet" (Bran<strong>des</strong> 2002, S.<br />
38). Es sind eben hauptsächlich die Geschlechtsorgane, die die<br />
Geschlechterdifferenz symbolisieren <strong>und</strong> in dieser Symbolkraft<br />
sich in einen männlichen <strong>und</strong> weiblichen Habitus hinein sozial<br />
verlängern (vgl. zum Habitusbegriff 1.3). Gleichzeitig aber<br />
bleibt in diesem symboltheoretischen Zugang das leibseelische<br />
Eigenerlebnis <strong>des</strong> Jungen ungeklärt. Wir brauchen also genauso<br />
<strong>und</strong> weiterhin ein psychosexuelles Modell. In einem solchen<br />
Modell - korrespondierend. zum psychosozialen Modell der<br />
Entwicklung <strong>des</strong> Mannseins - kann nun aufgeschlossen werden,<br />
wie der kleine Junge sich in seinem Junge- <strong>und</strong> Mannwerden<br />
aus sich heraus erlebt. Während in den frühen soziaiisatorischen<br />
Interaktionen dem Jungen die Geschlechtlichkeit nach<br />
seinen körperlichen Geschlechtsmerkmalen von Eltern <strong>und</strong> anderen<br />
von Anfang an zugeschrieben wird, muss sie der Junge<br />
in seiner psychosexuellen Befangenheit erst selbst entdecken<br />
<strong>und</strong> erspüren. So erfährt er die Problematik, dass der Penis<br />
von ihm nicht beherrschbar ist, dass Erektionen unvorhersehbar<br />
<strong>und</strong> aus nicht kontrollierbaren Regungen auftreten. Hier<br />
ist früh das Dilemma angelegt, das auch später bei erwachsenen<br />
Männern in der Impotenzangst gipfelt: Er ist nicht Herr<br />
seiner Sexualität; seine Geschlechtlichkeit scheint auch unabhängig<br />
von ihm agieren zu können <strong>und</strong> so ist es ihm zeitlebens<br />
verwehrt, ein ganzheitliches Geschlechterbild von sich zu finden.<br />
Damit ist auch der Zugang zum Körper <strong>und</strong> zum Innen<br />
von der psychosexuellen Seite her gestört. Während Mädchen<br />
<strong>und</strong> Frauen über die Regelmäßigkeit der Menstruation <strong>und</strong> die<br />
körperliche Einheit <strong>des</strong> Gebärvorgangs diesen ganzheitlichen<br />
Zugang eher finden können, sind Jungen <strong>und</strong> Männer zeitlebens<br />
um das Funktionieren ihrer Geschlechtlichkeit <strong>und</strong> damit<br />
auch um ihr Funktionieren als Mann bemüht. Der Gr<strong>und</strong>antrieb<br />
der Selbstbehauptung (Aggression) ist <strong>des</strong>halb beim<br />
Mann deutlich mit diesem psychosexuellen Dilemma verb<strong>und</strong>en.<br />
Hierauf sind durchaus auch die psychosexuellen Anteile<br />
männlicher Aggressivität zurückzuführen. Dabei muss aber -<br />
vor allem auch im Hinblick auf das folgende psychosexuelle<br />
Modell - immer wieder beachtet werden, dass es sich hier<br />
nicht um einen biologischen Triebzwang' bzw. ein ,Triebschicksal'<br />
handelt, wie dies noch in der klassischen Psychoanalyse<br />
<strong>und</strong> ihrer Rezeption gedeutet wurde. Vielmehr haben<br />
wir es hier - ganz im Sinne <strong>des</strong> Bewältigungskonzeptes (vgl.<br />
2.3) mit einer sozial gerichteten, d.h. in die psychodynamische<br />
Bewältigungsdynamik eingeb<strong>und</strong>enen <strong>und</strong> über sie wirksamen<br />
Triebbewegung zu tun.<br />
Die erste Linie psychosexueller Entwicklung, die sich in der<br />
frühen Kindheit aufbaut, ist mit der Problematik der erzwungenen<br />
Objektwahl in den ersten Lebensjahren verb<strong>und</strong>en. Die<br />
Mutter ist in unserer Gesellschaft - davon geht ja auch das<br />
psychoanalytisch-soziologische Modell der männlichen Sozialisation<br />
aus - das zentrale Identifikationsobjekt für den kleinen<br />
Jungen. Kleinkinder imitieren ihre Mutter, später haben kleine<br />
Jungen den Wunsch, wie die Mutter Kinder zu bekommen.<br />
ie Mutter muss dies in der Kleinkindphase noch nicht abwehren,<br />
da sich der Junge noch eng mit ihr verb<strong>und</strong>en fühlt.<br />
Deshalb kann die Ablösung von der Mutter nur gelingen,<br />
wenn das männliche Objekt - in <strong>des</strong>- Regel der Vater - zu dem<br />
sich der Junge, nachdem er erkannt hat, dass er männlich ist,<br />
hingezogen fühlt, ähnlich innige Objektbeziehungen aufbauen<br />
kann wie die Mutter. Ein symbolischer Ausdruck für diesen
Übergang ist der Beginn <strong>des</strong> Urinierens im Stehen. An ihm<br />
kann man sehr gut beobachten - wenn er sich verzögert oder<br />
lange Zeit gar nicht gelingt - welche Schwierigkeiten der kleine<br />
Junge hat, in seiner Geschlechtsorientierung auf den Vater<br />
überzugehen. Bleibt der Vater abwesend, das heißt mental<br />
nicht erreichbar, dann kann der Junge in seiner psychosexuellen<br />
Entwicklung stehen bleiben (infantiles <strong>Zur</strong>ückbleiben) oder<br />
z.B. auch auf dem Wunsch, ein Mädchen zu sein, beharren.<br />
Dies wiederum kann zu erheblichen Störungen bei der<br />
Ablösung von der Mutter führen, zumal die Mutter - vor allem<br />
von der sozialen Seite her - in diesem Übergang von der frühkindlichen<br />
zur kindlichen Phase deutlich bemüht ist, den Jungen<br />
männlich zu definieren <strong>und</strong> von sich loszulassen.<br />
e zweite psychosexuelle Entwicklungsphase, die später einsetzt<br />
(3.-5. Jahr), ist die der Entwicklung einer triadischen Objektbeziehung.<br />
Der Junge strebt nach dem Vater, will von ihm<br />
geliebt werden, kann nun Beziehungen zu Frauen <strong>und</strong> Mädchen,<br />
Männern <strong>und</strong> Jungen in ihrer jeweiligen Eigenheit unterscheiden,<br />
erfährt die Verschiedenheit der Geschlechter.<br />
Hier entwickelt sich vor allem auch die ambivalente Seite der<br />
psychosexuellen Entwicklung, die Rivalität zwischen Vater<br />
<strong>und</strong> Sohn. Diese lebt im Unterbewussten der Gefühlswelt <strong>des</strong><br />
Vaters als Neid bis hin zu verborgenen To<strong>des</strong>wünschen. Sozial<br />
äußern sich solche psychosexuellen Komplexe z.B. in der<br />
autoritären Art <strong>und</strong> Weise, wie der Vater mit dem Sohn umgeht,<br />
wie er ihn zum Funktionieren drängt, wie er unerfüllbare<br />
Maßstäbe aufstellt, die der Sohn erfüllen soll (vgl. dazu ausf.<br />
ran<strong>des</strong> 2002, S. 32ff.).<br />
In der klassischen freudschen Psychoanalyse ist die Dramatik<br />
dieser Phase mehr auf die gegengeschlechtliche Anziehung<br />
zur Mutter <strong>und</strong> die daraus resultierende Rivalität zum Vater<br />
zentriert <strong>und</strong> wird - in der Symbolik <strong>des</strong> Inzestwunsches - mit<br />
dem Begriff <strong>des</strong> „ödipalen Konfliktes" belegt. Die moderne<br />
Psychoanalyse teilt zwar die damit verb<strong>und</strong>ene Annahme,<br />
dass sich zu dieser Zeit die Empfindungen <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
der Grenzen der eigenen Geschlechtlichkeit ausbilden. Sie<br />
sieht diese psychosexuelle Entwicklungsphase aber nicht mehr<br />
so zwanghaft, triebgenetisch <strong>und</strong> konfliktreich auf sexuelle<br />
Phantasien fixiert, sondern als selbstbehauptende <strong>und</strong> diffe-<br />
renzierende Entwicklungsleistung <strong>des</strong> Jungen. Die ödipale<br />
amatik wird nach dieser Auffassung eher durch die Eltern<br />
ins Spiel gebracht: „Erst durch die offen oder verdeckt pathologischen<br />
Reaktionen der Eltern auf diese neue Qualität kindlicher<br />
Zuwendung gewinnt dieser Entwicklungsschritt sexuelle<br />
<strong>und</strong> die Inzestschranken der Familie bedrohende Züge"<br />
(Bran<strong>des</strong> 2002, S. 37). Diese Vorstellung von einer positiven<br />
Entwicklungsleistung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> ist auch dem hier vorgestellten<br />
psychosexuellen Ablaufmodell unterlegt.<br />
Die dritte psychosexuelle Entwicklungsphase (6-11 Jahre)<br />
wird traditionell mit dem Begriff der Latenz` bezeichnet. Die<br />
klassische Psychoanalyse sah hier eine Desexualisierung der<br />
kindlichen Gefühle <strong>und</strong> ihre Sublimation in unerotische Beziehungsintensität<br />
<strong>und</strong> Ichsuche. Die neue Kindheitsforschung<br />
hat dieses Bild korrigiert. Sexuelle Vorgänge <strong>und</strong> „die Bewegtheit<br />
durch Liebesgefühle [lassen] in dieser Zeit jedoch<br />
keinesfalls nach. Sie werden dem Kind mit Beginn <strong>des</strong> Einschulungsalters<br />
lediglich bewusster, es lernt sie besser zu verbergen,<br />
um sich der sozialen Kontrolle <strong>und</strong> moralischen Sanktionen<br />
zu entziehen. Erste erotische Erfahrungen <strong>und</strong> körperliche<br />
Veränderungen werden <strong>des</strong>halb nicht mehr von den Erwachsenen<br />
wahrgenommen, weil sie zur „Geheimsache" werden.<br />
Da wird plötzlich das Badezimmer abgeschlossen oder<br />
eine einzelne Umkleidekabine im Schwimmbad oder im<br />
Kaufhaus verlangt. Über erotische Erlebnisse wird zu Hause<br />
nicht gesprochen" (Milhoffer 2000, S. 18). Der scheinbar geschlechtsneutrale<br />
<strong>und</strong> unbefangene Umgang miteinander, wie<br />
ihn Kinderforscher bei Mädchen <strong>und</strong> Jungen in diesem Alter<br />
beobachten, hat also so seine Hinterbühne, auf der sich sexuelle<br />
Befangenheit einzuschleichen beginnt. Kinder spüren die<br />
ersten Veränderungen ihres Körpers, die sie nicht mehr als<br />
kindlich empfinden, entwickeln Phantasien über die Liebesverhältnisse<br />
der Erwachsenen <strong>und</strong> stoßen zum ersten Mal<br />
selbst auf Tabus. Dieser verdeckte Prozess der Sexualisierung<br />
erhält seine ersten vorpubertären hormonellen Anschübe, so<br />
dass statt von einer Latenzzeit durchaus von einem kindlichen<br />
Pubertäts(vor)status gesprochen werden kann. Zudem ist diese<br />
Altersgruppe schon tief in den Medienkonsum eingetaucht<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong>halb früh von sexualisierten Bildern männlicher Dominanz<br />
<strong>und</strong> weiblicher <strong>Zur</strong>ücknahme berührt. Die Bilder
sprechen jetzt an, offerieren dem Jungen einen maskulinen<br />
Rahmen.<br />
e vierte psychosexuelle Entwicklungsphase <strong>des</strong> Jungen, in<br />
der die psychosoziale Auseinandersetzung mit der eigenen<br />
Sexualität ganz in den Vordergr<strong>und</strong> tritt, findet schließlich in<br />
der Pubertät ihren Höhepunkt. Die Pubertät beginnt bei Jungen<br />
zwischen dem 11. <strong>und</strong> 13. Lebensjahr <strong>und</strong> äußert sich<br />
körperlich im Wachsen der Boden, <strong>des</strong> Glie<strong>des</strong> <strong>und</strong> der mehr<br />
oder minder starken Behaarung von Brust, Gesicht, Armen,<br />
einen <strong>und</strong> <strong>des</strong> Körperbereiches um den Penis herum. Mit<br />
dem Wachsen <strong>des</strong> Kehlkopfes entsteht Stimmbruch, der Junge<br />
bekommt eine „männliche" Stimme. Es häufen sich Samenergüsse<br />
<strong>und</strong> die Jungen sind damit konfrontiert, dass sie eigentlich<br />
zeugungsfähig sind. Dazu kommt ein Wachstumsschub,<br />
der die Jugendlichen älter erscheinen lässt. Mit dieser stürmischen<br />
körperlichen Entwicklung kann die psychosoziale Befindlichkeit<br />
nicht Schritt halten, Konflikte in sich selbst sind<br />
unausweichlich. Zudem wirkt immer noch das gesellschaftliche<br />
Tabu <strong>des</strong> Geschlechtsverkehrs in dieser von der Gesellschaft<br />
noch als „kindlich" betrachteten Lebenszeit, obwohl<br />
inzwischen viele Jungen schon früh Koituserlebnisse haben.<br />
Insofern ist der Bef<strong>und</strong> Wilhelm Reichs aus den 1930er Jahren<br />
keineswegs aus der Welt: „Der Pubertätskonffikt entspricht<br />
[...] einer Rückentwicklung zu primitiveren, kindlichen<br />
Formen <strong>und</strong> Inhalten <strong>des</strong> Sexuallebens. Wenn sie nicht von<br />
vornherein durch pathologische Fixierung im Kindlichen bedingt<br />
ist, ist sie einzig <strong>und</strong> allein Folge der gesellschaftlichen<br />
Versagung der genitalen Befriedigung im Geschlechtsakt in<br />
der Reifezeit. Es gibt also prinzipiell zwei Möglichkeiten:<br />
Entweder tritt der Jugendliche in Folge seiner bisherigen Sexualentwicklung<br />
unfähig zur Findung eines Sexualpartners in<br />
die Pubertät ein, oder die gesellschaftliche Versagung der Sexualbefriedigung<br />
in der Pubertät drängt ihn in Onaniephantasien,<br />
mithin auch in die pathogene Situation <strong>des</strong> infantilen Konfliktes<br />
hinein." (Reich 1966, S. 118). Obwohl die Masturbation<br />
heute enttabuisiert ist, ist sie doch immer noch von Schuldgefühlen<br />
bzw. ihren Überkompensationen begleitet. Diese machen<br />
den regressiven (infantilisierenden) Charakter der Pubertät<br />
aus.<br />
Der Pubertätskonfliki erzeugt nicht nur typische sexuelle<br />
Spannungen, sondern vor allem auch heftige Gemütsschwankungen<br />
<strong>und</strong> Reizausbrüche der Umwelt gegenüber. „Dafür<br />
sind nicht nur hormonelle Veränderungen, sondern nach neueren<br />
Erkenntnissen auch neurophysiologische Wachstumsvorgänge<br />
im Gehirn selbst verantwortlich." So wurde herausgef<strong>und</strong>en,<br />
„dass das Gehirn <strong>des</strong> Menschen bis ins frühe Erwachsenenalter<br />
wächst <strong>und</strong> sich ausdifferenziert. [...] Erst in der<br />
Adoleszenz erhalten die Nervenbahnen, die für die Kontrolle<br />
von Emotionen <strong>und</strong> Aggressionen zuständig sind, allmählich<br />
ihre , Myelinhülle', eine Art Schutzmantel, der vor übermäßigen<br />
Reizen schützt <strong>und</strong> Reaktionen zu kontrollieren hilft. Die<br />
Nerven liegen daher in der Zeit der Geschlechtsreife im Wortsinn<br />
,blank- (Milhoffer 2000, S. 15/16). Das, was wir an pubertierenden<br />
Jugendlichen als irrational <strong>und</strong> unwirklich<br />
bewerten, ist für sie wirklich <strong>und</strong> verlängert sich in diesem Eigengefühl<br />
in die soziale Umwelt hinein, in der es prompt anecken<br />
muss. Gleichzeitig wird die pubertäre Hektik durch die<br />
unbewusste Angst geschürt, aus der Geborgenheit der Kindheit<br />
herausgeworfen zu werden. Unwirkliche omnipotentmännliche<br />
<strong>und</strong> infantile Ausdrucksformen gehen somit in der<br />
Jungenpubertät ineinander über. In der Konfrontation mit den<br />
Erwartungen <strong>und</strong> Zumutungen der sozialen Umwelt erzeugt<br />
dies bei den Jungen immer wieder Stress (s.u.).<br />
Uns interessiert nun in diesem Zusammenhang wieder der sozialisations-<br />
<strong>und</strong> bewältigungstheoretische Aspekt der Auseinandersetzung<br />
<strong>des</strong> Jungen mit der ihn übermannenden' Sexualität.<br />
Die kindlichen Reflexionen erscheinen dann als auch<br />
sozial ausgelöste Abwehrhaltungen <strong>und</strong> die (Omni)Potenzantriebe<br />
als so manifestierte Optionen auf die körperlich gespürte,<br />
aber sozial noch nicht fassbare Entwicklung zum Erwachsenen.<br />
Insofern ist die Pubertät nicht ein Rückfall, sondern<br />
ein Schwellenereignis, das in der Entwicklung nach vorne<br />
zeigt. In diesem Sinne interpretiert auch Marion Erdheim<br />
die psychosexuelle Dramatik der Pubertät als „zweite Chance"<br />
<strong>und</strong> lässt nun auch die produktive soziale Seite <strong>des</strong> Pubertätskonflikts<br />
zum Zuge kommen: „Der Triebdurchbruch der Pubertät<br />
lockert die vorher in der Familie gebildeten psychischen<br />
Strukturen auf <strong>und</strong> schafft damit die Voraussetzungen für eine<br />
nicht mehr auf den familiären Rahmen bezogene Umstruktu-
ierung der Persönlichkeit" (Erdheim 1988, S. 193). „Auf dieser<br />
Erschütterung <strong>des</strong> familiären Realitätsprinzips gründet die<br />
kulturelle Relevanz der Adoleszenz. Das Auftreten der Menstruation<br />
bei den Mädchen sowie die Unbeherrschbarkeit <strong>des</strong><br />
Phallus bei Knaben verändern das Selbstbild <strong>des</strong> Körpers <strong>und</strong><br />
damit auch den Bezug zur Umwelt. Die Verselbständigung<br />
innerer <strong>und</strong> äußerer Objekte ist eine befremdende Erfahrung,<br />
<strong>und</strong> der in der Pubertät neu aufblühende Narzissmus bekommt<br />
die kompensierende Funktion, die auseinander fallende Welt<br />
zusammenzuhalten" (ebd., S. 498).<br />
Idas soziale Gesicht der Jungenpubertüt<br />
Die Pubertät als spannungsgeladene leib-seelische <strong>und</strong> soziale<br />
Entwicklungs- <strong>und</strong> Übergangssituation verlangt von den Jugendlichen<br />
viel an Energien ab, in ihr ist Wirkliches <strong>und</strong> Unwirkliches<br />
miteinander vermischt. Vor allem haben die Jugendlichen<br />
keine Erfahrungen, auf die sie aufbauen können,<br />
sie erleben alles neu <strong>und</strong> klammern sich notgedrungen an ihre<br />
eigene Befindlichkeit. Das macht ihren Narzissmus in dieser<br />
Lebensphase aus. Sie schwanken zwischen Omnipotenzgefühlen,<br />
Ohnmacht, Ängsten <strong>und</strong> lustvollen Selbstinszenierungen.<br />
Gleichzeitig ist das eine Entwicklungszeit, in der die Jungen<br />
nach männlicher Identität suchen <strong>und</strong> damit in Spannung zu<br />
anderen Jungen geraten, sich gegenseitig aufladen. Diese<br />
Komplexität, Widersprüchlichkeit <strong>und</strong> Vielfältigkeit <strong>des</strong> Erlebens,<br />
der Wechsel zwischen Ausgesetztsein <strong>und</strong> Selbstbehauptung,<br />
lässt sich am besten mit dem Begriffskonstrukt „Stress"<br />
umschreiben: Stress als dynamische Befindlichkeit, in der man<br />
sich einem psychosozialen Druck ausgesetzt sieht, den man<br />
nicht „wegerklären" kann, auf den man aber mit Stimmungen<br />
reagiert, ohne diese Stimmungen selbst kontrollieren zu können.<br />
Im Stress gehen auch die typischen Ängste der Jungen<br />
auf, wie sie Sturzenhecker (2002) beschreibt: „Angst, kein<br />
richtiger Mann zu sein", „Versagensangst`, „Angst vor Gefühlen<br />
(vor Kummer, Rührung, Zärtlichkeit)", „Angst vor dem<br />
Urteil der Frauen <strong>und</strong> Mädchen", „Angst vor der Gewalt der<br />
anderen Jungen" (S. 43-45). Diese Ängste sind in Stresskonstellationen<br />
versteckt, werden von den Jungen <strong>und</strong> jungen Männern<br />
meist abgespalten, auf anderes <strong>und</strong> andere projiziert, sind<br />
eben nicht so erkennbar wie sie vom Fachmann benennbar<br />
bar sind. Sie gehen in Bewältigungsrauster ein, verpuppen sich<br />
in Umweg- <strong>und</strong> projektionsverhalten. Deshalb ist es notwendig,<br />
die dahinter liegenden Wirkmechanismen der inneren<br />
Hilflosigkeit <strong>und</strong> Bedürftigkeit bei Jungen <strong>und</strong> Männern (s.o.)<br />
zu kennen, sonst bleibt einem - bei allem kategorialen Wissen -<br />
der Zugang zur Psychodynamik <strong>des</strong> Jungenverhaltens verwehrt.<br />
„Unter Stress stehen" ist also eine Zustandsbefindlichkeit, in<br />
die Jungen oft „getrieben" werden, die bei ihnen typische<br />
Muster <strong>des</strong> Bewältigungshandelns <strong>und</strong> damit der Selbstbehauptung<br />
<strong>und</strong> der Suche nach Handlungsfähigkeit freisetzt. Sie<br />
stehen unter Stress <strong>und</strong> können gleichzeitig „nicht zu sich<br />
kommen", was aber wichtig wäre, um so Stress abzubauen.<br />
Also versuchen sie, Stress in hektisch wechselnden Aktivitäten<br />
zu vermindern - was den Stress oft noch erhöht - Aktivitäten,<br />
bei denen sie meinen, nicht unter Druck zu stehen. Spaß haben<br />
ist angesagt <strong>und</strong> sie merken in ihrer Männlichkeitssuche im<br />
Kreisel von Idolisierung <strong>und</strong> Abwertung nicht, dass es meist<br />
Spaß auf Mosten anderer ist, der sie nur zeitweise entlastet.<br />
Spaß haben, um jeden Preis, ist das Antriebsmotiv vieler Jugendlicher<br />
<strong>und</strong> hat auch sein geschlechtstypisches Gesicht.<br />
Spaß ist die emotionale Suche nach Wohlgefühl, das man(n)<br />
sich aber immer wieder in neuen äußeren Situationen holt.<br />
Abwertung <strong>und</strong> Idolisierung sind oft die Motoren <strong>des</strong> Spaßsuchens:<br />
Der Spaß als wechselnde Imitation Stärkerer <strong>und</strong> Abwertung<br />
Schwächerer. Der Spaß ist oft mit der Angst gepaart,<br />
sich zu blamieren. Deshalb gilt es entspannte Situationen zu<br />
schaffen, damit das Blamieren nicht an den Selbstwert geht.<br />
Pädagogen versuchen in solchen Situationen den Druck herauszunehmen,<br />
der die Spaßspirale, die Abwertung auf Kosten<br />
anderer, nach oben dreht. Die Jungen sollen spüren können,<br />
dass Spaß auf Kosten anderer ins Leere läuft, auch Unwohlsein<br />
erzeugen kann, betroffen machen kann. Gerade sozial<br />
benachteiligte Jugendliche sehen im Körper ihr einziges<br />
Kapital, das sie haben. Deshalb ist es schwierig, ihre männlich<br />
dominante Körperlichkeit von vornherein verändern zu wollen.<br />
Jeder pädagogische Versuch, den Körper anders als dominant<br />
zu erleben, wird von den Jugendlichen als Verlust empf<strong>und</strong>en.<br />
Sie inszenieren sich mit ihrem Körper <strong>und</strong> dies meist<br />
sehr stark auf Kosten anderer. Wie erreicht sie dann aber die
otschaft: Niemand will dir deine Körperlichkeit nehmen, es<br />
gibt aber auch andere, die wollen etwas von dir, auch wenn sie<br />
nicht so stark sind <strong>und</strong> fühlen sich wohler, wenn du dich zurücknimmst.<br />
Auch dann erhältst du Anerkennung! Drohgebärden<br />
sind aber oft Teil der Sprache der Jugendlichen, ein Umwegverhalten,<br />
mit dem sie erst ihren Raum abstecken (dabei<br />
oft hilflos sind) <strong>und</strong> dann etwas damit mitteilen. Die Mitarbeiter<br />
fühlen sich in dem Maße nicht bedroht, in dem sie merken,<br />
dass die Jugendlichen die Beziehung zu ihnen brauchen. Dominante<br />
Körperlichkeit wird ja vor allem auch dann demonstriert,<br />
wenn die Jugendlichen periodisch zeigen wollen, dass sie<br />
noch da sind <strong>und</strong> dass sie beachtet werden wollen.<br />
Jugendliche hängen Idolen nach. Sie gehören zur Szenerie der<br />
Unwirklichkeit (das Unwirkliche wirklich machen) der Pubertät.<br />
Idole kann man den Jugendlichen pädagogisch nicht nehmen,<br />
wenn man es versucht, ist die Wirkung eher kontraproduktiv.<br />
Idole symbolisieren Wünsche, Träume <strong>und</strong> Sehnsüchte<br />
der Jugendlichen im pubertären Spannungsfeld. Die Erreichbarkeit<br />
dieser Träume spielt in der Unwirklichkeit der Pubertät<br />
keine Rolle. Deswegen sind sie auch gegen pädagogische Beeinflussungen<br />
weitgehend immun. Sozialarbeiter sind keine<br />
Idole, sie können aber Vorbilder sein. Diese Vorbildwirkung<br />
entwickelt sich nach Erfahrung der Wiener Jungenarbeiter<br />
weniger in der normativen Vorbildwirkung - also vor allem<br />
moralisch-ethisch -, sondern eher funktionell. Es beeindruckt<br />
die Jungen, dass es „ihr" Jugendarbeiter geschafft hat mit dem,<br />
was er mit ihnen macht, einen Job zu kriegen, der den Jugendlichen<br />
auch noch zugute kommt. Man kann von ihm profitieren<br />
<strong>und</strong> mit der Zeit spielt sich auch das Gefühl ein, dass er<br />
wichtig für einen ist. Dann kann auch sein Verhalten für einen<br />
selbst attraktiv werden, wird man neugierig wie er sich als<br />
Mann, der sich von den gängigen Männerbildern der Väter,<br />
Lehrer, älterer Fre<strong>und</strong>e u.a. unterscheidet, verhält. Zu Idolen<br />
werden meist Schauspieler, Popstars, Fußballer. Bei Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergr<strong>und</strong> - auch bei denen, die hier geboren<br />
sind - sind die Idole sehr stark an die Heimatländer geb<strong>und</strong>en.<br />
Es sind die Idole der „interkulturellen Zwischenwelten"<br />
(Gemende 2003), die man als eigene` in dem Land<br />
braucht, in dem man zwar geboren ist, in dem man aber immer<br />
wieder fühlt, dass man nicht so richtig zum Zuge kommt.<br />
120<br />
as Homosexualitätstabu sitzt heute - trotz aller Liberalisierung<br />
- noch tief. Gerade in der inneren Auseinandersetzung<br />
<strong>des</strong> Jungen mit sich selbst <strong>und</strong> seinem Mannwerden, aber genauso<br />
im Kontrollhandeln der Eltern sowie im Integrations<br />
druck der sozialen Umwelt entfaltet es seine blockierenden<br />
psychosozialen Wirkungen. In ihm ist die Verkettung der sexuellen<br />
Natur <strong>des</strong> Menschen mit sozialen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Bezügen konfliktreich ausgeprägt. Dass dieses Tabu vor<br />
allem Jungen <strong>und</strong> junge Männer trifft, bei Mädchen eher übergangen<br />
wird, verweist auf die besondere Verfügbarkeit <strong>des</strong><br />
Mannes im industriekapitalistischen Verwertungsprozess.<br />
Nicht von ungefähr wurde das Homosexualitätstabu zu Beginn<br />
der industriellen Modernisierung <strong>und</strong> heterosexuellen<br />
Matrix der Arbeitsteilung virulent: „Die gleichgeschlechtliche<br />
Sexualpraxis wurde erst, als sie nicht mehr in eine zugespitzte<br />
Geschlechterdichotomie passte <strong>und</strong> sie zu sprengen drohte,<br />
massiv verrätselt. Die Konstruktion der Homosexualität bestand<br />
vor allem in der Etablierung eines Erklärungsbedarfs"<br />
(Hirschauer 1992, S. 338).<br />
Diese Spannung zur Heterosexualität ist bis heute das Gr<strong>und</strong>problem<br />
der Anerkennung der Homosexualität, aber auch der<br />
homosexuellen Lebensführung <strong>und</strong> Lebensbewältigung selbst,<br />
die darin befangen ist. Erst in der gegenwärtigen „modernwestlichen<br />
Homosexualität" beginnt sich dieser Konflikt zumin<strong>des</strong>t<br />
im subjektiven Sexualempfinden schwuler Männer<br />
aufzulösen. Die Menschen beziehen sich nun „in der vollen<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Geschlechts aufeinander. Der Schwule begehrt<br />
in dem anderen den Mann, die Lesbe in der anderen die Frau -<br />
<strong>und</strong> keine Zwischenstufe' [...] Als Mann deal Mann [...] in sexuelle<br />
Interaktion zu verstricken - erst das macht die schwule<br />
[...] Situation aus" (Lautmann 2002, S. 396).<br />
Auch die Psychoanalyse, die sich seit Freud um die Bestimmung<br />
der Homosexualität primär aus den frühkindlichen Objektbeziehungen<br />
heraus bemüht hat <strong>und</strong> damit genauso heterosexuell<br />
befangen blieb, schwenkt heute in ein multifaktorielles<br />
Erklärungsmodell ein, in dem anlagebedingte Faktoren, psychosexuelle<br />
Entwicklungsmuster <strong>und</strong> familiale <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Reaktionen aufeinander bezogen werden. Dabei
wird inzwischen argumentiert, dass die Annahme einer spezifischen<br />
Verstrickung in der Mutterbeziehung, die in der traditionellen<br />
Psychoanalyse als zentral für frühkindliche Konstitution<br />
von Homosexualität galt, nicht das ausschlaggebende<br />
Moment sei, sondern die <strong>Zur</strong>ückweisung der homosexuellen<br />
Disposition durch den Vater, dem sich der homosexuell veranlagte<br />
Junge ab der Phase der frühkindlichen Triangulation zuwendet.<br />
Erst dann können Verstärkungen in der Beziehung<br />
zur Mutter <strong>und</strong> negative Projektionen auf den Vater (<strong>und</strong> damit<br />
auf die eigene erwachte homoerotische Sehnsucht) entstehen.<br />
Die entstandene Abhängigkeit <strong>und</strong> Hilflosigkeit gegenüber<br />
der Mutter sowie die <strong>Zur</strong>ückweisung durch den Vater<br />
fuhren zu einem „autoerotischen" Entwicklungsmuster, in<br />
dem der Junge in der Distanz zu den Elternfiguren die Balance<br />
<strong>und</strong> das Wohlbefinden wieder für sich herstellt. Dieses sexuelle<br />
Autonomiestreben steht damit in einem deutlichen Kontrast<br />
zu dem heterosexuellen Identitätsmodell der friangulation<br />
(vgl. dazu Askitis 1996).<br />
Väter geraten dann auch in ihrer männlichen Außenorientierung<br />
in Panik, wenn sie glauben oder erfahren, dass ihr Junge<br />
schwul ist oder sein könnte, dass er also nicht funktioniert,<br />
dass damit die Familie nicht funktioniert <strong>und</strong> letztendlich auch<br />
er als Vater funktionell versagt hat. Die soziologische Dimension<br />
<strong>des</strong> Hornosexualitätstabus <strong>und</strong> die psychoanalytische<br />
imension der familialen <strong>Zur</strong>ückweisung können also ineinander<br />
übergehen. Bei dem Jungen, selbst wenn er später seine<br />
eigene Homosexualität entdeckt, kann sich im Banne der<br />
Empfindung dieser inneren <strong>und</strong> äußeren „Ausstoßung" massive<br />
Beschämung <strong>und</strong> Scham entwickeln, die aber im Kontakt<br />
mit der sozialen Umwelt - vor allem in der Gleichaltrigenkultur<br />
- verleugnet werden müssen, um sozial handlungsfähig zu<br />
bleiben. „Die Verleugnung der Scham ändert die reale Situation<br />
nicht, aber das Bewusstsein geht in phantasierte Höhen:<br />
ealität <strong>und</strong> Phantasie fallen immer weiter auseinander. Das<br />
wird auch in Beziehungen spürbar: Ein so gekränkter Mensch<br />
wird sich in Beziehungen sehr verletzbar fühlen, weil er im<br />
realen Kontakt wieder reit seinen abgewerteten Seiten in Kontakt<br />
kommen könnte" (Askitis 1996, S. 337). Dies wirkt wiederum<br />
auf die Beziehungen zurück, die dann so verzerrt sein<br />
können, dass sie die Scham auf der Seite <strong>des</strong> schwulen Jungen<br />
122<br />
<strong>und</strong> das entsprechende "Tabu bei seinen Fre<strong>und</strong>en nur noch<br />
weiter verstärken <strong>und</strong> verfestigen.<br />
Ausschlaggebend für das tiefenstrukturelle familiale <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Wirken <strong>des</strong> Homosexualitätstabus ist aber nicht<br />
nur der Fakt Homosexualität, sondern das (zurückgedrängte)<br />
Missen darüber, dass nach der Logik der Konstitution der Geschlechter<br />
alle Männer im Verlauf der Geschlechtssozialisation<br />
homoerotische Anteile besitzen <strong>und</strong> entwickeln. Diese Anteile<br />
- die seelisch-körperliche Sehnsucht nach dem Vater in<br />
der frühkindlichen Phase, die gemeinsame autoerotische Praxis<br />
- z.B. Onanie - zwischen Fre<strong>und</strong>en in den Cliquen - dürfen<br />
nicht unterdrückt, sondern müssen gerade ausgelebt werden,<br />
auch um in eine heterosexuelle Identitätsbalance kommen zu<br />
können, die Maskulinität nicht nur über die Frau empfindet.<br />
as Homosexualitätstabu stört <strong>und</strong> blockiert dieses notwendige<br />
Entwicklungssegment, führt dazu, dass Jungen Gefühle<br />
<strong>und</strong> körperliche blähe untereinander verwehrt wird, dass sie es<br />
abspalten müssen, gerade weil sie sich danach sehnen.<br />
Im Erwachsenenalter scheinen die homoerotischen Segmente<br />
bei der Mehrheit der heterosexuellen Männer weitgehend sublimiert,<br />
d.h. in funktionelle Verhaltensintensitäten umgewandelt.<br />
blicht umsonst spricht man im globalisierten Kapitalismus<br />
mit seiner Shareholder-value-Mentalität von der Erotik<br />
<strong>des</strong> Gel<strong>des</strong>', so wie man im Alltag bei Männern von der Erotik<br />
der Autos' <strong>und</strong> der Geschwindigkeit spricht. Gleichzeitig<br />
wird auch im Konsum das homoerotische Element immer<br />
wieder ästhetisiert. Homosexualität ist heute vor allem in der<br />
sozialen Mitte leidlich toleriert - ausgenommen die sozialen<br />
Randgruppen, in denen Ablehnung <strong>und</strong> Abwertung der Homosexualität<br />
immer noch zum Aufbau von Männlichkeit gebraucht<br />
wird -, sie ist aber nicht gesellschaftsfähig geworden.<br />
Um dies erklären zu können, hilft uns unser Modell der Entkoppelung<br />
von Systemischem <strong>und</strong> Lebensweltlichem, weiter.<br />
In den Lebenswelten müssen heute die systemischen Imperative<br />
nicht mehr an den Menschen unvermittelt durchgesetzt<br />
werden, auch systemische dysfunktionale Prinzipien können<br />
im Alltag gelebt oder lebensweltlich toleriert werden. Zudem<br />
hat das Heraufziehen einer systemisch vorangetriebenen Erfolgskultur<br />
die Konkurrenzbeziehungen ästhetisiert <strong>und</strong> es<br />
123
macht in dieser Erfolgssymbolik keinen Unterschied mehr, ob<br />
die Gewinner oder Verlierer nun heterosexuelle Männer,<br />
Frauen oder homosexuelle Männer oder Frauen sind. Dennoch<br />
bleibt das Homosexualitätstabu weiter in den Familien hängen,<br />
denn es existiert ein diffuser systemischer Druck in der<br />
Durchsetzung von Heterosexualität. Dieser äußert sich vor allem<br />
dann, wenn es um die demographische Krise geht, wenn<br />
z.B. die „Babylücke" in dem Sinne öffentlich thematisiert<br />
wird, dass mit dem Rückgang der Geburten <strong>und</strong> der demographischen<br />
Schwächung der nachfolgenden Generation die Renten<br />
<strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heitskosten nicht mehr bezahlbar seien.<br />
Aus dieser gesellschaftlichen Diskussion sind Schwule von<br />
vornherein - genannt oder ungenannt - ausgeschlossen. Die<br />
Mütter <strong>und</strong> Väter aber wollen ihre Jungen gesellschaftsfähig<br />
machen <strong>und</strong> bleiben so weiterhin gespalten: Während also in<br />
den privaten familialen Beziehungen die Tendenz zum Verständnis<br />
<strong>und</strong> Einfühlen in die Situation <strong>des</strong> Jungen steigt,<br />
bleibt dennoch die Hoffnung erhalten, dass der Junge ein gesellschaftsfähiger,<br />
d.h. ein ,richtiger', normaler' <strong>und</strong> damit<br />
ein heterosexuell orientierter Mann wird.<br />
Insofern bleibt gerade im Jugendalter nicht nur der soziale<br />
Druck auf die innere Spannung von homoerotischen Anmutungen<br />
<strong>und</strong> heterosexuellen Vergewisserungen erhalten, sie<br />
wird auch durch das somatische Verwirrspiel der Pubertät<br />
(s.o.) aufgeladen. Für Jungen selbst ist die Homosexualität<br />
immer noch eine heikle Zone der Körperlichkeit. „Schwul" ist<br />
ein weit verbreitetes Schimpfwort, aber es ist nicht mehr das<br />
Stigma, das alte Tabu, das es früher war. Dennoch ist Schwulenfeindlichkeit<br />
- nicht nur bei sozial benachteiligten Jungen -<br />
nicht verschw<strong>und</strong>en, sie taucht immer wieder dann auf, wenn<br />
die Jugendlichen mit ihrer eigenen Sexualität nicht zurecht<br />
kommen. In dem Schimpfwort „schwul" ist also bei<strong>des</strong> enthalten:<br />
Zum einen die Angst davor, nicht als heterosexueller<br />
Mann zu funktionieren, gleichzeitig aber auch die Neugier auf<br />
verwehrte Sexualität. Das Schimpfwort ist also eine Folie, mit<br />
der gar nicht so sehr die homosexuellen gemeint sind, obwohl<br />
es durchaus immer wieder Situationen gibt, die zu Aggressivität<br />
gegen Homosexuelle führen können. Hier wirkt wieder der<br />
Bewältigungsmechanismus der Abspaltung der eigenen Hilflosigkeit.<br />
„Schwul" bleibt aber ein Ausdruck für nicht nor-<br />
mal', nicht männlich', ist als tiefsitzender Abwertungsbegriff<br />
resistent, obwohl er gleichsam jugendkulturell auf der Kippe<br />
steht: Er wird einerseits unbefangen gebraucht lind ist andererseits<br />
wieder mit Angst <strong>und</strong> Unsicherheit besetzt. Die<br />
Gr<strong>und</strong>angst vieler männlicher Jugendlicher ist dabei, nicht als<br />
„richtiger Mann" zu funktionieren. Deshalb suchen sie auch<br />
immer wieder Bilder <strong>des</strong> Funktionierens, greifen auch zu Pornos,<br />
die ihnen aber dann nicht weiterhelfen, denn je eindeutiger<br />
die Milder sind, <strong>des</strong>to weniger taugen sie, um einem die<br />
eigene Angst vor dem Nichtfunktionieren zu nehmen. Die<br />
damit verb<strong>und</strong>ene latente Hilflosigkeit <strong>des</strong> männlichen Jugendlichen<br />
bleibt gerade auch in einer Welt bestehen, in der es<br />
keine sexuellen Tabus mehr gibt <strong>und</strong> alles aufs Erklärenkönnen<br />
<strong>und</strong> Funktionierenmüssen drängt. Gleichzeitig ist es angesichts<br />
eines nivellierten Geschlechterverhältnisses in den Bildungs-<br />
<strong>und</strong> Jugendkulturen für Jungen immer weniger möglich,<br />
ihre innere männliche Identitätsdiffusion in maskulinem<br />
ominanzverhalten abzuspalten. Deshalb sind - gerade auch<br />
in der Schule - Räume, Beziehungen <strong>und</strong> kulturelle Ausdruck,.,formen<br />
notwendig, in denen diese männliche Hilflosigkeit<br />
anerkannt <strong>und</strong> kreativ umgewandelt werden kann. Insofern<br />
ist das Jugendalter in der Phase der Pubertät trotz aller<br />
jugendkulturellen Überformung <strong>und</strong> Nivellierung immer noch<br />
die Zeit der „zweiten Chance", in der sich Männlichkeit <strong>und</strong><br />
Mannsein aus der Betroffenheit <strong>des</strong> eigenen Selbst heraus entwickeln<br />
können.<br />
3.4 Mütter <strong>und</strong> Söhne, Mädchen <strong>und</strong> Jungen,<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer<br />
it der ambivalenten Familienposition <strong>des</strong> Vaters wächst die<br />
familiale Macht der Mutter, der man alltagswirklich begegnen<br />
kann, die den Jungen zwar loslassen, gleichzeitig aber auch<br />
den Vater in der Familie aufbauen <strong>und</strong> hochhalten muss. So<br />
ist ihre Macht eine doppelte geworden: Sie konfrontiert den<br />
Vater nicht nur mit ihrer Überlegenheit bei der Geburt <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong>, sondern auch damit, dass es von ihr abhängig ist, wie<br />
der Vater in die Familie eingeführt, wie er aufgebaut <strong>und</strong><br />
hochgehalten wird. Der Psychoanalytiker Martin Lukas Moel-
ler sprach <strong>des</strong>wegen von einem modernen Männermatriarchat<br />
im Kleinen: „Die Männergesellschaft hinterlässt zu Hause in<br />
Form einer Mutter-Kind-Union ein Miniaturmatriarchat. Da<br />
dieses Matriarchat doch das genetische Milieu der Kinder darstellt,<br />
prägt die Mutter fast ausschließlich ihre Söhne <strong>und</strong> damit<br />
die später herrschenden Männer. Mit anderen Worten: In<br />
der vaterlosen Gesellschaft, wider Willen isoliert, bestimmt<br />
nur noch die Mutter die Entwicklung zum Mann" (1983, S.<br />
214).<br />
Im Kapitel zur „Entgrenzung der Männlichkeit" wurde schon<br />
die Frage gestellt, ob der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft<br />
nicht Räume <strong>und</strong> Gelegenheiten schafft, die familialen<br />
Geschlechterkonstellationen so zu verändern, dass Väter mehr<br />
anwesend sein <strong>und</strong> früh in die alltäglichen Beziehungs- <strong>und</strong><br />
Erziehungsbereiche eintreten könnten, so dass die ideologisch<br />
tradierte Figur der Mutterliebe ihren Gegenpol in der Vaterliebe<br />
fanden, dadurch gleichsam entlastet werden <strong>und</strong> in eine<br />
,frühkindliche Elternschaft' münden kann. Die Aussichten dafür<br />
scheinen ganz unterschiedlich zu sein. Es gibt Familien,<br />
die von ihren ökonomischen <strong>und</strong> sozialen Möglichkeiten her<br />
dieses Ziel eher realisieren können, <strong>und</strong> es gibt wiederum eine<br />
Menge Familien, in die der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft<br />
nur noch mehr Druck hervorruft, der bewirkt, dass sich<br />
die Mütter noch mehr an ihre Kinder klammern <strong>und</strong> die Väter<br />
es noch schwerer haben, in die Familie hineinzukommen.<br />
Denn für viele, vielleicht für den Großteil der Bevölkerung,<br />
bringt die technologische Entwicklung der Arbeitsgesellschaft<br />
mit der gleichzeitigen Intensivierung der Arbeit <strong>und</strong> der Freisetzung<br />
von Menschen in die Arbeitslosigkeit eher eine weitere<br />
Überforderung denn Entlastung der Familie. Zum einen engen<br />
die Rationalisierungsprozesse der Arbeitswelt die betrieblichen<br />
Räume - vor allem bei weniger qualifizierten Arbeitsvorgängen<br />
- ein, in denen soziale <strong>und</strong> emotionale Beziehungen<br />
außerhalb <strong>des</strong> Produktionszwecks möglich waren, so dass<br />
die Familie zum zentralen <strong>und</strong> oft einzigen Ort der Verheißung<br />
geworden ist: Partnerschaft <strong>und</strong> Familie sollen das bringen,<br />
was in der Arbeitswelt nicht mehr möglich ist: Emotionalen<br />
Rückhalt, Zuwendung, Geborgenheit. Damit entsteht ein<br />
ruck in den Familien, vor allem dann, wenn die Familienmitglieder<br />
selbst Schwierigkeiten haben, sich als Familie zu<br />
12 6<br />
begreifen <strong>und</strong> eher ihre individuellen Interessen in der Familie<br />
zu verwirklichen versuchen. In solchen emotionalen Überforderungskonstellationen<br />
der Familie versuchen die einzelnen<br />
Mitglieder, ihre Interessen an Familie zu realisieren. Die Kinder<br />
sind dabei die schwächsten Glieder. Mütter forcieren dann<br />
oft die symbiotische Mutter-Sohn-Beziehung über das frühkindliche<br />
Alter hinaus, möchten sich im <strong>und</strong> am Kind<br />
verwirklichen, lassen nun erst recht nicht los. Väter reklamieren<br />
den emotionalen Besitz an der Familie nicht über<br />
Zuwendungen, sondern über Forderungen bis hin zur Gewalt.<br />
Arbeitslose Väter wiederum können selten ihre nun freigesetzte<br />
Zeit nutzen, um in der Familie <strong>und</strong> für den Sohn (bzw. die<br />
"Tochter) emotional anwesend zu sein. Aus entsprechenden<br />
Untersuchungen wissen wir, wie arbeitslose Väter weiterhin<br />
versuchen ihre externalisierte Arbeitsrolle, die sie nun verloren<br />
haben, durch Außenaktivitäten zu kompensieren <strong>und</strong> der<br />
Familie gegenüber das Bild <strong>des</strong> externen Vaters <strong>und</strong> damit das<br />
klassische hierarchische Modell der Familienmacht<br />
aufrechtzuerhalten (vgl. dazu Bründel/Hurrelmann 1999). Aber<br />
auch die arbeitslosen Väter, die sich emotional in die Familie<br />
hineinbegeben wollen, haben ihre Schwierigkeiten: Zum einen<br />
haben sie nicht gelernt, dieses Vatersein in Stärken <strong>und</strong><br />
Schwächen einzubringen, <strong>und</strong> es fällt ihnen erst recht in einer<br />
Zeit schwer, in der sie mit der Arbeit auch viel an Selbstwert<br />
verloren haben. Zum anderen verteidigen die Mütter Familie<br />
<strong>und</strong> Haushalt als ihre emotionale Machtbasis <strong>und</strong> sehen den<br />
nun darin eindringenden Vater mit seiner Bedürftigkeit erst<br />
einanal als Fremdkörper an.<br />
Angesichts dieser Einschätzungen zur Gesellschaftsentwicklung<br />
ist davon auszugehen, dass das problematische Mutter-<br />
Sohn-Modell <strong>und</strong> das aus ihm heraus verlängerte Männer- <strong>und</strong><br />
Frauenmodell in seiner Unfertigkeit <strong>und</strong> Gestörtheit auf unabsehbare<br />
Zeit weiterhin die Struktur <strong>des</strong> Geschlechterverhältnisses<br />
bestimmen wird. „Die Mutterherrschaft wirkt sich auf<br />
Söhne viel belastender aus als auf Töchter [...], diese haben es<br />
leichter, sich mit der einzig verbliebenen Person, der aus<br />
Ohnmacht dominanten Mutter, zu identifizieren. Die Söhne<br />
geraten in größere Widersprüche. Mit dem ausschließlichen<br />
Vorbild Mutter, die sie verinnerlichen, nimmt ihre Weiblichkeit<br />
zu. Schon heute ist zu fragen, inwieweit Männlichkeit<br />
127
nicht nur die Abwehr der notgedrungen weiblichen Verinnerlichungen<br />
ist, mit denen die Männer allein nicht auskommen"<br />
(Möller 1983, S. 232). Aus dieser Mangelsituation resultiert -<br />
wir haben es bereits am Fall <strong>des</strong> Aufwachsens von Jungen beschrieben<br />
- die Idolisierung <strong>des</strong> Männlichen <strong>und</strong> damit zwangsläufig<br />
die Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen. Jungen <strong>und</strong> Männer haben<br />
es dadurch schwer, ein selbstbestimmtes, das heißt aus dem<br />
Selbst kommen<strong>des</strong> Verhältnis zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen<br />
aufzubauen. Sie agieren - unterschiedlich bewältigt - immer<br />
wieder in Abhängigkeit von Müttem <strong>und</strong> Frauen oder besser:<br />
in Abhängigkeit von einer Konstellation, die nicht aus dem<br />
Machtstreben der Mutter, sondern ihrer Zwangslage heraus<br />
entspringt. Insofern ist die Abhängigkeit der Männer von<br />
Frauen <strong>und</strong> die gleichzeitige männliche Abwertung der Frau<br />
im Alltag schwer thematisierbar, weil es ein tiefenstrukturelles<br />
Phänomen ist, das den männlichen <strong>und</strong> weiblichen Akteuren<br />
so überhaupt nicht bewusst sein kann. Es tritt - wie alles Tiefenpsychische<br />
- an der Oberfläche der Verhaltensweise ganz<br />
anders auf <strong>und</strong> wird von den Menschen auch entsprechend<br />
anders gedeutet. So ist das Verhältnis von Männern <strong>und</strong> Frauen<br />
ein spannungsreiches Magnetfeld, <strong>des</strong>sen Kräfte im Verborgenen<br />
wirken <strong>und</strong> es so im Alltag oft zum grotesken Verwirrspiel<br />
werden lassen.<br />
as können wir früh beobachten, wenn sich Jungen <strong>und</strong> Mädchen<br />
einander nähern <strong>und</strong> damit - nach der frühkindlichen<br />
Phase - zum ersten Mal wieder hoffnungsvoll <strong>und</strong> hoffnungslos<br />
zugleich in das Magnetfeld Mann-Frau-Beziehung geraten.<br />
Schon im vorpubertären Kin<strong>des</strong>alter - zwischen 10 <strong>und</strong> 12<br />
Jahren - ist es mit der kindlichen Geschlechterharmonie vorbei.<br />
Da Mädchen sich schneller entwickeln <strong>und</strong> früher in die<br />
Pubertät eintreten, wenden sie sich älteren Jungen zu. Das<br />
versetzt die gleichaltrigen Buben in wütende Hilflosigkeit, die<br />
sie dann oft in sexistische Mädchenanmache <strong>und</strong> Frauenabwertung<br />
abspalten. Der Kreisel von Idolisierung <strong>des</strong> Maskulinen<br />
<strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen beginnt sich nun stärker<br />
zu drehen. So hat sich dann zu Beginn der Pubertät bereits ein<br />
doppeldeutiges Mädchen- <strong>und</strong> Frauenbild festgesetzt, das in<br />
der Jungenclique seine Bestätigung <strong>und</strong> Verankerung sucht.<br />
Hier kommen Jungen zusammen, die fast alle in unterschiedlicher<br />
Weise das Problem mit sich herumtragen, dass sie im-<br />
128<br />
mer noch auf der Suche nach sich als Mann sind <strong>und</strong> in dieser<br />
Suche nicht fündig werden, weil sie in dieses Hin- <strong>und</strong> Hergerissensein<br />
zwischen der Anziehung hin zum <strong>und</strong> Abwertung<br />
<strong>des</strong> Weiblichen geraten sind (vgl. Kap. 3.7).<br />
In diesem Gruppenklima gedeihen auch jene stereotypen Einstellungen<br />
der männlichen Bewertung von Frauen, derer sich<br />
Männer im Laufe ihres Lebens immer wieder bedienen <strong>und</strong> in<br />
denen auch wieder das Gr<strong>und</strong>muster von Anziehung <strong>und</strong> Abwertung<br />
aufscheint: Die unnahbare, nie erreichbare "Traumfrau<br />
auf der einen Seite, das Sexualobjekt, die benutzbare Hure auf<br />
der anderen. Auch dies erschwert wieder Kommunikation mit<br />
Mädchen <strong>und</strong> Frauen, weil Jungen <strong>und</strong> Männer oft ihr Kontrollverhalten<br />
gegenüber Mädchen <strong>und</strong> Frauen an diesen Stereotypen<br />
<strong>und</strong> ihrer unüberbrückbaren Spannung ausrichten. In<br />
Krisensituationen der Partnerschaft <strong>und</strong> natürlich bei der<br />
Scheidung brechen diese Stereotype nicht selten wieder aus<br />
den Männern heraus.<br />
Die Urangst <strong>des</strong> männlichen Geschlechts<br />
„Gerade die körperliche Beschaffenheit <strong>des</strong> Mannes legt ihm<br />
Schranken auf, nur ihm, nicht aber der Frau. Seine Fähigkeit<br />
zum Sexualgenuss ist an die Erfüllung bestimmter physiologischer<br />
Bedingungen geknüpft, die ihre ist es nicht. Seine Funktionsmöglichkeit<br />
ist an das Steifwerden <strong>des</strong> männlichen Glie<strong>des</strong><br />
geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> daher beschränkt, die ihre ist unbeschränkt.<br />
[...] Damit liegt zweifellos eine Begünstigung der Frau vor.<br />
[...] Lind so hat sich auch in der männlichen Psyche eine starke<br />
Bewertung dieser Unterscheidung festgesetzt <strong>und</strong> damit<br />
zugleich ein Zwang zur Überkompensation. Aus dem Bewusstsein<br />
<strong>des</strong> Mannes von der physiologischen Überlegenheit<br />
der Frau im sexuellen Genuss hat sich bei ihm ein ganzer<br />
Angstkomplex entwickelt, <strong>des</strong>sen Ausstrahlung sich bis in die<br />
letzte Verästelung nicht nur unseres Sexual-, sondern <strong>des</strong> gesamten<br />
Kulturlebens fühlbar macht. Es ist die Angst vor dem<br />
Versagen, vor der sexuellen Niederlage. Als individuelle Erscheinung<br />
ist diese Angst <strong>des</strong> Mannes vor zeitweiliger oder<br />
dauernder Impotenz zur Genüge bekannt.[ ...] Aber durchaus<br />
nicht nur der einzelne Mann, sondern die männliche Psyche in<br />
ihrer Gesamtheit lebt unter dem Druck der gleichen Angst <strong>und</strong><br />
man kann das männliche Weltbild gar nicht verstehen, wenn<br />
129
man diesen Faktor übersieht, diese Urangst <strong>des</strong> männlichen<br />
Geschlechts." So ließ sich „der Mann durch die größere physiologisch-sexuelle<br />
Tüchtigkeit der Frau [...] in ein Gefühl der<br />
Angst vor Minderwertigkeit <strong>und</strong> in unzweckmäßige Überkompensation<br />
verlocken [...], die ihn zum Herabsetzungsprinzip<br />
gegenüber der weiblichen Sexualität [...] geführt hat" (Lazarsfeld<br />
1931, S. 80/81). Diese seit der sexualwissenschaftlichen<br />
Diskussion der 1920er Jahre (vgl. auch Hirschfeld 1930)<br />
so ausgemachte sexuelle „Urangst" <strong>des</strong> Mannes vor der Frau<br />
wird auch immer wieder mit der Gebärfähigkeit in Zusammenhang<br />
gebracht. Von den Naturvölkern wurde der weibliche<br />
Gebärvorgang als Ausdruck einer naturmythischen Macht<br />
der Frau gedeutet. Man hatte ja zurzeit der Stammeskulturen<br />
noch nicht die uns heute geläufigen medizinischen Kenntnisse<br />
<strong>und</strong> konnte sich Menstruation, Zeugung <strong>und</strong> Gebären nur mythologisch<br />
vorstellen. Entsprechend haben Männer seit dieser<br />
Zeit versucht, eine soziale Gegenmacht zu dieser „Naturmacht"<br />
der Frau aufzubauen, die später in der Weise kulturell<br />
institutionalisiert wurde, dass man(n) die weibliche ,Naturnähe'<br />
in eine Naturgeb<strong>und</strong>enheit' umdefinierte. Der konnte<br />
dann die männliche' Rationalität der Naturbeherrschung' gegenübergestellt<br />
<strong>und</strong> somit die geistige <strong>und</strong> soziale Unterlegenheit<br />
der Frau behauptet werden. „Aus dem Geschlechterunterschied<br />
folgt die Angst der Männer vor den Frauen, vor der<br />
mythischen Baubokratie. Das ist ein drängen<strong>des</strong> Motiv, das<br />
soziale Patriarchat, in welcher historischen Form auch immer,<br />
zu verteidigen <strong>und</strong> zu erneuern" (Gottschalch 1991, S. 115).<br />
Dass dies auch heute noch nicht ausgestanden ist, zeigt nicht<br />
nur die immer wieder neu aufblühende populistische Literatur<br />
zur genetischen Legitimation geschlechtsdichotomer Temperamente<br />
<strong>und</strong> Fähigkeiten, sondern auch die alltäglichen Dramen,<br />
in denen diese „Urangst" <strong>des</strong> Mannes gleichsam archetypisch<br />
durchscheint: Bei der Geburt <strong>des</strong> ersten Kin<strong>des</strong>; bei<br />
kritischen Lebensereignissen, wie der Scheidung, wo es um<br />
Mutterschafts- <strong>und</strong> Vaterschaftsrechte geht, aber auch in alltäglichen<br />
Konflikten, in denen sich konferenzdressierte Männer<br />
durch emotionale Ausbrüche von Frauen, welche die<br />
männlichen Rituale nicht mitmachen wollen, düpiert fühlen<br />
<strong>und</strong> schnell zu Etikierungen wie „unsachlich" oder „hysterisch"<br />
greifen.<br />
13 0<br />
Beziehungen zu Mädchen <strong>und</strong> später zu Frauen sind immer<br />
wieder von diesem Hin- <strong>und</strong> Hergerissensein bestimmt <strong>und</strong><br />
erscheinen <strong>des</strong>halb für viele Männer riskant, angstbesetzt.<br />
Diese Angst muss abgespalten <strong>und</strong> in äußeres Dominanzverhalten<br />
umgesetzt werden. Wo keine Verständigung mit den<br />
Frauen gelingt, wo das Dominanzverhalten nicht einschlägt,<br />
bleibt nur der Rückzug in die männliche Einsamkeit. Das<br />
Schweigen der Männer über sich selbst <strong>und</strong> Frauen gegenüber<br />
ist ein Ausdruck dieser Einsamkeit. Es ist aber nicht die Einsamkeit<br />
der Gefühle, sondern die harte Einsamkeit <strong>des</strong>sen, der<br />
allein gegenüber der (Frauen)Welt steht <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb noch härter<br />
mit sich <strong>und</strong> anderen sein muss. Dicht von ungefähr ist das<br />
ild <strong>des</strong> „Lonesome Cowboy" bei sich dominant <strong>und</strong> hart gebenden<br />
Männern so beliebt.<br />
Wenn dann die feste Fre<strong>und</strong>in da ist, eine längere Partnerschaft<br />
beginnt oder nach einiger Zeit sogar geheiratet wird,<br />
glättet das Aufeinanderangewiesensein <strong>und</strong> der Verständigungszwang<br />
über das Gemeinsame die männlichen Wogen<br />
<strong>des</strong> Hin- <strong>und</strong> Hergerissenseins. Dennoch wirkt das zwiespältige<br />
Mutter-Sohn/Mann-Frau-Modell weiter. Denn in der Partnerschaft<br />
prallen ja zwei unterschiedliche Geschlechterkulturen<br />
aufeinander. Viele junge Männer schwanken weiterhin<br />
zwischen dem Hin- <strong>und</strong> Hergerissensein von Gefühlsbeziehung<br />
<strong>und</strong> umso heftigerer Abwertung der romantischen Liebe,<br />
die aber viele Mädchen/Frauen - zumin<strong>des</strong>t am Anfang der<br />
Partnerschaft oder Ehe - von den Männern erwarten. Und da<br />
es Männer - von ihren biografischen Erfahrungen in Kindheit<br />
<strong>und</strong> Jugend her - schwer haben, mit Gefühlsbeziehungen außerhalb<br />
von Sondersituationen, also im Alltag, umzugehen,<br />
pendelt sich bald das externalisierte Verhalten wieder ein: Die<br />
Beziehung, die Ehe <strong>und</strong> später die Familie soll „funktionieren",<br />
daran misst sich der Mann, daran - so glaubt er - wird er<br />
gemessen. Die Frauen - auch wenn sie berufstätig sind - ziehen<br />
sich dann oft wieder in das Innere der familialen Beziehungsarbeit<br />
zurück, festigen ihre emotionale Binnenmacht<br />
bewusst oder unbewusst auch gegenüber ihren Männern. Diese<br />
wiederum können - von ihrem externalisierten Funktionsverständnis<br />
her - die Gefühle <strong>und</strong> Sehnsüchte, die sie in der<br />
Familie stillen möchten, dann erst recht nicht entsprechend<br />
mitteilen. Männliche Bedürftigkeit <strong>und</strong> weibliche Enttäu-
schung machen sich in vielen Familien breit, können dann in<br />
kritischen Familiensituationen folgenreich aufbrechen.<br />
Männer können also - bildhaft gesprochen - Frauen nicht entrinnen.<br />
Die Macht der Mutter ist weiter in ihnen. Um gleich<br />
vorzubauen: Hier wird Müttern nicht die Schuld zugeschoben,<br />
dass sie dafür verantwortlich sind, wie sich Männer entwickeln.<br />
Moeller hat ja - in seinem Zitat zum Familienmatriarchat<br />
- auch ausdrücklich davon gesprochen, dass das „Widerwillen"<br />
der Beteiligten existiert, dass dies also ein struktureller<br />
Vorgang ist. Selbst Mütter, die ihre Söhne zu „anderen"<br />
Männern erziehen wollten, erzählen, dass sie irgendwann<br />
dann doch gemerkt haben, dass sie zwar von ihrer Intention<br />
her mit ihren Söhnen anders umgehen wollten, dass sie aber<br />
nicht über den Schatten ihrer widersprüchlichen Mutterrolle -<br />
den Jungen loslassen müssen <strong>und</strong> gesellschaftsfähig machen -<br />
springen konnten. So wird deutlich, wie diese für Söhne zwiespältige<br />
Rolle der Mütterlichkeit ein gesellschaftliches Muster<br />
ist. Daraufzielt auch der Bef<strong>und</strong> von Nancy Chodorow ab, die<br />
direkt den Begriff <strong>des</strong> „Mutteras" (mothering) gebraucht, um<br />
die typische Abhängigkeitskonstellation <strong>des</strong> Junge- <strong>und</strong><br />
Mannwerdens begreifen zu können: „In den isolierten Kleinfamilien<br />
heutiger kapitalistischer Gesellschaften erzeugt das<br />
Muttern der Frauen spezifische Persönlichkeitsmerkmale bei<br />
Männern [...] Es bereitet Männer auf ihre Teilnahme an einer<br />
männlich dominierten Familie <strong>und</strong> Gesellschaft vor, auf ihre<br />
geringere emotionale Beteiligung am Familienleben <strong>und</strong> auf<br />
ihre Mitwirkung in der kapitalistischen Arbeitswelt [...] Die<br />
Mütter führen die Väter bei den hindern als wichtige Figuren<br />
ein, sie bauen die Väter für die Kinder erst auf, um einen Ausgleich<br />
dafür zu schaffen, dass Kinder ihre Väter nicht im gleichen<br />
Maße wie ihre Mütter kennen lernen können. Gleichzeitig<br />
aber unterhöhlen sie seine Position sozialer Überlegenheit<br />
oder angemaßter Familienautorität" (1985, S. 234). Dies geschieht<br />
vor allem dadurch, dass die Mutter dem Jungen in ihrer<br />
alltäglichen Repräsentanz nahe ist <strong>und</strong> der Junge immer<br />
wieder spürt, dass der Vater in seiner emotionalen Bedürftigkeit<br />
im Binnenkreis der Familie letztlich doch immer wieder<br />
vom Entgegenkommen bzw. der Verweigerung der Mutter<br />
abhängig ist.<br />
132<br />
Die zwiespältige Abhängigkeit <strong>des</strong> Sohnes von der Mutter <strong>und</strong><br />
später <strong>des</strong> Mannes von der Frau bleibt auch dann, wenn sich<br />
die Jungen von der Mutter gelöst haben. Sie äußert sich darin,<br />
dass sie sich den emotionalen Zugang zu sich selbst immer<br />
wieder von der Mutter <strong>und</strong> später von der Frau erhoffen, weil<br />
sie ihn in ihrer externalisierten Welt selbst nicht herstellen<br />
können. Wird dann das verwehrte Selbst als Hilflosigkeit erlebt,<br />
äußert es sich nach außen in jenen Abspaltungen als Aggression<br />
Schwächeren gegenüber, wie wir sie bereits beschrieben<br />
haben oder nach innen in der Enttäuschung an der<br />
Mutter. Ich habe bei der Begleitung von Projekten, die mit<br />
kriminell gewordenen Jugendlichen gearbeitet haben, immer<br />
wieder diese übergroße <strong>und</strong> doppeldeutige Bedeutung der<br />
Mutter für den Jungen erlebt. Wenn es einmal gelungen war,<br />
mit den Jungen über sich selbst ins Gespräch zu kommen, nicht<br />
über das Delikt, sondern über ihre eigenen Ängste <strong>und</strong> Sehnsüchte,<br />
dann stand immer wieder die Enttäuschung an der Mutter<br />
im Vordergr<strong>und</strong>, vom Mater war so gut wie keine Rede.<br />
„Wie dem auch sei, der Hintergrand der Männlichkeit ist<br />
weiblich. Wir kommen alle aus dem Frauenschoß <strong>und</strong> sind in<br />
den ersten Jahren unseres Lebens auf Gedeih <strong>und</strong> Verderb von<br />
Frauen abhängig. Unser Selbst entdecken wir, wenn es einigermaßen<br />
gut geht, in den Augen unserer Mutter. Sie ist denn<br />
auch unser erstes Identifikationsobjekt. Natürlich ist der Junge<br />
von Geburt an männlichen Geschlechts, aber er erlebt sich zu<br />
Beginn seines Lebens seiner Mutter näher als dem Vater. Nur<br />
langsam <strong>und</strong> mühsam entwickelt er seine Geschlechtsidentität<br />
<strong>und</strong> bleibt auch später in seiner Sexualität oft unsicher, was er<br />
häufig unter demonstrativer Männlichkeit verbirgt. Das „Urgestein"<br />
der Männlichkeit ist eine [...] dünne Kruste" (Wilfried<br />
Gottschalch: Männlichkeit <strong>und</strong> Gewalt 1997, S. 27).<br />
Die Mutter-Sohn-Beziehung ambivalenter Abhängigkeit ist<br />
gleichsam zum Modell <strong>des</strong> durchschnittlichen Männer-<br />
Frauen-Verhältnisses in unserer Gesellschaft geworden. Es ist<br />
wiederum ein tiefendynamisches Verhältnis, das der Oberfläche<br />
sozialen Lebens verborgen bleibt <strong>und</strong> sich in den alltäglichen<br />
Handlungen der Männer so nicht äußert, sondern hinter<br />
ihnen versteckt ist. Barbara Franck hat in ihren Anfang der<br />
1980er Jahre veröffentlichten Gesprächsprotokollen mit Män-<br />
133
nerv zum Thema „Mütter <strong>und</strong> Söhne" das anhaltende Wirken<br />
dieser Beziehung in der Biografie von Männern herausgearbeitet.<br />
Dabei wird deutlich, dass das „Muttern" <strong>und</strong> die damit<br />
zusammenhängenden Abhängigkeiten <strong>des</strong> Sohnes in dem Maße<br />
das Leben von Jungen <strong>und</strong> später von Männern prägt, als<br />
der Vater abwesend <strong>und</strong> nicht greifbar ist. Man darf also nicht<br />
isoliert von der Mutter ausgehen, sondern muss die Stellung<br />
<strong>des</strong> Vaters zur Familie genauso in den Mittelpunkt der Argumentation<br />
stellen. Denn dort, wo die Väter früh in die familialen<br />
Beziehungen zum bind mit Gefühl <strong>und</strong> Zuwendung eintraten<br />
<strong>und</strong> sich den Jungen nicht nur in Stärken, sondern auch<br />
in Schwächen öffneten, hat sich bei den Jungen <strong>und</strong> später bei<br />
den Männern eine produktive Distanz zur Mutter entwickelt.<br />
Geborgenheit konnte hier bei Mutter <strong>und</strong> Vater erlebt werden.<br />
Diese gelungene „Triangulation" verhilft dem Jungen dazu,<br />
dass er zu sich selbst kommen kann, dass er die Mutter nicht<br />
abwerten muss, weil er von ihr abhängig ist <strong>und</strong> er das Männliche<br />
nicht idolisieren muss, weil der Vater für ihn über Gefühle<br />
nicht erreichbar ist.<br />
Häufiger ist bei uns aber immer noch jene Konstellation, in<br />
der die Mutter das kindliche Erleben der sozialen Beziehungswelt<br />
bestimmt <strong>und</strong> für den späteren Lebensweg beeinflusst:<br />
„Die Beziehung zur Mutter prägt die Frauenbeziehung<br />
also auf doppeltem Weg: Einmal wird die Frau wie die Mutter<br />
erlebt, das heißt, die Paar- bzw. Ehebeziehung wird wie eine<br />
Mutterbeziehung wahrgenommen. liier setzt sich die Mutter-<br />
Sohn-Beziehung schlichtweg fort. Darüber hinaus ist der Sohn<br />
jedoch auch mit der Mutter identifiziert <strong>und</strong> verhält sich<br />
manchmal den Frauen gegenüber so, wie seine Mutter sich<br />
ihm gegenüber verhalten hat" (Moeller 1983, S. 228/229).<br />
Wie bei allem, was wir hier an tiefenpsychischen Mechanismen<br />
diskutieren, hängt es von den sozialen Umständen ab,<br />
wie der Junge damit umgehen, dies bewältigen kann. Es muss<br />
nicht immer alles ausbrechen, aber es darf auch nicht vergessen<br />
werden, dass diese Mechanismen da sind <strong>und</strong> dass man<br />
sich mit ihnen immer wieder - wenn auch meist unbewusst -<br />
auseinandersetzen muss. Das Problematische an der Mutter-<br />
Kind-Dyade ist wohl, dass sie zu einer Zeit gesellschaftlich<br />
hochgehalten <strong>und</strong> verklärt wird, in der die gesellschaftlichen<br />
Systeme sich immer mehr von den Menschen entfernen <strong>und</strong><br />
<strong>und</strong>urchschaubarer werden. Je weiter aber dieser Prozess fortschreitet,<br />
<strong>des</strong>to mehr klammert man sich an das Feststehende,<br />
Unverrückbare, Verlässliche, das den Menschen immer noch<br />
Mensch sein lässt. Muttersein <strong>und</strong> Mütterlichkeit ist angesichts<br />
der steigenden Rationalisierung der gesellschaftszugewandten<br />
Lebensbereiche ausgangs <strong>des</strong> zwanzigsten Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
wieder ein hoher privater Wert geworden. Damit ist die<br />
Macht der Frauen über die Männer zu einer Zeit wieder im<br />
Ansteigen, zu der die gesellschaftlich-ökonomische Entwicklung<br />
externalisierter abläuft denn je. Dies geht zusammen,<br />
wenn das Weiblich-Mütterliche weiter zu einer Naturkonstante<br />
erklärt wird. So kann die Mütterlichkeit hochgehalten werden,<br />
ohne den externalisierten Fortschrittsgedanken zu <strong>des</strong>avouieren.<br />
3.5 Die ab- <strong>und</strong> anwesenden Väter<br />
In der von Männern über die Zeiten weg immer wieder neu<br />
thematisierten Zuschreibung der „Muttermacht" hat sich ein<br />
typisches Spannungsverhältnis zwischen Mutterschaft <strong>und</strong><br />
Vaterschaft aufgebaut: Die Vaterrolle war damit gleichsam in<br />
den Sog geraten, eine soziale <strong>und</strong> kulturelle Gegenmacht zur<br />
weiblichen Naturmacht' der Mutter aufzubauen. Indem der<br />
Mann seine Zeugungsmacht entgegenhielt <strong>und</strong> diese früh als<br />
lebenszeitüberdauernde Generationsmacht der Abkunft' <strong>und</strong><br />
der Nachkommenschaft' definierte, hat er versucht, symbolische<br />
Macht über Natur <strong>und</strong> Tod der Naturnähe <strong>und</strong> Naturverb<strong>und</strong>enheit<br />
der gebärfähigen Frau gegenüberzustellen. Diese<br />
männliche Mentalität, die Zeugungsmacht auszuspielen, ist<br />
zwar heute zivilisatorisch überformt, wirkt aber weiter <strong>und</strong><br />
wird vor allem in Konflikten <strong>des</strong> Geschlechterverhältnisses<br />
bloßgelegt. Gerade bei Scheidungen, wo es darum geht, wem<br />
die Kinder zugesprochen werden, steigt dieses Gefühl <strong>und</strong><br />
gleichzeitig die Bedrohung der gleichsam stammesväterlichen<br />
Zeugungsmacht bei vielen Männern auf. Wenn die Kinder der<br />
Frau zugesprochen werden, fühlen sich nicht wenige Männer<br />
dieser Generationsmacht beraubt <strong>und</strong> reagieren entsprechend<br />
aggressiv oder panisch. Dies wird aus Männerberatungsstellen<br />
immer wieder berichtet.<br />
13 5
er britische Natur- <strong>und</strong> Sozialphilosoph Bertrand Russell hat<br />
in den 1920er Jahren - damals als ein Zeitschema - auf diese<br />
nun gleichfalls naturmythische' Gegenkonstruktion der Vaterschaft<br />
hingewiesen: „Die Leistungen der Nachkommen eines<br />
Mannes sind gewissermaßen seine eigenen Leistungen<br />
<strong>und</strong> ihr Leben ist die Fortsetzung seines Lebens. her Ehrgeiz<br />
findet sein Ende nicht am Grabe, sondern kann durch die Geschlechterfolge<br />
der Nachkommen hindurch unbegrenzt verlängert<br />
werden [...] Das rein instinktive Element in der Eifersucht<br />
ist nicht annähernd so stark wie die meisten modernen<br />
Menschen annehmen. Die übertrieben starke Eifersucht bei<br />
patriarchalen Gesellschaften beruht auf der Furcht vor der Fälschung<br />
der Abkunft" (1929, S. 21122).<br />
hier finden wir wieder die naturmythische' Angst vor der<br />
Frau, die sich in der tiefenpsychischen Figur <strong>des</strong> Gebärneids<br />
ausdrückt. In der bürgerlichen Familie, in der Mann <strong>und</strong> Frau<br />
als Vater <strong>und</strong> Mutter eng aufeinander bezogen sind, ist dieses<br />
Motiv <strong>des</strong> Gebärneids alltäglich überformt, bricht aber bei<br />
einschneidenden oder kritischen partnerschaftlichen Lebensereignissen<br />
- Geburt, "Trennung - eigenartig, aber typisch wieder<br />
auf. Nicht umsonst ist die Figur <strong>des</strong> Gebärneids in der<br />
Psychoanalyse, die ja auf der Krisenthematik der bürgerlichen<br />
Kleinfamilie fußt, eines der zentralen Interpretationsmuster<br />
der väterlichen Statusangst. her männliche Machtanspruch als<br />
esitzanspruch auf die Nachkommenschaft war so immer<br />
wieder in fragiler Spannung gehalten durch diese ,naturmythische'<br />
Angst vor der Frau.<br />
Nun ist in diesen Zusammenhängen mehr enthalten, als nur<br />
eine familiale Autoritätskrise <strong>des</strong> Vaters. Väter, die für solche<br />
Spannungen in der Beziehung zur Partnerin <strong>und</strong> zu dem in der<br />
Mutter-Kind-Dyade verschmolzenem Kind sensibel sind,<br />
werden in ihrem Mannsein angerührt. Sie fühlen sich plötzlich<br />
draußen, aus der Familie vertrieben. In solchen Krisensituationen<br />
wird deutlich, dass die Verankerung <strong>des</strong> Vaters in der<br />
Familie der Industriegesellschaft auf der patriarchalen Ideologie<br />
<strong>und</strong> weniger auf einer Beziehungspraxis beruht. Die<br />
Selbstverständlichkeit <strong>des</strong> Vaters als Familienoberhaupt war<br />
in der Vergangenheit vom patriarchal strukturierten Staat gestützt.<br />
Dies gehörte zu den zentralen Bedingungen, um die ge-<br />
13 6<br />
sellschaftliche Reproduktionsaufgabe der Familie abzusichern.<br />
Die Familie sollte darauf ausgerichtet sein, die Arbeitskraft<br />
<strong>des</strong> Vaters alltäglich sozial <strong>und</strong> mental wiederherzustellen.<br />
Die Mutter hatte sich dieser ideologisch gestützten Vaterrolle<br />
unterzuordnen, sie hatte sich nicht selbst in der Familie<br />
zu entfalten, sondern den Vater zu vertreten, seine Normen<br />
durchzusetzen. Noch heute drohen Mütter mit dem Vater,<br />
wenn sie ihren Kindern etwas verbieten, sie zurechtweisen<br />
wollen.<br />
iese Selbstverständlichkeit der mütterlich immer wieder hergestellten<br />
familialen Anwesenheit` <strong>des</strong> räumlich abwesenden<br />
Vaters ist nicht erst in den letzten Jahren durchbrochen worden.<br />
Sie begann zu der Zeit brüchig zu werden, in der die Modernisierung<br />
der Industriegesellschaft zur Krise der Familie<br />
geführt hat. Dabei ging es nicht nur um eine Überforderung<br />
der Familie durch die psychischen <strong>und</strong> sozialen Probleme,<br />
welche die fortschreitende Industrialisierung mit ihren Brüchen<br />
<strong>und</strong> Verwerfungen hervorbrachte, sondern auch darum,<br />
dass die moderne Entwicklung schon damals die Geschlossenheit<br />
der Familie aufbrach. Wir können am Beispiel der Jugendbewegung<br />
sehen, wie sich Jugendliche früher von der<br />
Familie absetzten <strong>und</strong> ihren eigenen gesellschaftlichen Weg<br />
suchten <strong>und</strong> können am Beispiel der bürgerlichen Frauenbewegung<br />
nachzeichnen, dass Frauen sich nun nicht mehr einfach<br />
der Familienrolle unterordneten, sich mit ihrer Identität<br />
als Mutter beschieden, sondern eine neue Identität als Frau in<br />
der <strong>und</strong> über die Familie hinaus suchten. Dieser frühe Prozess<br />
der „Individualisierung" bildete also den Hintergr<strong>und</strong> nicht<br />
nur der Familienkrise der damaligen Zeit, sondern auch der<br />
Autoritätskrise <strong>des</strong> Vaters <strong>und</strong> damit der Krise <strong>des</strong> Mannseins.<br />
Hinzu kommt die gesellschaftliche Entwertung <strong>des</strong> Vaters.<br />
Während vor der Jahrh<strong>und</strong>ertwende vom 19. zum 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
- im wilhelminischen Deutschland also - die Autoritätsfigur<br />
<strong>des</strong> Vaters noch unangetastet war, begann sie nach<br />
dieser Jahrh<strong>und</strong>ertwende deutlich abzubröckeln. Dies hing mit<br />
den sozialökonomischen Entwicklungsschüben der industriekapitalistischen<br />
Modernisierung zusammen, die ihre zweite<br />
Phase in Deutschland um diese Jahrh<strong>und</strong>ertwende erreichte.<br />
ie Väter, bisher Vorbilder dafür, wie sich die Jungen in der<br />
137
Gesellschaft zu verhalten hatten, wurden auf einmal von den<br />
sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Entwicklungen dieser zweiten Modernisierung<br />
überrollt. Es entstanden nicht nur neue industrielle<br />
Produktionsstrukturen <strong>und</strong> Berufe, sondern auch bisher nicht<br />
gekannte soziale Wandlungsprozesse: Nicht mehr der tradierte,<br />
autoritätsfixierte Mann wurde im Wirtschaftsleben verlangt,<br />
sondern der mobile, flexible, dem Neuen aufgeschlossene. Die<br />
Väter konnten nicht mehr als Vorbild dienen, die Jungen<br />
mussten sich aus der Familie <strong>und</strong> ihren patriarchalen Strukturen<br />
lösen, denn sie war nicht mehr richtungsweisend <strong>und</strong> stilbildend<br />
für das moderne Berufs- <strong>und</strong> Sozialleben. Zwar wurde<br />
die patriarchale Autorität vom Staat immer noch hochgehalten,<br />
ihre lebensweltlichen Vorbilder suchten aber die Jugendlichen<br />
woanders: Vor allem unter Ihresgleichen. Die Jugendbewegung<br />
zu Beginn <strong>des</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>erts symbolisierte die<br />
gleichsam gesellschaftlich zwingende Abwendung vom Muster<br />
der väterlichen Autorität. Bertrand Russell drückte dies in<br />
den 1920er Jahren noch drastischer aus: „Die Funktionen <strong>des</strong><br />
Vaters sind [...] auf ein Minimum verringert, weil die meisten<br />
Funktionen vom Staat übernommen werden. Mit dem Fortschritt<br />
der Zivilisation ist dies unvermeidlich [...] die wirtschaftliche<br />
Funktion <strong>des</strong> Vaters kann bei den wohlhabenden<br />
Schichten wirksamer erfüllt werden, wenn er tot ist, als wenn<br />
er lebt, da er sein Vermögen den Kindern hinterlassen kann,<br />
ohne ein Teil davon für seinen eigenen Unterhalt verbrauchen<br />
zu müssen" (1929, S. 122).<br />
Mit der sozialökonomischen Entmachtung <strong>des</strong> Vaters geht also<br />
auch eine massive Entwertung der Vaterfunktion im Erziehungsbereich<br />
der Familie einher. In den 1920er Jahren, im<br />
Zuge der weiteren Ausdifferenzierung der arbeitsteiligen Produktion<br />
<strong>und</strong> der totalen Bindung der Arbeiter <strong>und</strong> Angestellten<br />
an die Betriebe <strong>und</strong> deren Produktionsrhythmus kommt zu<br />
der Entwertung <strong>des</strong> Vaters seine kontinuierliche Abwesenheit<br />
hinzu. Der in der Familie schwache Vater, <strong>des</strong>sen Autorität<br />
nur noch ideologisch <strong>und</strong> über die Mutter aufrechterhalten<br />
wird, ist nun durch seine Verfügbarkeit im modernisierten industriekapitalistischen<br />
Prozess weiter geschwächt. Je mehr er<br />
aber in der seelenlosen Rationalität der industriellen Produktionsweise<br />
aufgeht, <strong>des</strong>to stärker ist er auf die emotionale Kraft<br />
<strong>und</strong> den Rückhalt in der Familie angewiesen. Der abwesende<br />
Vater wird so auch zum bedürftigen Vater, der wieder in die<br />
Familie hineinkommen will, aber nicht die entsprechende Resonanz<br />
findet. Bertrand Russell hat dies schon so beobachtet:<br />
„Itn modernen heben ist die große Mehrzahl der Väter von<br />
ihrem Beruf so sehr in Anspruch genommen, dass sie von ihren<br />
Kindern nicht viel zu sehen bekommen. Morgens haben<br />
sie es so eilig, an ihre Arbeitsstelle zu gelangen, als dass sie<br />
Zeit zur Unterhaltung hätten. Wenn sie abends heim kommen,<br />
sind die Kinder schon im Bett oder sollten es sein. Man hört<br />
Geschichten von Kindern, die ihren Vater nur als den „Mann,<br />
der zum Wochenende kommt" kennen. An dem wichtigen Geschäft<br />
der Betreuung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> kann der Vater selten teilnehmen.<br />
Diese Pflicht teilen sich die Mütter <strong>und</strong> der Staat. Es<br />
ist richtig, dass der Vater seine Kinder auch sehr lieb hat, trotz<br />
der wenigen Zeit, die mit ihnen zusammen sein kann. Jeden<br />
Sonntag kann man in den ärmeren Gegenden Londons zahlreiche<br />
Väter mit ihren Kleinkindern beobachten, die offensichtlich<br />
an der kurzen Gelegenheit, ihre Buben <strong>und</strong> Mädchen<br />
kennen zu lernen, riesige Freude haben. Aber wie sich das<br />
auch vom Gesichtspunkt <strong>des</strong> Vaters ansehen mag, für das<br />
Find ist das lediglich eine Spielbeziehung ohne ernsthafte Bedeutung"<br />
(ebd., S. 122f). Im Prinzip gilt das oft noch heute,<br />
auch wenn die Väter sich ihrer Situation mehr bewusst sind:<br />
Väter kommen oft nur in Sondersituationen mit den Kindern<br />
zusammen, es fehlt die Alltagsidentifikation mit den väterlichen<br />
Schwächen <strong>und</strong> Stärken gleichermaßen.<br />
Alexander Mitscherlich hat in seinem Klassiker „Auf dem<br />
Weg zur vaterlosen Gesellschaft` (1963) diesen Zusammenhang<br />
zwischen steigender Arbeitsteilung im Zuge der industriellen<br />
Modernisierung, Herausziehen <strong>des</strong> Vaters aus der Familie<br />
<strong>und</strong> der sozialen <strong>und</strong> pädagogischen Vaterentwertung<br />
allgemein zusammengefasst: „Wo man sich dem erfindungsbeschleunigten<br />
Fortschritt der technischen Zivilisation anvertraut,<br />
dort zerfällt die Hierarchie der alten Sozialordnungen<br />
bis in die [...] der Familie hinein. [...] Die Trennung der väterlichen<br />
von der kindlichen Welt in unserer Zivilisation lässt eine<br />
[...] anschauliche Erfahrung auf beiden Seiten nicht zu; ja<br />
das Kind weiß nicht, was der Vater tut, der Vater nicht wie<br />
das Kind in seine Fertigkeiten hereinwächst [...]. Die Identität<br />
ist für das Kind schwierig zu finden, weil es zu viel seinen<br />
13 9
Phantasien über den Vater überlassen bleibt, statt ihn in einer<br />
Welt erfahren zu können, in der es ihn durch Mittätigkeit kennen<br />
lernen kann" (1967, S. 193f). Hier ist schon das gemeint,<br />
was wir als Idolisierung von Männlichkeit durch die Jungen<br />
bezeichnen <strong>und</strong> das - so müssen wir hinzufügen - die Abwertung<br />
<strong>des</strong> Weiblichen fast zwangsläufig nach sich zieht.<br />
Heute drängen viele Männer aus eigenen biografischen Antrieben<br />
in die Familie hinein, werden aber gleichzeitig im Zuge<br />
der Intensivierung der Arbeit (bei höherer ökonomischer<br />
Verfügbarkeit <strong>des</strong> Mannes) wieder von der Familie weggezogen.<br />
Der Traum der männerbewegten Zirkel der 1990er Jahre,<br />
der „neue Mann" könne sich biografisch durchsetzen, auch<br />
wenn ihn das ökonomische System weiter vereinnahme, konnte<br />
sich so nicht erfüllen. Vielmehr hat sich ein bezeichnender<br />
Spannungszustand entwickelt, der sich in der neueren empirischen<br />
Väterforschung gut abbildet: Väter beteiligen sich deutlich<br />
mehr in den Familien, aber es scheint nicht für einen<br />
strukturellen Wandel hin zur Familienvaterschaft zu reichen.<br />
So hat sich zwar der entsprechende zeitliche Aufwand bei den<br />
Vätern im Durchschnitt wesentlich erhöht, er konzentriert sich<br />
aber vor allem auf das arbeitsfreie Wochenende sowie sportliche<br />
<strong>und</strong> spielerische Aktivitäten, während die Mithilfe bei<br />
pflegerischen <strong>und</strong> haushaltsbezogenen Arbeiten deutlich weniger<br />
zugenommen hat (vgl. Gonser 1994, Fthenakis 1999).<br />
Auch die Erwerbstätigkeit der Frau führt nicht zwingend zur<br />
partnerschaftlichen Teilung der Haushalts- <strong>und</strong> Familienaufgaben<br />
(vgl. BMFSJ 1997). Erhärtet werden diese Bef<strong>und</strong>e von<br />
der Kinderseite her. Der deutsche Kinder-Eltern-Survey Mitte<br />
der 1990er Jahre zeigte, dass Väter über den Alltag, die Einstellungen<br />
<strong>und</strong> die sozialen Beziehungen ihrer Finder wesentlich<br />
weniger Bescheid wissen als die Mütter (Zinnecker/Silbereisen<br />
1996). Viele Väter können also die für das<br />
Mannwerden notwendige Geschlechteridentifikation nicht anbieten.<br />
So sind es in der überwiegenden Mehrheit (85%) die<br />
Mütter, die über die Woche hinweg für die Kinder zuständig<br />
sind (BMSFJ 1997). Gisela Notz spricht in ihrer Väterstudie<br />
anfangs der 1990er Jahre sogar noch vom „Vater als Märchenprinz",<br />
der nur für „Action" zuständig ist <strong>und</strong> die alltägliche<br />
Pflege, in der sich ja Versorgung, Zuwendung <strong>und</strong> Identi-<br />
140<br />
fikationsdynamik miteinander verbinden, weiterhin der Mutter<br />
überlässt, auch wenn am Wochenende die Väter mehr als früher<br />
Pflegetätigkeiten übernehmen (Fthenakis 1999). Dass diese<br />
Mütterzentrierung in der frühkindlichen Phase von der<br />
Mehrheit der Bevölkerung als nicht problematisch, ja als<br />
selbstverständlich positiv angesehen wird, zeigt eine Repräsentativerhebung<br />
<strong>des</strong> Deutschen Jugendinstituts von<br />
1991/1992, nach der über zwei Drittel der westdeutschen Väter<br />
<strong>und</strong> Mütter der Antwortvorgabe „Kleinkinder sollten in<br />
den ersten drei Jahren bei der Mutter/in der Familie sein" zustimmten.<br />
Dem entspricht, dass viele der kinderbetreuenden<br />
Mütter mit ihrer Familienrolle so zufrieden sind, dass sie freiwillig<br />
auf die Erwerbstätigkeit verzichten <strong>und</strong> die ersten Lebensjahre<br />
ausschließlich für das Kind da sein wollen (Matzner<br />
1998; vgl. auch Döge/Volz 2002). Auch dies ist eine nicht zu<br />
unterschätzende Barriere für Männer, in die alltägliche Familienarbeit<br />
einzusteigen. So entsteht ein Verwehrungskreisel,<br />
der aber nicht als solcher erkannt, höchstens in anderen Bezügen<br />
(Bedürftigkeit) gespürt wird: Wird ein Kind geboren,<br />
kommen die Paare unter den Druck der Aushandlung, aus arbeitsorganisatorischen<br />
Gründen (Zusammenspiel zwischen<br />
externer männlicher Verfügbarkeit <strong>und</strong> Karriere), aber auch<br />
unter dem Einfluss geschlechtsdifferenter Lebenszufriedenheit<br />
zur traditionellen Rollenteilung zurück. Dies geschieht auch,<br />
wenn sie vorher in ihren Einstellungen <strong>und</strong> ihrer Lebenspraxis<br />
eine partnerschaftliche Rollenteilung in Haushalt <strong>und</strong> Beruf<br />
bevorzugt hatten (vgl. Notz 1991, Gonser 1994). Im Nachhinein<br />
- so zeigt eine entsprechende Väterstudie - wird dann die<br />
„verpasste Gelegenheit", das Auslassen <strong>des</strong> väterlichen Erziehungsurlaubs<br />
von einigen (allerdings im Gesamtsample eher<br />
wenigen) Männern nicht nur als Ursache für die mangelnde<br />
Intensität der weiteren Beziehung <strong>des</strong> Vaters zu dem Kind,<br />
sondern auch als Ursache für Unzufriedenheiten in der Partnerschaft<br />
gesehen (Vascovics/Rost 1999, S. 162f). Auch diese widersprüchlichen<br />
Konstellationen - viele Männer möchten gerne<br />
in die Familien hinein, können es aber nicht <strong>und</strong> rationalisieren<br />
dann zwangsläufig diese Verwehrung - verweisen wieder auf<br />
die Probleme der Entgrenzung der Männlichkeit. Die Rationalisierung<br />
geschieht dann vor allem über Begründungen wie Eingeb<strong>und</strong>ensein<br />
in die Arbeit <strong>und</strong> drohender Karriereverlust, zu
niedriges Einkommen der Partnerin <strong>und</strong> eben Verweis auf die<br />
Prä<strong>des</strong>tination der Frau für die Mutterrolle.<br />
abei kann die neuere Väterforschung zeigen, wie wichtig die<br />
partnerschaftliche, alltagszugewandte Teilhabe <strong>des</strong> Vaters an<br />
der frühkindlichen Erziehung für den Sozialisationsprozess<br />
<strong>des</strong> Jungen ist. Für die Entwicklung <strong>des</strong> Jungen ist es „günstig,<br />
in einem sozialisatorischen Interaktionssystem, das durch<br />
die Verschränkung von Paar- <strong>und</strong> Eltern-Kind-Beziehung gekennzeichnet<br />
ist, aufzuwachsen." (Hildenbrand 2000, S. 177).<br />
iese Triade muss nicht immer präsent, für das Kind, aber<br />
erwartbar sein (vgl. auch Winnicotts [1984] „unzerstörbare<br />
Umwelt"). Auch ist sie nicht mit der bürgerlichen' Kleinfamilie<br />
gleichzusetzen (Hildenbrand 2000, S. 176). Der Vater<br />
soll dabei nicht nur die Mutter-Kind-Symbiose frühzeitig lösen<br />
<strong>und</strong> damit die Eigenständigkeit <strong>des</strong> Jungen fördern können<br />
(Pruett 1988), er steht auch dafür, dass das Kind früh zwei<br />
wesentlich unterschiedliche Bezugspersonen erleben <strong>und</strong> somit<br />
die „Eingleisigkeit" der Erziehung verhindert werden<br />
kann (Matzner 1998, S. 25). Väter sind wie Mütter in der Lage<br />
„ein Kind von Geburt an mit der notwendigen Sensitivität angemessen<br />
zu betreuen <strong>und</strong> zu versorgen, sein Bedürfnis nach<br />
Kommunikation zu stillen <strong>und</strong> seine Entwicklung entsprechend<br />
zu fördern. Beide Eltern entwickeln unter entsprechenden<br />
Bedingungen enge emotionale Beziehungen zum Kind.<br />
as Kind seinerseits entwickelt enge emotionale Beziehungen<br />
zu beiden Elternteilen, <strong>und</strong> zwar individuelle Beziehungen,<br />
die eigenständig zu sehen sind" (Fthenakis 1988, S. 283). Vor<br />
allem aber ist von Bedeutung, dass eine frühe Involvierung<br />
<strong>des</strong> Vaters die Problematik von Idolisierung <strong>und</strong> Abwertung<br />
bei den Jungen entschärfen kann (vgl. dazu wieder 3.2). Sie<br />
erhalten dann eher ein reales Männerbild <strong>und</strong> sind nicht so<br />
sehr auf die Medien angewiesen (Matzner 1998, S. 28f). In<br />
diesem Zusammenhang ist auch der Bef<strong>und</strong> aus einer früheren<br />
Längsschnittstudie (über fünf Jahre angelegt) interessant, aus<br />
der hervorgeht, dass die „Vaterbinder" (Vater als Hauptbezugsperson)<br />
keine Probleme damit hatten, zwischen weiblichen<br />
<strong>und</strong> männlichen Rollen zu wechseln (Pruett 1988, S.<br />
177). Allerdings: Auch wenn es wohl erwiesen ist, dass „bereits<br />
mit vier Monaten [...1 die Fähigkeit <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>, in eine<br />
Drei-Personen-Beziehung einzutreten <strong>und</strong> diese eigenständig<br />
142<br />
mitzugestalten" ausgebildet ist, hängt die Realisierung letztlich<br />
doch „entscheidend von der elterlichen Repräsentanzenwelt<br />
<strong>und</strong> damit vom Ausmaß <strong>und</strong> der Qualität triadischer Interaktionen,<br />
welche sie dem Kind anbieten, ab" (von Klitzing<br />
2000, S. 167). Damit wird auch wichtig, ob Väter selbst gute<br />
triadische Erfahrungen - mit ihrem eigenen Vater - hatten<br />
<strong>und</strong>/oder ob sie mit einer Partnerin zusammen sind, die bereit<br />
ist, sich relativ früh nach der Geburt in kontinuierliche<br />
triadische Alltagsprojekte einzulassen. Das setzt natürlich<br />
wieder eine alltagszugewandte Anwesenheit <strong>des</strong> Vaters voraus.<br />
Eine alltagsselbstverständliche Vater-Kind-Interaktion bringt<br />
auch enorme Vorteile für die Entwicklung <strong>und</strong> Selbstfindung<br />
der Väter als Männer. Sie erhalten über die in der Beziehung<br />
zum Jungen gelebte Emotionalität <strong>und</strong> „Unverstelltheit" einen<br />
Ausgleich zur „instrumentellen Realität" konkurrenter <strong>und</strong><br />
rollenfixierter Arbeitsbeziehungen (Gonser 1994, S. 20f).<br />
ennoch bleibt die Vaterschaft, auch wenn sie sich früh auf<br />
das triadische Projekt einlässt, für die Männer immer noch<br />
zwiespältig. Denn die Mutter-Kind-Beziehung behält durch<br />
den existenziellen Vorsprung' der Geburt durch die Frau'<br />
ihre tiefenpsychische Ausstrahlung auf den Mann. So können<br />
mit der Vaterschaft typische Konflikte im Mann aufbrechen.<br />
Auf den ersten Blick scheint es dabei paradox, dass der Gebärneid<br />
gerade bei denjenigen Männern offener aufzutreten<br />
scheint, „für die das klassische männliche Selbst- <strong>und</strong> Weltbild<br />
seine Selbstverständlichkeit verloren hat" (Bullinger<br />
1984). Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass diese Männer<br />
in Bezug auf sich selbst hoch sozialemotional sensibilisiert<br />
sind <strong>und</strong> dabei ihre eigenen, wenn auch rational unterdrückten<br />
Gefühle - wie eben den Kleid - wahrnehmen <strong>und</strong> empfinden.<br />
Gleichzeitig sind solche geburtsnahen Väter stärker der Konfrontation<br />
mit der eigenen frühkindlichen Biografie <strong>und</strong> ihren<br />
Reaktualisierungen ausgesetzt, so wie sie durch die Geburt<br />
ausgelöst werden. Darauf ist der Mann nicht vorbereitet. Geschürt<br />
wird dies durch die alltägliche Wahrnehmung <strong>des</strong> symbiotischen<br />
Kontaktes zwischen Mutter <strong>und</strong> Kind <strong>und</strong> der fast<br />
bedingungslosen Hingabe der Frau an das Kind, z.B. beim<br />
Stillen. In dieser Aktualisierung erlebt der Mann in schmerzlicher,<br />
aber unbewusster Erinnerung die eigene Verbindung mit<br />
1 43
der Mutter, das Einfach-so-sein-Dürfen <strong>und</strong> die spätere Abtrennung<br />
von ihr, die mit einem nicht mehr Zugestehen der<br />
eigenen Gefühle verb<strong>und</strong>en war. So kann sich wieder eine<br />
Kränkung <strong>des</strong> Mannes angesichts seines erneuten Ausgeschlossenseins<br />
entwickeln. Der männliche Mangel' <strong>des</strong><br />
Nichtgebärens <strong>und</strong> Nicht-stillen-Könnens wird bloßgelegt, die<br />
symbolischen Schutz- <strong>und</strong> Projektionsmechanismen überlegener<br />
Männlichkeit verlieren angesichts dieses dem Mann entzogenen<br />
„Naturrechts" ihre Macht.<br />
So ist es kein W<strong>und</strong>er, dass sich Väter dann doch diesem Bewältigungsdilemma<br />
dadurch entziehen, dass sie sich wieder in<br />
ihr Außen - Arbeit, Freizeit, Männerbünde - stürzen <strong>und</strong> in<br />
den Sog <strong>des</strong> unbezogenen Ausagierens' geraten. Andere wiederum<br />
demonstrieren überbetont ihre neue Väterlichkeit,<br />
schnallen sich ihr Kind um den Bauch, um ihm auch öffentlich<br />
nahe zu sein, wie sonst nur die Mütter, demonstrieren so<br />
ihr anderes Verständnis vom Vatersein. So gesehen bleibt diese<br />
Väterlichkeit beim Nachahmen der Mütterlichkeit stehen.<br />
Aktive Väterlichkeit macht sich aber weniger an solchen Außendemonstrationen<br />
fest, sondern an der Art <strong>und</strong> Weise, wie<br />
der Mann mit seinen Gefühlen <strong>des</strong> Schmerzes, <strong>des</strong> Ausgestoßenseins,<br />
der damit verb<strong>und</strong>enen Trauer <strong>und</strong> dem Hass auf<br />
Mütter' umgehen kann. Er muss die damit verb<strong>und</strong>ene Hilflosigkeit<br />
annehmen können, denn dies ist eine Voraussetzung<br />
für das Gelingen in der Interaktion mit dem Kind: Sowohl was<br />
das Einfühlen in das Kind als auch das Hereinlassen' <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> in sich anbelangt. Dies ist auch die Voraussetzung für<br />
die Entwicklung der notwendigen Empathie im Kontakt zur<br />
Partnerin <strong>und</strong> zum Kind, damit sich eine gemeinsame Nähe<br />
einstellen <strong>und</strong> der Vater die Beziehung durchhalten kann (vgl.<br />
öhnisch/Winter 1993).<br />
iese Entfaltung <strong>des</strong> neuen, aktiven Vaters stößt aber heute -<br />
nicht immer noch, sondern wieder neu - an die Grenzen der ökonomisch-gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen. Die Hoffnung<br />
der Männerbewegung, die Männer könnten sich ungeachtet<br />
dieser Bedingungen lebensweltlich-biografisch zu neuen<br />
Vätern emanzipieren, ist angesichts <strong>des</strong> Externalisierungs<strong>und</strong><br />
Verfügbarkeitsdruckes im neuen Kapitalismus weiter trügerisch.<br />
Männerrolle <strong>und</strong> Vaterrolle stehen sich in unserer Ge-<br />
sellschaft immer noch gegenseitig im Wege. So kann sich<br />
auch kein neues, für eine Mehrheit der Männer greifbares Vatervorbild<br />
entwickeln, an dem sie sich sozial einvernehmlich<br />
orientieren könnten. Dieses aber ist überfällig, denn viele<br />
Männer wollen <strong>und</strong> können sich nicht mehr an ihren Vätern<br />
orientieren (vgl. Kropp 1995), finden aber auch wenig gesellschaftliche<br />
<strong>und</strong> institutionelle Resonanz auf ihre Bedürftigkeit.<br />
Die Geschlechtstypik <strong>des</strong> Aufwachsens ist im Alltag in der<br />
Regel verdeckt, erst auf den zweiten oder dritten dick sichtbar.<br />
Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Beteiligten<br />
- Erzieher, Eltern, Nachbarn, Fre<strong>und</strong>e, Öffentlichkeit, aber<br />
auch die Jungen selbst - ihr Verhalten als der Normalität entsprechend<br />
betrachten. L,ehrerInnen <strong>und</strong> KindergärtnerInnen<br />
schwören darauf, dass sie Jungen <strong>und</strong> Mädchen gleich behandeln<br />
<strong>und</strong> dass sie alles tun, um die außenorientierte Aggressivität<br />
der Jungen einzudämmen <strong>und</strong> den Mädchen beziehungsvolle<br />
Unterstützung zukommen zu lassen. Oft bleiben sie dabei<br />
einer folgenreichen Paradoxie verhaftet: Selbst wenn Jungen<br />
immer wieder wegen ihres aggressiven Verhaltens bestraft<br />
werden, fühlen sie sich subjektiv belohnt, weil sie merken,<br />
dass sie damit auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die<br />
Mädchen dagegen werden eher an die Person <strong>des</strong> Erziehers<br />
oder der Erzieherin geb<strong>und</strong>en. Quer durch alle Koedukationsnormen<br />
in Kindergarten <strong>und</strong> Schule zieht sich also eine räumlich<br />
strukturierte männliche Durchsetzungskultur, die zwar in<br />
der Schule negativ sanktioniert, von der Konkurrenzgesellschaft<br />
aber später belohnt wird. Mädchen schreiben die besseren<br />
Noten, Jungen setzen sich aber eher am Arbeits- <strong>und</strong> Jobmarkt<br />
durch. Dem wohnt eine Grammatik inne, die bei Jungen<br />
wieder in der Matrix von Anziehung <strong>und</strong> Abstoßung beschreibbar<br />
ist. Dies beginnt in der Familie <strong>und</strong> lässt sich entsprechend<br />
aufschließen, wenn wir die Familie als besonderen<br />
145
- durch Intimität gekennzeichneten - Rahmen sozialisatorischer<br />
Interaktion verstehen.<br />
Probleme der familialen Unübersichtlichkeit, Inkonsistenz <strong>und</strong><br />
wechselnde Familienkonstellationen, wie z.B. eine Stiefvaterkonstellation,<br />
wirken sich bei Jungen vor allem <strong>des</strong>halb so folgenreich<br />
aus, weil sie früh <strong>und</strong> oft abrupt zur Ablösung von<br />
der innerfamilialen Geborgenheit der Mutter-Kind-I3yade gezwungen<br />
sind. Um die Sozialisationsbalance zwischen sozialem<br />
Außen <strong>und</strong> innerfamilialem Rückhalt wahren zu können,<br />
ist der Junge darauf angewiesen, dass die Familie bzw. die elterlichen<br />
Beziehungen - auch wenn er nach außen gedrängt<br />
wird - für ihn stabil <strong>und</strong> überschaubar bleiben. Unübersichtliche<br />
<strong>und</strong> inkonsistente Familienstrukturen können beim Kind<br />
innere Hilflosigkeit <strong>und</strong> verstärkte narzisstische Antriebe erzeugen,<br />
aus denen heraus sich nicht selten antisoziale Abspaltungen<br />
(dieser Hilflosigkeit) <strong>und</strong> sozial <strong>des</strong>integrative Dynamiken<br />
entwickeln. Diese Gr<strong>und</strong>problematik familialer Überforderung<br />
macht Jungen vor allem dann zu schaffen, wenn sie<br />
ihre emotionalen, inneren Signale nicht mehr in der Familie<br />
setzen können. So kann es im Extremfall dazu kommen, dass<br />
sich Jungen aus der Familie hinausgedrängt, ausgegrenzt fühlen.<br />
Aus der sozialpädagogischen Arbeit mit Straßenkindern,<br />
die meist aus solchen inkonsistenten Familien kommen, wissen<br />
wir, wie Jungen unter diesem Ausgrenzungsdruck leiden.<br />
Aber gerade auch alltäglich wiederkehrende Situationen, in<br />
denen die Eltern keine Zeit für die Kinder haben, sie zwar materiell<br />
überversorgen, aber emotional vernachlässigen, treffen<br />
Jungen in einer besonderen Art <strong>und</strong> Weise. Es gehört zu den<br />
Schattenseiten männlicher Sozialisation, dass viele Eltern -<br />
vor allem Väter - immer noch glauben, Jungen bräuchten keine<br />
emotionale Zuwendung, müssten lernen, sich durchzubeißen.<br />
Vor allem die elterliche Anerkennung <strong>und</strong> Wertschätzung<br />
<strong>des</strong>sen, was dem Jungen wichtig ist, fehlt in dieser Konstellation.<br />
Die Eltern erkennen in der Regel primär an, dass sich der<br />
Junge so gut allein um sich kümmert <strong>und</strong> übergehen damit<br />
seine Befindlichkeit <strong>und</strong> seine individuellen Alltagsprobleme.<br />
Straßenszene <strong>und</strong> Clique werden dann zu emotionalen Be-<br />
14 6<br />
zugspunkten, die dann Ausschließlichkeitscharakter gewinnen<br />
können, wenn die Eltern - trotz Abwesenheit - diese Außenbeziehungen<br />
misstrauisch betrachten oder gegenüber dem Sohn<br />
gar abwerten.<br />
ie Familie, als in der Regel auf Abstammung <strong>und</strong> Verwandtschaft<br />
beruhende Primärgruppe, ist durch intime persönliche<br />
Beziehungen definiert, die Gesellschaft ist durch das rationale<br />
System der Arbeit geprägt. Zusammenhalt <strong>und</strong> Konflikt haben<br />
dadurch in der Familie ein anderes Gesicht als in der Gesellschaft.<br />
In der Familie herrschen tiefenpsychische Llynamiken,<br />
in der Gesellschaft institutionalisierte Verfahren vor. Familien<br />
sind durch basale Zugehörigkeit <strong>und</strong> Bindung, hiebe <strong>und</strong> vorsoziale<br />
Empathie zusammengehalten, werden durch Hass,<br />
Schuldgefühle <strong>und</strong> Verlustängste auseinander getrieben. Kiese<br />
tiefenpsychischen Komplexe sind auch geschlechtstypisch geprägt.<br />
Wenn sich also die Gesellschaft der Familie als Reproduktionsort<br />
bedient, dann setzt sie das Wirken dieser geschlechtstypischen<br />
Intimstrukturen voraus. Soziale Reproduktion<br />
im Sinne der Bearbeitung gesellschaftlich erfahrener Lebensprobleme<br />
in der Familie bedeutet also, dass diese Probleme<br />
zu Intimproblemen der Familie werden <strong>und</strong> dass gesellschaftlich<br />
davon ausgegangen wird, dass sie dort geschlechtstypisch<br />
bearbeitet werden. In der Familie bildet sich also nicht<br />
nur die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung mit ihrer entsprechenden<br />
Rollenstruktur ab, sondern wirken auch männliche<br />
<strong>und</strong> weibliche Bewältigungsmuster, die zwar immer in<br />
einer sozialen Spannung zu den rationalen Verfahren der<br />
Problemlösung <strong>und</strong> Konfliktbewältigung der Gesellschaft stehen,<br />
dennoch aber - besonders in kritischen Situationen, in<br />
denen die bisherigen sozialen Ressourcen versagen - ihre Eigenkraft<br />
entfalten. Wenn Familien nachhaltig überfordert<br />
werden, dann werden in ihren Intimstrukturen diese männlichen<br />
<strong>und</strong> weiblichen Bewältigungsmuster in ihrer Eigendynamik<br />
freigesetzt. Die Familie enthüllt ihr männliches <strong>und</strong><br />
weibliches Gesicht.<br />
Heute wird in der Familiensoziologie <strong>und</strong> Familienforschung<br />
konstatiert, dass die klassische hierarchische Generationenfamilie<br />
zunehmend dem "Typ der Aushandlungsfainife weicht,<br />
dass aber dennoch beide nebeneinander bestehen (wobei in<br />
147
sozial benachteiligten Milieus der Generationenfamilientypus<br />
noch eher vorherrscht) <strong>und</strong> in Krisensituationen das generationenhierarchische<br />
Moment immer wieder hervorbricht. Üblicherweise<br />
aber werden beide Familientypen meist nur allgemein<br />
im Verhältnis der Mitgliedsrollen oder der Subjekte zueinander<br />
thematisiert (vgl. dazu im Überblick Böhnisch/Lenz<br />
1997). Dass es sich bei beiden um geschlechtsgeprägte Verhältnisse<br />
handelt, kommt meist nicht oder nicht ausreichend<br />
zur Sprache. Dies ist uns erst möglich, wenn wir die Familie<br />
als verdecktes geschlechtshierarchisches Gewaltverhältnis begreifen,<br />
das im Alltag produktiv ausbalancierbar ist, das aber<br />
in Krisensituationen <strong>des</strong>truktiv aufbrechen kann. Dann verhalten<br />
sich Männer <strong>und</strong> Frauen oft „geschlechtstypisch" <strong>und</strong> versuchen<br />
die Familie in den Sog dieser geschlechtstypischen<br />
ewältigungsdynamik zu ziehen: Die Männer, indem sie von<br />
der Familie wie selbstverständlich emotionale Stützungen verlangen<br />
<strong>und</strong> diese manchmal auch mit Gewalt bei Frauen <strong>und</strong><br />
Kindern holen wollen, die Frauen, indem sie die Folgen der<br />
Gewaltdynamik auf sich <strong>und</strong> die Kinder ziehen.<br />
Die Familie in der modernen Gesellschaft ist unter einen doppelten<br />
Überforderungsdruck geraten (vgl. allgemein Rerrich<br />
1988). Zum einen wird mit der zunehmenden sozialen Entbettung<br />
der Arbeit (durch Abstraktion <strong>und</strong> Digitalisierung der<br />
Arbeitsvorgänge) der Druck auf die Familie, dies emotional<br />
auszugleichen, verstärkt. All das, was Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>und</strong><br />
später auch Jungen <strong>und</strong> Mädchen in einer emotional einseitigen<br />
Funktionswelt (vgl. 4.4) nicht finden, sollen die intimen<br />
eziehungen in der Familie bringen. Und wenn es die eigene<br />
Familie nicht gebracht hat, dann soll dies über die neue,<br />
selbstgegründete Familie gelingen. Viele Konflikte <strong>und</strong> Überforderungen<br />
aus Frühverheiratungen sind darauf zurückzuführen,<br />
dass sich die Frauen <strong>und</strong> Männer etwas von ihrer frühen<br />
Ehe <strong>und</strong> ihren Kindern erwarten, das sie selbst in ihren Familien<br />
entbehrt haben. So wie sie aber selbst Vernachlässigung<br />
<strong>und</strong> Gewalt in ihrer Herkunftsfamilie erfahren haben, haben<br />
sie nicht gelernt, ihre Beziehungen <strong>und</strong> ihre Erziehungsstile<br />
anders zu gestalten. So werden Überforderungskonflikte<br />
gleichsam über die Generationen hinweg vererbt.<br />
as zweite Überforderungsproblem liegt in dem bereits hergeleiteten<br />
Umstand, dass die Verständigungs- <strong>und</strong> Konfliktstruktur<br />
der Familie anderen Logiken folgt, als denen der Arbeitswelt.<br />
So werden soziale Konflikte, die außerhalb der Familie<br />
eigentlich durch Verfahren gelöst werden müssten, in die Intimstruktur<br />
der Familie umgesetzt, werden zu tiefenpsychischen<br />
Ängsten <strong>und</strong> Bedürftigkeiten, die dann nicht mehr rational<br />
entwirrbar sind.<br />
edürftigkeit <strong>und</strong> Gewalt liegen <strong>des</strong>halb in den geschlechtstypischen<br />
Krisenszenarien familialer Konflikte eng zusammen.<br />
edürftigkeit entsteht, wenn einem etwas verwehrt wird, das<br />
einem - so meint man - selbstverständlich zusteht (s.u.). Familiale<br />
Geborgenheit wird gesucht, ist aber so selbstverständlich<br />
nicht zu finden, erscheint verwehrt <strong>und</strong> mehrt den Antrieb sie<br />
sich dann eben mit Gewalt zu holen. Bedürftigkeiten können<br />
nur durch Kommunikation, Empathie <strong>und</strong> Respekt voreinander<br />
aufgelöst werden. Das setzt aber voraus, dass Männer <strong>und</strong><br />
Frauen lernen, zu sich zu kommen, die Quelle der Bedürftigkeit<br />
bei sich zu suchen <strong>und</strong> nicht auf andere abzuspalten oder<br />
sich selbst zum Feind zu machen.<br />
in dieser Verbindung von familiensysternischem <strong>und</strong> geschlechtsdifferentem<br />
Zugang lassen sich zwei typische Kristallisationspunkte<br />
<strong>des</strong> Zusammenhalts <strong>und</strong> <strong>des</strong> Zusammenbruchs<br />
von Familien erkennen. Der frauentypische Kristallisationspunkt<br />
ist mit dem landläufigen Sprichwort „die Frau hält<br />
die Familie zusammen" umschrieben. Aus Frauenhäusern<br />
wird immer wieder berichtet, dass Frauen, auch wenn sie vom<br />
Mann stark unter Druck gesetzt oder geschlagen werden, aus<br />
Schuldbewusstsein wieder in ihre Familie (zu ihrem Mann)<br />
zurückkehren, weil sie denken, sie würden durch ihr Weglaufen<br />
die Familie auseinander bringen. Männer interessiert dagegen<br />
vor allem, ob ihre Familie „funktioniert". Sie fühlen<br />
sich immer noch in einer gewissen Ernährerrolle für die Absicherung<br />
der Familie zuständig, sind sie doch auch auf das<br />
Funktionieren der Familie angewiesen: Die Familie muss<br />
funktionieren, damit der Mann draußen arbeiten kann, <strong>und</strong><br />
darin muss er sich auf die Familie verlassen können. Aus diesem<br />
einseitigen Funktionsverständnis heraus haben es viele<br />
Männer nicht gelernt, sich in die Rolle <strong>und</strong> die Befindlichkei-<br />
14 9
ten der anderen Familienmitglieder hineinzuversetzen <strong>und</strong><br />
können es <strong>des</strong>halb oft nicht verstehen, dass ihnen Zuwendungen,<br />
die sie in selbstverständliche Funktionsansprüche kleiden,<br />
von der Ehefrau oder den Kindern verwehrt werden. Hier<br />
sitzt ein Keim von Männern ausgeübter familialer Gewalt gegen<br />
Frauen <strong>und</strong> "Töchter genauso wie gegenüber den Söhnen:<br />
Söhne stehen unter besonderem Funktionsdruck von Vätern<br />
<strong>und</strong> da liegt auch der Bezugspunkt männlichen Konkurrenzverhaltens<br />
in der Familie. Kinder als Jungen (<strong>und</strong> Mädchen)<br />
sind in dieser Konstellation immer das schwächste Glied, da<br />
ihre Geschlechterbefindlichkeit noch stärker von der geschlechtsneutralen<br />
Kinderrolle verdeckt <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb am wenigsten<br />
thematisiert wird. Wenn Partnerkonflikte auf die Kinder<br />
projiziert werden, dann kommt es oft zu geschlechtstypischen<br />
Demütigungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>: Das Abwehrverhalten der<br />
Jungen gegenüber den Eltern wird dann funktionell entwertet<br />
(„zu nichts nutze"). Damit werden die Jungen ins Mark von<br />
Selbstwert <strong>und</strong> Anerkennung getroffen, worauf sie dann meist<br />
wieder geschlechtstypisch reagieren.<br />
Der Kindergarten ist der Ort der ersten - partiellen - Ablösung<br />
<strong>des</strong> Jungen von der Familie. Da diese Ablösung aber nur teilweise<br />
ist, da das Kind materiell <strong>und</strong> sozial noch ganz abhängig<br />
von der Familie bleibt, ist es angemessener, nicht von Ablösung,<br />
sondern von einem ersten verbindlichen Heraustreten<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> aus der Familie zu sprechen. Da das Kind noch<br />
fest in der Familie verwurzelt ist, muss die erste außerfamiliale<br />
Institution, in die es hinaustritt auch familienzugewandt, das<br />
heißt familienähnlich strukturiert sein. Deshalb ist die Kindergärtnerin<br />
als Frau eine so zentrale Figur, ist es - angesichts<br />
der Geschlechterrollenverteilung in der Familie - auch (immer<br />
noch) plausibel, dass es so wenig oder so gut wie keine Männer<br />
im Kindergärtnerberuf gibt. Denn die Kindergärtnerin<br />
spielt gleichsam eine Übergangsrolle: Sie ähnelt der Mutter,<br />
ist aber gleichzeitig familienunabhängig. Für das drei- bis<br />
vierjährige Kind, ganz gleich ob Junge oder Mädchen, das<br />
noch sehr stark mutterzentriert ausgerichtet ist, verkörpert sie<br />
gleichermaßen die Mutterfigur wie die „andere" Frau. Damit<br />
15 0<br />
er(rauend®minierte Kindergarten<br />
erhalten die Jungen <strong>und</strong> Mädchen über diese Gleichzeitigkeit<br />
der Verkörperung von Mütterlichkeit <strong>und</strong> familienweggewandter,<br />
sozialgerichteter Weiblichkeit einen ersten - freilich<br />
familienrückgeb<strong>und</strong>enen - Zugang zur außerfamilialen sozialen<br />
Welt.<br />
Gleichzeitig wird im Kindergarten für viele Kinder zum ersten<br />
Mal eine Gleichaltrigenkultur hergestellt. Die Kindergärtnerin<br />
gehört dem Jungen (oder Mädchen) nicht allein (oder zusammen<br />
mit den Geschwistern) wie die Mutter, sondern er spürt,<br />
dass sie auch die Bezugsperson der anderen Kinder ist <strong>und</strong> so<br />
erlebt sich das Kind zum ersten Mal in einer außerfamiliälen<br />
Vergleichs-, Konkurrenz- <strong>und</strong> Gruppenkultur. In ihr wirken<br />
dann auch die ersten außerfamilialen Definitionen, wie Mädchen<br />
<strong>und</strong> wie Jungen sich zu verhalten haben. Hier kommt es<br />
auch darauf an, wie die Kindergärtnerin <strong>und</strong> andere Bezugspersonen<br />
im Kindergarten das Kinderverhalten als erstes <strong>und</strong><br />
frühes Geschlechterverhalten wahrnehmen <strong>und</strong> reflektieren<br />
<strong>und</strong> wie sie selbst die Herausbildung von Geschlechterrollen<br />
zulassen, das heißt als Ordnungsschemata <strong>des</strong> Kinderalltags<br />
übernehmen.<br />
In Kindergärten lässt sich durchaus schon ein geschlechtstypisches<br />
räumliches Feld beobachten, denn es zeigt sich früh, wie<br />
unterschiedlich Jungen <strong>und</strong> Mädchen sich Räume aneignen.<br />
Die Mädchen sieht man oft um die Erzieherin geschart oder in<br />
festen Spielecken, während die Jungen ihren Raum dauernd<br />
verändern, unruhig sind, toben. Dadurch ziehen sie die Aufmerksamkeit<br />
der Erzieherin immer wieder auf sich. Auch<br />
wenn sie zurechtgewiesen werden, lernen sie: Wenn man sich<br />
auffällig verhält, erregt man Aufmerksamkeit, man kann sich<br />
präsentieren, bewirkt etwas von sich aus, verändert Situationen.<br />
Die Mädchen dagegen passen sich eher den „ruhenden"<br />
Regeln an, werden von der Kindergärtnerin darin bestärkt,<br />
weil sie die Mädchen als ordnende Gruppe, als Ruhepol für<br />
einen strukturierten Arbeitsalltag braucht. Deshalb ist es im<br />
Kindergarten so wichtig, früh die Rollen zu vertauschen, den<br />
Mädchen Raum zu geben, dass auch sie sich einmal „gehen<br />
lassen" können <strong>und</strong> Umgebung verändern lernen; die Jungen<br />
dagegen, dass sie mehr zu sich kommen lernen, sich in Gegenseitigkeit<br />
<strong>und</strong> nicht nur in Konkurrenz zu bewegen.
152 153
immer noch zu gelten, dass Jungen stärker konkurrenzorientiert<br />
<strong>und</strong> „agonal" spielen, während Mädchen eher „mimetisches"<br />
Spielen bevorzugen, indem sie sich gegenseitig einbeziehen<br />
<strong>und</strong> gemeinsame Gestaltungsideen entwickeln (vgl.<br />
Gebauer 1997). Besonders wichtig wird die geschlechtsreflektierende<br />
Arbeit, wenn der Kindergarten - im Sinne <strong>des</strong> Situationsansatzes<br />
(vgl. Zimmer 2000) - Explorationen in die Alltags-<br />
<strong>und</strong> Arbeitswelt der Erwachsenen unternimmt. Inzwischen<br />
gibt es auch im kleinstädtischen Bereich genug Konstellationen,<br />
wo Männer <strong>und</strong> Frauen das Gleiche tun (zum Beispiel<br />
bei der Polizei, der Post, im Irlandwerk) <strong>und</strong> die Kinder<br />
erleben können, dass Männer <strong>und</strong> Frauen Gleichwertiges tun,<br />
obwohl sie oft unterschiedlich an dieses Gleiche herangehen.<br />
ie Kinder lernen so produktive Differenz, nicht aber Hierarchie<br />
kennen.<br />
ie geschlechtsneutrale' Schule<br />
Die Schule ist von ihrer Struktur her diesen Problemen gegenüber<br />
zweifach blind: Einerseits hat sie nur die Schülerrolle im<br />
Visier, also nur den Ausschnitt der Persönlichkeit der Jugendlichen,<br />
der sich auf die Lern- <strong>und</strong> Leistungserwartungen sowie<br />
die Verhaltensanpassung an die Unterrichtsorganisation bezieht,<br />
zum andern glaubt sie mit ihrem Koedukationsedikt, geschlechtstypische<br />
Unterschiede im Sinne von Benachteiligungen<br />
ausgeglichen zu haben. Dabei zeigen aber geschlechtsspezifische<br />
Schüleruntersuchungen, dass in der Schule - wie<br />
schon im Kindergarten angelegt - ähnlich geschlechtstypisches<br />
Verhalten freigesetzt wird: Mädchen sind im Durchschnitt<br />
mehr unterrichtszentriert, Jungen aktivitätsgedrängter<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong>wegen unterrichtsstörender (vgl. dazu Enders-<br />
Dragässer/Fuchs 1989, Breidenstein/Keller 1998). Jungen<br />
werden wegen ihres Verhaltens im Durchschnitt auch mehr<br />
bestraft als die Mädchen. Das führen Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen<br />
gerne an, wenn ihnen von der Geschlechterforschung vorgehalten<br />
wird, dass sie den Jungen mehr Aufmerksamkeit zukommen<br />
lassen als den Mädchen-, sie strafen sie ja! Dass sich<br />
dabei ein verdecktes soziales Curriculum entwickelt, können<br />
die meisten nicht verstehen: Jungen erfahren unbewusst, dass<br />
sie durch antisoziales Verhalten Aufmerksamkeit auf sich zie-<br />
15 4-<br />
hen, das Unterrichtsklima ändern <strong>und</strong> sich - indem sich Lehrerinnen<br />
<strong>und</strong> Klasse ihnen zuwenden - zumin<strong>des</strong>t situativ durchsetzen<br />
können. In der Struktur der Schule ist also angelegt,<br />
dass sie eine männliche Durchsetzungskultur <strong>und</strong> eine Kultur<br />
der weiblichen <strong>Zur</strong>ücknahme fördert. Die Mädchen erbringen<br />
zwar im Durchschnitt die besseren Leistungen, wenn es aber<br />
um das Sozialverhalten <strong>und</strong> das soziale Durchsetzungsvermögen<br />
geht, vor allem nach der Schule in der Konkurrenz um die<br />
beruflichen Chancen, wirkt sich die männliche Dominanz<strong>und</strong><br />
Durchsetzungskultur deutlich aus, zumal sie sich in der<br />
sozialen Umgebung <strong>und</strong> der Gesellschaft spiegeln kann.<br />
Solche geschlechtstypischen Effekte treten in der Schule umso<br />
stärker hervor, je mehr sie für viele Kids <strong>und</strong> Jugendliche zum<br />
alltäglichen Sozial- <strong>und</strong> Beziehungsraum wird, in dem Gruppenerlebnis,<br />
soziale Anerkennung <strong>und</strong> Wirkmöglichkeiten<br />
auch jenseits <strong>des</strong> Unterrichts gesucht werden. Diese Versozialräumlichung<br />
der Schule hält in dem Maße an, in dem die<br />
Räume für Kids in der Freizeit enger, die Möglichkeiten,<br />
Gruppen zu bilden, kleiner <strong>und</strong> die Aufnahme von gegenseitigen<br />
Beziehungen auf der Straße schwieriger werden. Sie setzt<br />
geschlechtstypisches Verhalten, das bisher verdeckt war oder<br />
außerhalb der Schule ausgelebt wurde, nun im Schulalltag frei<br />
(vgl. auch Faulstich-Wieland u.a. 2004).<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich bleibt der Schule aber auch in ihrer inneren<br />
Schulorganisation die Aufgabe, dass in den Lerninhalten <strong>und</strong><br />
den unterrichtlichen Umgangsformen eine größere Solidarität<br />
unter den Geschlechtern übermittelt <strong>und</strong> vorgelebt wird. Das<br />
bedeutet auch, dass Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen die Chance bekommen,<br />
die Spannung zwischen der Lehrerrolle (die auch<br />
wieder nur ein Ausschnitt ihrer Persönlichkeit ist), welche die<br />
Schule ihnen abverlangt <strong>und</strong> der Lehrerpersönlichkeit, die die<br />
Schüler herausfordern, zu reflektieren. In der Lehrerrolle tritt<br />
der Umstand zurück, dass Lehrer auch Männer <strong>und</strong> Frauen<br />
sind; dieses wiederum wird aber in dem Maße freigesetzt, in<br />
dem die Schüler sozialräumlich agieren <strong>und</strong> Lehrerinnen entsprechende<br />
Beziehungsaufforderungen erfahren. Wenn LehrerIrcnen<br />
mit ihrem Mann- <strong>und</strong> Frausem nicht im Kontext ihres<br />
Lehrerseins umgehen können, dann müssen sie zwangsläufig -<br />
von ihrer Rollenorientierung her - in traditionale, das heißt<br />
155
von der Schulorganisation her praktikable Geschlechterorientierungen<br />
verfallen (vgl. dazu Keller 1997). Dann suchen sie<br />
weiter die Mädchen als ruhenden Leistungspol <strong>und</strong> überlassen<br />
den Jungen den Auffälligkeitspol.<br />
Der Übergang in den Beruf<br />
fieses geheime Geschlechtercurriculum der Schule bricht in<br />
dem Maße in der Übergangsphase in den Beruf auf, in dem<br />
diese neue Bewältigungsprobleme mit sich bringt. Denn der<br />
ökonomische <strong>und</strong> technologische Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft<br />
hat nicht nur zu einem relativ gleich bleibenden<br />
Sockel von struktureller Massenarbeitslosigkeit geführt, sondern<br />
auch die Übergänge in den Beruf <strong>und</strong> Berufsperspektiven<br />
insgesamt für viele junge Leute fragil gemacht. Auf der einen<br />
Seite gibt es Familien, die genug ökonomisches <strong>und</strong> kulturelles<br />
Kapital besitzen, um ihren Kindern Umwege zu gestatten,<br />
damit sie nicht der negativen Dynamik <strong>des</strong> beruflichen Scheiterns<br />
<strong>und</strong> der Aussichtslosigkeit von Berufsperspektiven ausgesetzt<br />
sind: Sie sollen experimentieren können, Unterschiedliches<br />
ausprobieren, bis in die Mitte <strong>des</strong> zweiten Lebensjahrzehntes<br />
oder gar bis zum dreißigsten Lebensjahr sich ein soli<strong>des</strong><br />
<strong>und</strong> reflexives biografisches F<strong>und</strong>ament geschaffen haben,<br />
von dem aus sie für die zukünftigen Wechselfälle einer flexibilisierten<br />
Arbeitsgesellschaft gerüstet sind. Auf der anderen<br />
Seite stehen die vielen Familien, die diesen ökonomischen<br />
<strong>und</strong> kulturellen Kapitalstock nicht besitzen <strong>und</strong> die ihre Jugendlichen<br />
früh den neuen Risiken der Arbeitsgesellschaft<br />
aussetzen müssen.<br />
iese Risiken haben sich inzwischen so verdichtet, dass<br />
durchaus von einer Entstrukturierung bis Entgrenzung beruflicher<br />
Sozialisation gesprochen werden kann. Im deutschen<br />
Ausbildungssystem spielt der Beruf <strong>und</strong> seine klar umrissene<br />
qualifikatorische wie institutionelle Profilierung immer noch<br />
die zentrale Rolle. „Etwas (im Leben) werden" ist - für Jungen<br />
<strong>und</strong> Männer seit jeher besonders - zentral auf den Beruf fixiert.<br />
Nun droht der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft<br />
von zwei Seiten her diese Konstruktion auszuhebeln. Zum einen<br />
hat sich die Zahl der Ausbildungsberufe in den letzten<br />
Jahren dramatisch (von ca. 900 auf 350) verringert. Entweder<br />
156<br />
wurden die darin enthaltenen Tätigkeiten computerisiert oder/<strong>und</strong><br />
sind aus früher verschiedenen in ein heute einziges<br />
erufsprofil zusammengeflossen. Gleichzeitig ist mit dem raschen<br />
<strong>und</strong> stetigen technologischen Wandel in der Branchen<strong>und</strong><br />
Marktstruktur nicht mehr die Selbstverständlichkeit gegeben,<br />
später einmal in dem erlernten Beruf arbeiten zu können.<br />
Nur knapp die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland ist<br />
heute noch in ihrem Ausbildungsberuf tätig. Der Beruf ist aber<br />
weiter die Eingangsvoraussetzung in den Arbeitsmarkt. Andere<br />
europäische Länder (z.B. die Niederlande oder auch Dänemark)<br />
haben hier die Konsequenzen gezogen <strong>und</strong> sind von der<br />
starren Ausbildung in Berufe zur biografisch flexiblen <strong>und</strong><br />
ausbaufähigen modularen Ausbildung übergegangen. Damit<br />
wird auch eine Entkoppelung von biografischer <strong>und</strong> beruflieher<br />
Integration in die Gesellschaft erreicht. Wir werden im<br />
Kapitel über das Junge-Erwachsenenalter sehen, dass für viele<br />
junge Männer Identitätsfindung <strong>und</strong> soziale Integration in dieser<br />
Lebensphase längst nicht mehr in eins gehen, obwohl der<br />
Beruf weiterhin als Fokus beider Entwicklungsperspektiven<br />
gilt. Gleichzeitig zeigen die biografischen Bef<strong>und</strong>e aus unseren<br />
Dresdner Projekten zur Übergangsforschung (Arnold u.a.<br />
2004), dass - gerade bei jungen Männern - der verwehrte Zugang<br />
zum Arbeitsmarkt auch den Zugang zum Selbst einschränkt,,d.h.<br />
dass es eher zur Abspaltung der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Hilflosigkeit <strong>und</strong> eben zur Freisetzung naturalistischmaskuliner<br />
Durchsetzungsorientierung in der Geschlechterkonkurrenz<br />
kommen kann, die angesichts der gleichberechtigten<br />
Bildungschancen <strong>und</strong> vergleichbaren Bildungsabschlüsse<br />
von Jungen <strong>und</strong> Mädchen schon aufgehoben schien. Das, was<br />
wir am Beispiel <strong>des</strong> versteckten Geschlechtercurriculums der<br />
Schule diskutiert haben, dass Jungen unter der Hand antisoziales<br />
Durchsetzungsverhalten lernen, kommt nun zum Zuge. So<br />
ist es auch plausibel, dass sich bei denen, die im mittleren Bereich<br />
der qualifizierten Berufe reüssiert haben, eine deutlich<br />
stärkere Geschlechterangleichung vollzogen hat als in der<br />
breiten Peripherie niedrig qualifizierter <strong>und</strong> prekärer Arbeitsverhältnisse,<br />
in der erzwungene Mobilität <strong>und</strong> Flexibilität<br />
herrscht: Man verliert einen Job, findet woanders einen neuen<br />
<strong>und</strong> es kommt darauf an, wie ungeb<strong>und</strong>ene man ist. Fier haben<br />
wieder die Männer die besseren Karten als die Frauen: Diese<br />
157
sind stärker ans )-laus <strong>und</strong> die Familie geb<strong>und</strong>en oder schon in<br />
der Vorstellung von der zukünftigen Schwierigkeit, Kinder<br />
<strong>und</strong> Beruf zu vereinbaren, gefangen.<br />
ennoch droht jungen Männern ein Orientierungsdilemma,<br />
das sich im Jungen-Erwachsenen-Alter zum Integritätsproblem<br />
aufschaukeln kann. Thomas Kreher hat in seiner empirisehen<br />
Studie zur Kompetenzentwicklung junger Männer<br />
(2004) gerade bei Jugendlichen mit prekären Ausbildungs<strong>und</strong><br />
Berufsperspektiven biografische Orientierungsmuster angetroffen,<br />
die immer noch auf das Normalarbeitsverhältnis mit<br />
entsprechend lebenslang gesichertem Lebensstandard fixiert<br />
sind, obwohl ihre prekäre aktuelle Lage diese Prognose überhaupt<br />
nicht hergibt. Wenn sie schließlich dieses Dilemma spüren,<br />
entwickeln sie typische männliche Bewältigungsformen:<br />
Sie spalten das Problem ab, rationalisieren es als außenverursacht<br />
<strong>und</strong> positionieren sich über die Abwertung anderer (z.B.<br />
Sozialhilfeempfänger). Aber auch junge Männer, die nicht in<br />
solchen prekären Situationen sind, haben es heute schwer, Lebenswunsch<br />
<strong>und</strong> Lebenswirklichkeit rechtzeitig so miteinander<br />
in Einklang zu bringen, dass sie mit dem Ende <strong>des</strong> zwanzigsten<br />
Lebensjahres auf ein tragfähiges F<strong>und</strong>ament für ihre<br />
weitere Lebensphase bauen können. Der Strukturwandel der<br />
Arbeitsgesellschaft zwingt viele in immer wieder neue Versuche<br />
<strong>und</strong> Abbrüche, so dass heute schon der Slogan von der<br />
,quarter-life-erisis' (s.u.) die R<strong>und</strong>e macht. Für junge Männer<br />
sind solche frühen Integritätskrisen immer auch Sinnkrisen, da<br />
sich viele von ihnen ja weiterhin in einem möglichst gut dotierten<br />
Arbeitsverhältnis <strong>und</strong> in ihrer männlichen Verantwortung<br />
für eine Familie erfüllen möchten. Der Sinnbezug Kinder<br />
großziehen', der jungen Frauen neben dem Beruf offen<br />
steht, scheint ihnen dagegen subjektiv wie von den gesellschaftlichen<br />
Bedingungen her immer noch verwehrt.<br />
3.7 Die männliche Clique<br />
Das Bestreben, sich aus seinem unwirklichen' Selbst heraus<br />
wirklich zu fühlen <strong>und</strong> dies sozial durchsetzen zu können, bildet<br />
die emotionale Hintergr<strong>und</strong>struktur riskanter bis antisozialer<br />
Haltungen bei Jugendlichen. Dieses Streben erhält seinen<br />
sozialen Rahmen in der subkulturellen Szenerie der Jugendkultur<br />
(Gleichaltrigenkultur), welche die Gelegenheit bietet,<br />
das Unwirkliche sozial wirklich werden zu lassen <strong>und</strong> die ihm<br />
innewohnende antisoziale Tendenz zu kanalisieren. So entsteht<br />
der „kulturelle Block" (Winnicott) der Jugend in eigener<br />
Musik, Kleidung, eigenen sozialen Verkehrsformen <strong>und</strong> Abgrenzungsritualen.<br />
Der subkulturelle Mechanismus der<br />
Gleichaltrigenkultur erlaubt es, dass das Unwirkliche sozial<br />
gelebt <strong>und</strong> dennoch - in Schule <strong>und</strong> Ausbildung - die zentralen<br />
Entwicklungsaufgaben <strong>des</strong> Übergangs in die gesellschaftliche<br />
Kultur (Arbeit) angepackt <strong>und</strong> gelöst werden können. Wo die<br />
Subkultur diese Balance zur Gesellschaft allerdings nicht hat,<br />
wirkt sie nur nach innen auf die Anerkennung <strong>des</strong> Selbst so<br />
wie es in seiner Unwirklichkeit ist, nach außen aber verstärkt<br />
sie die antisoziale Tendenz <strong>des</strong> unwirklichen jugendlichen<br />
Protests. Der gesellschaftliche Faden reißt, wenn der jugendliehe<br />
Protest sozial übergangen wird, wenn Schule <strong>und</strong> Arbeit<br />
„zerstörbar" sind, das heißt den Jugendlichen nichts entgegensetzen<br />
<strong>und</strong> somit keinen Realitätsgewinn erzeugen können.<br />
ies geschieht dann, wenn die Schule nicht mehr sozial verbindlich,<br />
die Arbeitsperspektive bedroht scheint. Die subkulturelle<br />
Gruppe dient dann als Ersatz für eine fördernde Umwelt,<br />
an die man sich klammert, weil sie als der einzige Ort<br />
scheint, wo noch das gilt, was aus einem selbst kommt.<br />
Nun wissen wir aus der Jugendforschung, dass Straßencliquen<br />
meist von Jungen aus der Unterschicht dominiert sind. Jungen<br />
- so haben wir in den bisherigen Hinweisen zur männlichen<br />
Sozialisation erfahren - werden in der Erziehung früh nach<br />
außen gedrängt <strong>und</strong> sind auf ihrer Suche nach männlicher Geschlechteridentität<br />
dem strukturellen Mechanismus von Idolisierung<br />
(<strong>des</strong> Männlichen) <strong>und</strong> Abwertung (<strong>des</strong> Weiblichen,<br />
Schwachen) ausgesetzt. Das Streben nach einem „unwirklichen<br />
Selbst" ist bei den Jungen <strong>des</strong>halb stärker nach außen<br />
verwiesen als bei den Mädchen, die männliche Antriebsstruktur<br />
von Idolisierung <strong>und</strong> Abwertung hat in der pubertären<br />
Konstellation von Unwirklichkeit <strong>und</strong> narzisstischer Ausrichtung<br />
<strong>des</strong> Selbst eine verblüffende Entsprechung. In der Verbindung<br />
von Unwirklichkeit <strong>des</strong> Selbst <strong>und</strong> der Suche nach<br />
Wirklichkeit wird das männliche Idol <strong>und</strong> die Abwertung <strong>des</strong><br />
Weiblichen zum Wirklichen.<br />
159
ies alles bedeutet wiederum nicht, dass die (männliche) Clique<br />
deviant werden muss. Es kommt wieder darauf an, von<br />
welchen biografischen Ausgangssituationen aus die Jugendlichen<br />
in die Clique gehen (z.B. Jungen mit gestörter männlicher<br />
Geschlechtsidentifikation <strong>und</strong> verhärteten familialen Verlusterfahrungen)<br />
<strong>und</strong> wie sich die Struktur der Clique entwickelt<br />
(autoritär oder unterschiedliche individuelle Strömungen<br />
zulassend). Cliquen sind aus psychoanalytischer, soziologischer<br />
<strong>und</strong> pädagogischer Gesamtsicht alterstypische bedien<br />
der Regulation, mit denen Triebdynamik kanalisiert, soziale<br />
Differenzierung entwickelt <strong>und</strong> Übergangssituationen bewältigt<br />
werden. Sie sind <strong>des</strong>halb potenziell' deviant, weil sie<br />
subkulturell angelegt sind (sein müssen). In ihnen symbolisieren<br />
sich die Ablösung von der Herkunftsfamilie (das Nicht<br />
mehr) <strong>und</strong> der unstrukturierte <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb normdiffuse bis<br />
normverweigernde Übergang in das spätere Erwachsenenalter<br />
(das von sich weggeschobene Noch-nicht) gleichermaßen.<br />
Die Jugendlichen in der Clique sind alle im gleichen Gefühl<br />
gefangen: Sie haben sich von den Eltern in ihrer Gefühlswelt<br />
gelöst, sie geben die Eltern als Liebesobjekte auf <strong>und</strong> haben<br />
gleichzeitig noch Angst <strong>und</strong> Scheu vor der eigenverantwortlichen<br />
sozial gerichteten <strong>und</strong> verbindlichen Sexualität. Dadurch<br />
erhält die Clique eine hohe emotionale Dichte: „In der starken<br />
libidinösen Besetzung der Gruppe liegt offensichtlich auch die<br />
Ursache für ihre spätere Mystifizierung" (Schröder 1991, S.<br />
94/95). Kieses Zusammenspiel von Sexualangst <strong>und</strong> emotionaler<br />
Dichte lässt die Idolisierung <strong>des</strong> Männlichen erst recht<br />
aufblühen, auch wenn man sich als Einzelner eher als Jugendlicher<br />
denn als junger Mann fühlt. In der Clique aber wird<br />
Maskulinität freigesetzt, wird zum Strukturierungsprinzip <strong>des</strong><br />
Cliquenverhaltens nach innen wie außen.<br />
Die geschlechtstypische Dynamik solcher Jungencliquen ist -<br />
offen oder versteckt - vom Mechanismus der Abwertung <strong>und</strong><br />
Idolisierung geprägt. Gleichzeitig spielen oft die Mädchen, die<br />
in solchen Cliquen sind, eine bezeichnende Rolle: Bei den äußeren<br />
Aktivitäten der Gruppe, im äußeren Machtgefüge spielen<br />
sie eine untergeordnete Rolle. Die Jungen lassen an ihnen<br />
ihr männliches Überlegenheitsgefühl aus <strong>und</strong> werten sie immer<br />
wieder ab oder weisen sie zurück, demütigen sie. Im inne-<br />
160<br />
ren Gefüge solcher Cliquen spielen dagegen Mädchen eine<br />
sehr dominante Rolle, sie tragen vor allem zum Zusammenhalt<br />
der Clique bei, sie vermitteln bei Streitigkeiten <strong>und</strong> Konflikten<br />
nach innen <strong>und</strong> außen, sie sind es auch - <strong>und</strong> das ist in<br />
Jugendcliquen immer gefürchtet -, welche durch das Einfädeln<br />
einer Partnerbeziehung einzelne Jugendliche aus der Clique<br />
herausbrechen: Mit der festen Fre<strong>und</strong>in scheint der Junge für<br />
die Clique verloren. So ist die Jungenciique, die doch so wichtig<br />
ist für den Übergang <strong>des</strong> Jungen von der Familie in die gesellschaftliche<br />
Realität <strong>und</strong> in der die meisten Jungen nach ihrer<br />
Familien-, Kinder- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulzeit, in der sie meist<br />
von Frauen begleitet wurden, zum ersten Mal unter Männern<br />
sind, kein echter Haltepunkt in der Findung männlicher Identität<br />
<strong>und</strong> selbstbestimmter Verhältnisse zu Frauen, sondern kann<br />
zu einem weiteren Kristallisationspunkt <strong>des</strong> männlichen Dilemmas<br />
im Lebenslauf werden. Viele Jungen haben auch hier<br />
wieder keine Beziehung zu sich selbst, keine Ruhe auf der Suche<br />
nach Männlichkeit, keine Gewissheit im Verhältnis zu<br />
Mädchen <strong>und</strong> Frauen gef<strong>und</strong>en. Im Gegenteil: Es spielen sich<br />
hier oft Verhaltensmuster gegenüber Mädchen ein, die dann<br />
auch im späteren Leben im Verhältnis zu Frauen immer wiederkehren.<br />
Jungen spüren, wie sie sich nach Emotionalität <strong>und</strong><br />
Bindung sehnen, wollen sich Mädchen entsprechend nähern,<br />
sind aber nicht imstande, dieses Gefühl in entsprechen<strong>des</strong> soziales<br />
Verhalten umzusetzen, da ihnen dies seit der Kindheit<br />
immer wieder manifest oder latent verwehrt wurde. Sie fühlen<br />
weiblich, nähern sich aber den Mädchen männlich, mit Imponiergesten<br />
oder einer verbalen bis hin zur körperlichen Anmache,<br />
auf die heute viele selbstbewusste Mädchen nicht mehr<br />
reagieren. So kann sich ein missverständliches „Umwegverhalten"<br />
Mädchen gegenüber entwickeln.<br />
Umwegverhalten<br />
Um eigene Schwächen <strong>und</strong> Unsicherheiten zu verbergen, ,verstecken`<br />
sich Jungen nicht selten hinter Verhaltensweisen, die<br />
Bedürfnisse nicht direkt, sondern über einen Umweg ausdrücken.<br />
Sie werden als symbolisch` bezeichnet, weil das Gegenüber<br />
die Aufgabe erhält, die jeweilige Strategie zu entschlüsseln.<br />
Strategisches Verhalten äußert sich vor allem im<br />
Umgang mit Mädchen: Die Annäherung an Fädchen läuft
häufig über Anmache (positives Moment: Zuneigung zu Mädchen,<br />
Suche von Nähe <strong>und</strong> Geborgenheit; negatives Moment:<br />
Der Junge muss vor anderen, insbesondere vor der Clique, seinen<br />
Mann stehen, er darf sich nicht dem Mädchen ,unterwerfen').<br />
Oft wird dieses Verhalten von Mädchen gefördert` <strong>und</strong><br />
unterstützt, z.B. durch Kichern oder durch das Zulassen solcher<br />
Annäherungen. Strategisches Jungenverhaiten ist also ambivalentes<br />
Verhalten. Jungen lassen ihre innere männliche Hilflosigkeit<br />
nicht nur in frauenabwertenden Abstraktionen <strong>und</strong> Projektionen<br />
aufgehen, sondern senden durchaus empathische Signale<br />
nach außen, die aber in der Regel missachtet oder nicht so entschlüsselt<br />
werden. Strategisches Verhalten ist meist ritualisiert,<br />
dies gibt dem Jungen Sicherheit: Er muss sich nicht offenbaren,<br />
sich nicht stellen, so kann man vor der Clique das<br />
Gesicht wahren. Jungen, die nicht in einer festen Gleichaltrigengruppe<br />
sind, werden dennoch über die Ausstrahlung der<br />
Gleichaltrigenkultur entsprechend beeinflusst. Allerdings sind<br />
sie der permanenten Gruppenkontrolle <strong>und</strong> ihrem Konformitätsdruck<br />
nicht so stark ausgesetzt. Jungen, die gern viel mit<br />
Mädchen zusammen sind, sind offener für ein anderes als das<br />
gängige männliche Verhalten.<br />
(Überarbeiteter Auszug aus Böhnisch, L./Winter, R.: Männliche<br />
Sozialisation 1993, S. 86/87)<br />
In Cliquen wird auch Risikoverhalten kultiviert, es hält sie zusammen.<br />
Der Begriff <strong>des</strong> Risikoverhaltens drückt zweierlei<br />
aus. Zum einen signalisiert er den Experimentaleharakter der<br />
Jugendphase, zum anderen, dass die Jugendzeit sich von der<br />
gesellschaftlich eingerichteten Schonphase Jugend hin zur Risikophase<br />
Jugend entwickelt hat. Jugendliche verhalten sich<br />
„riskant", wenn sie sich selbst (aber auch andere) in ihrer leibseelischen<br />
Integrität gefährden oder diese gar zerstören, weil<br />
sie nicht mehr die Grenzen zwischen kulturellem Experiment<br />
<strong>und</strong> sozialem Bewältigungsdruck kalkulieren können. Deshalb<br />
hat Risikoverhalten heute vielfach die jugendkulturelle Unbefangenheit<br />
verloren, weil die Jugendphase längst nicht mehr<br />
den Schutz <strong>des</strong> Moratoriums genießt (Entgrenzung der Jugend)<br />
<strong>und</strong> früh unter sozialem Problemdruck steht. Dennoch<br />
gehört Risikoverhalten zum Spezifikum männlicher Sozialisation.<br />
In ihrem Bestseller „Kleine IJelden in Not" (1990) füh-<br />
162<br />
ren Schnack/Neutzling plastisch vor, wie Jungen Anerkennung<br />
oft nur durch Risikoverhalten <strong>und</strong> die „mannhafte" Bewältigung<br />
seiner Folgen (,Ein Indianer kennt keinen Schmerz')<br />
erlangen können, auch wenn sie eigentlich darauf nicht abfahren<br />
bzw. Angst davor haben. Männliches Risikoverhalten<br />
zeigt sich dabei stärker in der Selbst- <strong>und</strong> Fremdgefährdung<br />
nach außen (Alkohol- <strong>und</strong> Verkehrsrausch, Einlassen in Gewaltszenen),<br />
weibliches Risikoverhalten richtet sich eher nach<br />
innen (Medikamentenmissbrauch, Magersucht). Beide treffen<br />
sich in der Drogenkultur. Mieses Risikoverhalten ist durch die<br />
Unwirklichkeits-Wirklichkeits-Spannung <strong>des</strong> pubertären Jugendalters<br />
besonders aufgeladen. Es vermittelt ein Lebensgefühl,<br />
in dem Wohlsein <strong>und</strong> Unwohlsein, Omnipotenzerleben<br />
<strong>und</strong> (dennoch nicht zu verscheuchende) psychosoziale Belastung<br />
gegeneinander bestehen. Solange sich - in der jugendkulturellen<br />
Dynamik - die Grenzen <strong>des</strong> Selbsterlebens hinausschieben<br />
lassen, so lange überwiegt der Rauschzustand <strong>des</strong><br />
jugendkulturellen Kicks. Sind solche Grenzen aber subkulturell<br />
<strong>und</strong> sozialräumlich überschritten, droht Auffälligkeit <strong>und</strong><br />
damit Kriminalisierung <strong>des</strong> Verhaltens.<br />
In dieser räumlichen Perspektive zeigt sich auf, wie ambivalent<br />
die Außenzentrierung männlicher Sozialisation sein kann.<br />
Auf der einen Seite erwerben Jungen früh sozialräumliche<br />
Kompetenzen, auf der anderen Seite geraten sie damit auch<br />
eher in Zonen sozialer Auffälligkeit <strong>und</strong> Kontrolle. Eine Jungenclique<br />
entsteht im ausdrücklichen räumlichen Bezug einer<br />
Gleichaltrigengruppe. Jungen besetzen' <strong>und</strong> kontrollieren<br />
Räume, ihr Verhalten ist ,Territorialverhalten'. Männliche<br />
ominanz drückt sich hier schon früh in den verschiedensten<br />
Formen jugendkultureller räumlicher Dominanz aus. Dieses<br />
Raumverhalten strukturiert sich nämlich auch über Ausgrenzung,<br />
<strong>Zur</strong>ückdrängung anderer Jungen, die nicht der Clique<br />
angehören <strong>und</strong> äußert sich nicht zuletzt auch in der räumlichen<br />
<strong>Zur</strong>ücksetzung von Mädchen. Die männliche Abwertung<br />
der Frau setzt ihre ersten Zeichen im räumlichen Jungenverhalten<br />
der ,Anmache', aber auch in der räumlich demonstrierten<br />
Beschützerpositur' der Jungen.<br />
ie raumgreifende Jungenclique ist somit der soziale Ort, wo<br />
sich die Muster männlichen Bewältigungsverhaltens, wie wir
165
len Ordnung <strong>und</strong> Rollenteilung. In Anlehnung an Werner<br />
Schiffauers berühmte Studie „Die Gewalt der Ehre" (1953)<br />
sieht Tertilt darin die Matrix <strong>des</strong> „Spiel(s) von Herausforderung<br />
<strong>und</strong> Gegenherausforderung", in dem sich Selbstwert <strong>und</strong><br />
Status der jungen Männer aufbauen: „Die Verteidigung der<br />
eigenen wie auch der Familienehre erfordere die ständige Bereitschaft<br />
<strong>des</strong> Mannes, Provokationen, die an ihn <strong>und</strong> seinen<br />
Haushalt herangetragen werden, phallisch aggressiv zu beantworten.<br />
Wieder geht es darum, die Grenzen der Integrität<br />
<strong>und</strong> damit den Schutz der Person zu behaupten" (Tertilt 1996,<br />
S. 197).<br />
Dies muss man wissen, um die maskuline Aggressivität junger<br />
Migranten einordnen zu können, die eben dann einsetzt, wenn<br />
die Jugendlichen das Gefühl haben, dass sie nicht mehr Herr<br />
ihrer Grenze <strong>und</strong> damit ihrer Ehre sind. „Wer als Mann die<br />
eigene Ehre sowie die seiner Familie nicht bewahren kann,<br />
wer sie durch passiv-unterwürfiges Verhalten preisgibt, anstatt<br />
der Herausforderung entschieden entgegenzutreten, [...] wird<br />
aus der Männerwelt ausgeschlossen" (ebd., S. 215). Die damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Rituale gelten als Strukturübungen' der Clique,<br />
die sich darüber ihres Zusammenhaltes, ihrer Rangordnung<br />
<strong>und</strong> ihrer Abgrenzung nach außen versichert.<br />
Zwei Bef<strong>und</strong>e lassen in diesem Zusammenhang die besondere<br />
Bewältigungslage junger Männer mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
in einem jugendspezifischen Licht erscheinen. Zum einen die<br />
Ergebnisse einer nationalitätenvergieichenden Studie aus dem<br />
Sechsten Familienbericht (vgl. Nauck 2000), nach denen diese<br />
normativ überhöhten Männlichkeitsorientierungen bei Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergr<strong>und</strong> wesentlich stärker ausgeprägt<br />
sind als bei ihren Vätern. Zum anderen die Beobachtung,<br />
dass diese Fixierung auf die männliche Ehre auch bei<br />
türkischen Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen<br />
sind <strong>und</strong> in zentralen Belangen der Lebensführung als kulturell<br />
integriert gelten, anzutreffen ist (vgl. dazu Bohnsack<br />
2002). Dies verweist auf ein Zusammenspiel von sozialer Benachteiligung<br />
<strong>und</strong> ethnischer Abwertung, dem sich Jungen<br />
ausländischer Herkunft emotional <strong>und</strong> sozial gerade in den<br />
ethnozentristischen Milieus der Gleichaltrigenkultur ausgesetzt<br />
sehen, dem sie mit dieser normativ überhöhten Maskuli-<br />
16 6<br />
nität zu begegnen versuchen. Denn in der eigenen bedrohlichen<br />
Psychodynamik <strong>des</strong> Mannwerdens <strong>und</strong> der gleichzeitigen<br />
Bedrohung durch die soziale Entwertung in der deutschen<br />
Gleichaltrigenkultur kann diese Maskulinität der türkischen<br />
Jugendlichen handlungsfähig machen, weil sie für den einheimischen<br />
Jugendlichen in dieser Eindeutigkeit <strong>und</strong> Konsequenz<br />
nicht erreichbar ist. Dadurch können die, die einen als<br />
Türken abwerten, nun selbst abgewertet werden. In der in diesem<br />
Zusammenhang häufig gebrauchten Provokation, den anderen<br />
als „schwul" anzumachen, bildet sich diese Bewältigungslogik<br />
ab. Denn dabei „geht es [...] weder um eine Abwertung<br />
im Sinne traditioneller Moral noch um die Unterstellung<br />
gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens. In erster Linie<br />
zielte sein [<strong>des</strong> türkischen Jungen, d. A.] Vorwurf auf meine<br />
Weigerung, seinen Herausforderungen auf eine männliche'<br />
Weise, das heißt, durch eine ebenso klare wie entschiedene<br />
Grenzziehung zu begegnen. Seinem Angebot, die Kräfte zu<br />
messen, hatte ich mich vollständig entzogen <strong>und</strong> war damit<br />
einer Konfrontation aus dem Weg gegangen. In seinen Augen<br />
erwies ich mich als unmännlich' <strong>und</strong> damit typisch<br />
deutsch"` (Tertilt 1996, S. 193). Dieses Muster der Verstrickung<br />
von jugendpubertärer <strong>und</strong> sozialer Hilflosigkeit <strong>und</strong> ihrer<br />
Abspaltung in überhöhte Maskulinität lässt sich in Gr<strong>und</strong>zügen<br />
auch bei deutschen Jugendlichen gerade aus sozial benachteiligten<br />
Milieus ausmachen. Dies ist ein Indiz dafür, dass<br />
der Faktor soziale Benachteiligung wesentlich auslösend für<br />
dieses Verhalten ist.<br />
3.8 Der männliche RechtsextremismUs<br />
Eine exemplarische Zuspitzung<br />
Rechtsextrem aufgeladene Cliquen beziehen ihr Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
aus der Abgrenzung gegenüber <strong>und</strong> der<br />
Abwertung von Schwächeren, vor allem auch Migranten.<br />
Ausländerfeindlichkeit ist nachgewiesenermaßen der Dreh<strong>und</strong><br />
Angelpunkt <strong>des</strong> Gruppenprozesses. Sie muss immer wieder<br />
verbal <strong>und</strong> in der öffentlichen Anmache demonstriert werden.<br />
Ausländerfeindliche Alltagsflipps <strong>und</strong> Events, meist von<br />
Einzelnen aus der Clique heraus angezettelt, steigern das An-<br />
167
sehen in der Gruppe <strong>und</strong> damit den fragilen Selbstwert. So ist<br />
es nicht verw<strong>und</strong>erlich, dass die Jugendrichter kein Unrechtsbewusstsein<br />
entdecken können; die Jungs tun es ja für die<br />
Gruppe, viele von ihnen sehen im Delikt gar nicht so sehr das<br />
Unrecht an anderen, sondern möchten sich vor der Gruppe<br />
beweisen, auch wenn es ihnen dabei mulmig ist.<br />
Auch von einem anderen Stereotyp der Interpretation können<br />
wir uns verabschieden. Unter den rechtsextremistisch auftretenden<br />
jungen Männern - so die Statistik - sind die arbeitslosen<br />
nicht überrepräsentiert. Es sind eher Bindungsstörungen,<br />
die aus der Familie resultieren, die durch die sozialen Schichten<br />
hindurch eine Konstante bilden. Natürlich spielen die sozialökonomischen<br />
Verhältnisse eine Rolle. Wenn man bedenkt,<br />
dass in der segmentierten Arbeitsgesellschaft (s.u.) in<br />
Deutschland zu Beginn <strong>des</strong> 21. Jahrh<strong>und</strong>erts fast die Hälfte<br />
der Erwerbsbevölkerung keinen gesicherten Arbeitsplatz im<br />
Sinne <strong>des</strong> bisher gewohnten Normalarbeitsverhältnisses hat<br />
<strong>und</strong> dass die Berufs- <strong>und</strong> Arbeitsplatzunsicherheit schon das<br />
enken der Jugend erfasst, dann wird plausibel, dass junge<br />
Männer bei früher Arbeitsplatzunsicherheit <strong>und</strong> Ausbildungskonkurrenz<br />
<strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ener gestörter sozialer Integrationsperspektive<br />
fürchten, sozial isoliert zu werden. Zu der<br />
Einsamkeit <strong>des</strong> Alters ist die Einsamkeit der Jugend gekommen.<br />
Solche jungen Männer suchen sozialen Anschluss <strong>und</strong><br />
vor allem auch Gewissheit - „ich möchte einen festen Platz<br />
haben" - <strong>und</strong> landen in autoritären bis rechtsextremen Gruppierungen,<br />
die ihnen mit ihrer rigiden Eindeutigkeit <strong>und</strong> Unterordnung<br />
bei<strong>des</strong> bieten können. Das sind dann nicht nur junge<br />
Männer aus sozial benachteiligten Milieus, sondern genauso<br />
Jugendliche aus anderen Schichten. So ist es inzwischen<br />
nichts Ungewöhnliches, dass Jungen, die unter der Woche unauffällig<br />
in monotonen, kontaktarmen Arbeitsverhältnissen<br />
stehen, am Wochenende als Fußball- oder Straßenhooligans<br />
zu ausländerfeindlichen <strong>und</strong> gewaltbereiten Szenen stoßen.<br />
Wenn man an solche Jugendliche herankommt, merkt man<br />
bald, dass sie Orte suchen, wo sie ihre Männlichkeit ausleben<br />
<strong>und</strong> demonstrieren können. Denn die Arbeitsvorgänge über<br />
die Woche hinweg sind bei den meisten so von Körperlichkeit<br />
<strong>und</strong> Maskulinität entleert, dass sie bei denen, die in puncto<br />
Selbstwert <strong>und</strong> Anerkennung auf Maskulinität angewiesen<br />
sind, eine Suche nach solchen sozialen Orten der aggressiven<br />
Maskulinität auslösen. Sie verfügen nicht über andere kulturelle<br />
<strong>und</strong> soziale Ressourcen um Selbstwert zu erlangen <strong>und</strong><br />
sich sozial auszudrücken. Da die jungen Männer der Gleichaltrigenkultur<br />
der Jugend schon entwachsen sind, machen sie<br />
sich oft mit ihrer Maskulinität in der Öffentlichkeit lächerlich.<br />
Auch Mädchen <strong>und</strong> jungen Frauen kann man damit nicht<br />
mehr so wie in früheren Zeiten imponieren. Also werden jene<br />
jungen Männer von offensichtlich „männlichen" Orten, wie<br />
sie fremdenfeindliche Cliquen darstellen, fast magisch angezogen.<br />
Hier handelt es sich um Gruppen, die durch Abgrenzung<br />
<strong>und</strong> Abwertung von Ausländern zusammengehalten <strong>und</strong><br />
bewegt werden. Gehört man einmal solch einer Gruppe oder<br />
situativ wechselnden Szene an, entwickelt diese nicht nur ihre<br />
eigene ethnozentrische Dynamik, sondern wird auch noch<br />
durch eine typische Irritation angeheizt. Denn die jungen<br />
Männer ausländischer Herkunft, die von Deutschen abgewertet<br />
werden, haben den Deutschen eines voraus: Viele von ihnen<br />
leben ihre Männlichkeit öffentlich <strong>und</strong> selbstverständlich<br />
aus, ihr Habitus der männlichen Ehre, <strong>des</strong> nationalen Stolzes<br />
<strong>und</strong> ihre Beschützerpose gegenüber Mädchen aus dem eigenen<br />
ethnischen Milieu ist unübersehbar (vgl. dazu Farin/Seidel-fielen<br />
1994). Darin ist auch die Selbstverständlichkeit<br />
eingewoben, mit der z.D. junge Türken ihre Maskulinität<br />
demonstrieren (s.o.), eine Selbstverständlichkeit, die junge<br />
Deutsche weder aufbieten, noch herstellen können. So kann<br />
sich in deutschen Cliquen ein Aufschaukelungsmuster von<br />
Fremdenfeindlichkeit <strong>und</strong> Maskulinität entwickeln, das dann<br />
an einem bestimmten Punkt nicht mehr beherrschbar ist.<br />
Was bleibt, <strong>und</strong> was von jungen Deutschen nicht selten als<br />
Gegenmittel gleicher Art aktiviert <strong>und</strong> zelebriert wird, ist die<br />
Regression, das <strong>Zur</strong>ückfallen in übersteigerte Maskulinität,<br />
mit der man(n) sich aus den Alltagsmustern der Zivilisation<br />
ausklinkt <strong>und</strong> in der sozialen Umwelt Abwehr <strong>und</strong> Furcht heraufbeschwört.<br />
Öffentliche Regressionen, die aus den Rollenmustem <strong>des</strong> zivilisierten<br />
Alltags herausfallen, erzeugen Angst oder zumin<strong>des</strong>t<br />
Unbehagen. Der Rückfall in die archaisch-körperliche Maskulinität<br />
gehört zu solchen unbewältigten <strong>und</strong> wiederkehrenden<br />
169
Entwicklungsbrüchen, die unter der Decke aufgeklärter Zivilisation<br />
schwelen <strong>und</strong> immer wieder hervorbrechen. Außerdem<br />
kommt hier noch ein neues Phänomen hinzu. Diese archaischaggressive<br />
Männlichkeit gibt sich öffentlich, ignoriert die gesellschaftlichen<br />
Ausgrenzungsversuche, zelebriert alltägliche<br />
Provokation: , Stigmaaktivisten'. Und meist gelingen diese<br />
Provokationen auch - auf der Straße, in der Tram <strong>und</strong> der Metro,<br />
auf Bahnhöfen. Die Passanten huschen ängstlich oder verhalten<br />
empört vorbei, die jungen Männer scheinen die Spannung,<br />
die sie erzeugen, zu genießen. All diese Beobachtungen<br />
lassen den Schluss zu, dass es ein diffuses gesellschaftliches<br />
Klima geben muss, das diese Provokationen trägt, auch wenn<br />
die meisten Bürger subjektiv peinlichst berührt sind.<br />
In der Spaßgesellschaft hat auch die soziale Provokation ihren<br />
neuen Platz <strong>und</strong> ihre entsprechende Bedeutung gef<strong>und</strong>en. Mit<br />
gewaltnahen Provokationen kann man nicht nur auf sich aufmerksam<br />
machen, sie können einem auch den emotionalen<br />
Kick geben, der mit den üblichen Alltagsflipps nicht mehr zu<br />
bekommen ist. In die ungenierte Provokationsszenerie der<br />
Medien - Gewaltfilme <strong>und</strong> Talkshows - den Verdrängungskampf<br />
am Arbeitsplatz <strong>und</strong> auf der Autobahn, der Armut im<br />
Reichtum, kann sich auch der alltägliche Rechtsextremismus<br />
junger Männer einfügen. Die Medien warten ja gerade darauf,<br />
sind richtig geil' auf extremistische Events. Somit ist es nicht<br />
abwegig, den Regressions-Provokations-Habitus junger Männer<br />
als paradoxes Muster gesellschaftlicher Teilhabe zu interpretieren<br />
<strong>und</strong> weniger als Mechanismus der Selbstausgrenzung.<br />
Auf sich aufmerksam machen, soziale Orientierung, Geborgenheit<br />
<strong>und</strong> Gewissheit suchen <strong>und</strong> erfahren wollen, dass man<br />
etwas losmachen kann <strong>und</strong> sei es über Gewalt <strong>und</strong> Provokation,<br />
das alles sind Charakteristika der Lebensphase Jugendlicher<br />
<strong>und</strong> junger Erwachsener im Übergang in die Arbeitsgesellschaft.<br />
Dieser Übergang ist in der Krise der Arbeitsgesellschaft<br />
für viele erschwert, ungewiss, für manche - im wiederkehrenden<br />
subjektiven Gefühl - aussichtslos geworden. Ein<br />
Pessimismus auf Zukunft ist aber in der Gegenwartsdynamik<br />
der Jugendzeit schwer lebbar. Deshalb die Abspaltung in unbedingten<br />
Gegenwartsoptimismus, den Jugendliche heute be-<br />
170<br />
tont suchen (vgl. Jugend 2002). Die jungen Männer, von denen<br />
hier die Rede ist, versuchen, sich auch im Alter von 25<br />
Jahren noch jugendkulturell auszuleben, obwohl sie mitten in<br />
gravierenden sozialen Belastungen <strong>und</strong> Bewältigungsproblemen<br />
stecken. Die Gesellschaft, die sie hilflos macht, bekommt<br />
diese Hilflosigkeit als Gewalt gegen die Schwächeren zurück.<br />
amit wären wir wieder bei den von Anno Gruen angebotenen<br />
Interpretationsmustern.<br />
Es ist ein brisantes Gemisch, das sich da im sozialstaatlich unzureichend<br />
flankierten <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb sozial rücksichtslosen<br />
Umbruch der Arbeitsgesellschaft bei der Jugend zusammenbraut.<br />
Denn das Modell „Jugend" der industriekapitalistischen<br />
oderne funktioniert nicht mehr so selbstverständlich <strong>und</strong><br />
durchgängig wie früher <strong>und</strong> wird auch weiterhin seine Integrationskraft<br />
verlieren. Dieses Modell - Integration durch Separation`<br />
- enthält ein typisches Funktionsmuster der modernen<br />
Vergesellschaftung von Jugend: Jugendliche werden aus der<br />
Gesellschaft zum Zwecke <strong>des</strong> Lernens, der Qualifikation <strong>und</strong><br />
damit zusammenhängend auf Gr<strong>und</strong> der Besonderheiten ihrer<br />
leibseelischen Entwicklung (Pubertät) ausgegliedert, um später<br />
- nun gereift` <strong>und</strong> qualifiziert - in die Arbeitsgesellschaft<br />
eingegliedert, integriert werden zu können. Voraussetzung dafür<br />
aber ist, dass dieser Mechanismus auch funktioniert, die<br />
von der Gesellschaft verantwortete <strong>und</strong> gewährte Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Verlässlichkeit, dass die Integration in die Arbeitsgesellschaft<br />
klappt, Beruf <strong>und</strong> Arbeitsplatz einigermaßen sicher <strong>und</strong><br />
erreichbar sind <strong>und</strong> der Sonder- <strong>und</strong> Schonraum Jugend nicht<br />
schon früh von sozialen Problemen überschattet wird. Bei<strong>des</strong><br />
ist aber heute nicht mehr so gegeben. Jugendliche <strong>und</strong> junge<br />
Erwachsene experimentieren immer noch relativ unbefangen<br />
<strong>und</strong> riskant, geraten aber früh unter sozialen Druck - Bitdungs-<br />
<strong>und</strong> Ausbildungskonkurrenz, sozialer Stress bei den<br />
Eltern - <strong>und</strong> merken dabei gar nicht, wie ihr riskantes Sozialverhalten,<br />
das ja eigentlich der sozialen Erprobung dienen<br />
soll, in riskantes Bewältigungsverhalten umschlägt (s.o.). Wir<br />
beobachten dies in der Drogenszene, wenn Jugendliche in unbefangener<br />
jugendkultureller Gewissheit behaupten, für sie sei<br />
es doch kein Problem, mit Drogen umzugehen, sie wollen sie<br />
ja nur ausprobieren, auch wenn sie dann - oft über Nacht -<br />
nicht mehr davon loskommen, weil sie sie zur Bewältigung
von sozialem Alltagsstress brauchen. Der Übergang vom Experimentierer<br />
zum User ist vollzogen, ohne dass es ihnen rational<br />
bewusst, dafür aber körperlich - somatisch zwangsläufig<br />
ist.<br />
Wenn dies eintritt, darin ist Jugend nicht mehr der Übergangsraum,<br />
in dem ohne großes Risiko <strong>und</strong> gesellschaftlich geschützt<br />
mit der gesellschaftlichen Gewissheit experimentiert<br />
werden kann, dass dies nur vorübergehend <strong>und</strong> im Erwachsenenalter<br />
zu Ende ist. Die statistischen Verlaufskurven zur Jugendkriminalität<br />
bestätigen: Mit Ende der Jugendphase - um<br />
das zwanzigste Lebensjahr - flacht die Kurve ab, das jugendtypische<br />
Muster <strong>des</strong> Risiko- <strong>und</strong> Deliktverhaltens verschwindet.<br />
Bei der zunehmenden Zahl derer aber, die im Jugendalter<br />
schon massive soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Scheitern<br />
an der Schulkarriere oder soziale Isolation erfahren <strong>und</strong><br />
bei denen jugendexperimentelles Verhalten <strong>und</strong> soziales Bewältigungsverhalten<br />
ineinander übergehen, droht eine Verstetigung<br />
<strong>des</strong> riskanten Bewältigungsverhaltens - geht auch das<br />
Gewaltverhalten über die Jugendphase hinaus.<br />
Dabei trifft es vor allem die jungen Männer, die außenfixiert<br />
agieren <strong>und</strong> in Gewaltzonen als letztmögliche Bewältigungsräume<br />
rutschen. In dem Maße, in dem der soziale Druck der<br />
arbeitsgesellschaftlichen Krise - schon in der Schule über die<br />
Eltern vermittelt - in die Jugendzeit hineinreicht, wird externalisiertes<br />
Verhalten zum Bewältigungsverhalten, spalten manche<br />
Jugendliche ihre soziale Hilflosigkeit in Gewalt - vermischt<br />
mit jugendkulturellem Experimentier- <strong>und</strong> Demonstrationsverhalten<br />
- ab. Bei den Schulabbrechern <strong>und</strong> den Herumirrern<br />
zwischen Aushilfs- <strong>und</strong> Billigjobs sind es vor allem die<br />
jungen Männer, die sich selbst nicht finden können <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb,<br />
in der Suche nach identitätsstiftender Handlungssicherheit<br />
unter dem Zwang stehen, auf rigide Männlichkeitsmuster<br />
zurückzugreifen. Mit dem Empfinden <strong>und</strong> der Demonstration<br />
von Maskulinität als zentralem Habituskern rechtsextremistisch<br />
eingestellter junger Männer tritt auch das latente Muster<br />
männlicher Sozialisation, das Zusammenspiel von Idolisierung<br />
<strong>des</strong> Maskulinen <strong>und</strong> Abwertung <strong>des</strong> Weiblichen (s.o.)<br />
orientierungs- <strong>und</strong> verhaltensleitend hervor. Frauen werden<br />
extrem abgewertet, benutzt <strong>und</strong> gleichzeitig sind es Frauen,<br />
die gebraucht <strong>und</strong> gesucht werden, wenn es darum geht, Geborgenheit<br />
<strong>und</strong> gefühlvollen Schutz zu erlangen. Die „eigenen"<br />
Frauen werden <strong>des</strong>halb wie Eigentum gegenüber Fremdgruppen<br />
geschützt. Hier wirkt ein Huster, das ähnlich auch für<br />
Hooligan-Gruppen beschrieben wird: „Ein Fan, der nicht<br />
Manns genug ist, seine Fre<strong>und</strong>in zu verteidigen, muss auch<br />
mit dem Verlust seiner sozialen Position rechnen. [...] Wenn<br />
Mädchen in der Szene auftauchen, dann erwartet man von ihnen<br />
auch die Eigenschaften <strong>des</strong> weiblichen Rollenstereotyps:<br />
Fürsorglichkeit, Opferbereitschaft, Selbständigkeit." „Ihre<br />
Hilfe wird [...] genau in den Bruchstellen der Männlichkeit<br />
gebraucht" (Becker 1990, S. 149f).<br />
ie rechtsextremistische Gruppenkultur wird durch Maskulinität<br />
strukturiert <strong>und</strong> zusammengehalten, ein Zusammenhalt<br />
der immer wieder neu inszeniert <strong>und</strong> demonstriert werden<br />
muss. Jochen Fersten (1993) hat diesen archaischen Aufbruch<br />
aggressiver Maskulinität in ein projektives Schema gebracht.<br />
anach werden männlich beanspruchte, historisch überkommene<br />
Gr<strong>und</strong>funktionen der Nachwuchszeugung (Generativität),<br />
<strong>des</strong> Schutzes <strong>und</strong> der Versorgung in Selbstwertkrisen<br />
wirkungsverkehrt aktiviert: Die öffentliche Betonung männlicher<br />
Potenz, gepaart mit Homophobie <strong>und</strong> Frauenfeindlichkeit<br />
verweist in dieser Interpretation auf die Erzeugerfunktion. Die<br />
öffentliche Betonung von Risikoverhalten, Kampfesmut <strong>und</strong><br />
der Hang zur Konfrontation spiegeln das Schutzmotiv umgekehrt<br />
wider. Und die „Ersatz-Skills" wie gefährliches Fahren<br />
oder Diebstahl von Autos, Teilnahme an organisierter Kriminalität<br />
<strong>und</strong> Bewegen in der Schattenökonomie lassen auf einen<br />
Negativabzug der männlich beanspruchten Tugend <strong>des</strong> Versorgens<br />
schließen (Kernten 1993, S. 53). Hier liegt der Kern<br />
für die Beantwortung der Frage, warum öffentlich demonstrierte<br />
Ausländerfeindlichkeit vor allem männlich ist, denn hier<br />
wirkt der Projektions- <strong>und</strong> Abspaltungsmechanismus wie ihn<br />
Arno Gruen aufgeschlossen hat: Innere Hilflosigkeit wird als<br />
edrohung von Männlichkeit erlebt <strong>und</strong> entsprechend abgespalten<br />
<strong>und</strong> auf „unmännliche" Objekte projiziert. Schließlich<br />
wirkt der Abstraktionsmechanismus: Die Opfer rechtsextremer<br />
männlicher Gewalt erscheinen den Tätern nicht als Opfer,<br />
sondern als eigengeschaffene Bezugssymbole wiederer-<br />
17 3
langter Männlichkeit mit hegemonialer (hier nationalistischer<br />
oder rassistischer) Rahmung.<br />
Schließlich spielt die Art <strong>und</strong> Weise, wie sich der jugendkulturelle<br />
Generationenkonflikt heute „gedreht` hat, bei der Entstehung<br />
rechtsextremer Gewaltdispositionen eine gewisse<br />
Rolle. Bei Jungen wendet er sich wiederum mehr nach außen<br />
als bei Mädchen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass sich in<br />
unserer Gesellschaft der typische Generationenkonflikt als<br />
Ablösungskonflikt von den Eltern entstrukturiert, entdramatisiert<br />
hat. Die früheren brisanten Auseinandersetzungen zwischen<br />
Jugendlichen <strong>und</strong> Eltern um Lebensstile, Werte <strong>und</strong> soziales<br />
Anpasssungsverhalten sind einer familialen Praxis <strong>des</strong><br />
Verständigens <strong>und</strong> <strong>des</strong> Aushandelns gewichen. Die Generationen<br />
leben heute in den Familien eher miteinander <strong>und</strong> nebeneinander<br />
als im Konflikt. Gleichzeitig gibt es aber auch in<br />
unserer Gesellschaft so gut wie keine Tabus mehr. Die klassischen<br />
Tabus als Reibungsflächen öffentlicher Generationenkonflikte<br />
- Sexualität <strong>und</strong> Sitte, Arbeitsmoral, Ordnung <strong>und</strong><br />
Unterordnung, abweichende Lebensformen - sind längst aufgelöst.<br />
Gerade dies aber wird in der Jugendforschung dann als<br />
problematisch angesehen, wenn Gesellschaft <strong>und</strong> Politik keine<br />
(respektierende) Auseinandersetzung mit der Jugend suchen,<br />
sondern sie links liegen lassen oder Teile von ihr kriminalisieren.<br />
Dies ist um so prekärer, als das Modell Jugend, nach dem<br />
zu leben die Gesellschaft von den Jugendlichen erwartet, für<br />
viele nicht mehr tragfähig <strong>und</strong> nur schwer lebbar ist. Deshalb<br />
ist es wohl kein W<strong>und</strong>er, wenn es Jugendliche gibt, die von<br />
den letzten gesellschaftlichen Tabus angezogen werden <strong>und</strong><br />
sich an ihnen aggressiv zu reiben versuchen. Das immer währende<br />
unbewältigte Tabu der b<strong>und</strong>esrepublikanischen Gesellschaft<br />
ist das „Auschwitz-Tabu", das von Generation zu Generation<br />
neu aufbricht <strong>und</strong> Jugendliche - einmal in linker, in<br />
den 1990er Jahren bis heute dann in rechter Tendenz - magisch<br />
anzieht. Auch so werden rechtsextreme Gewaltszenen<br />
für junge Männer attraktiv.<br />
So stellt sich insgesamt der Rechtsextremismus <strong>und</strong> die<br />
rechtsextreme Gewaltbereitschaft einer - allerdings nicht zu<br />
übersehenden - Minderheit junger Männer in Deutschland als<br />
komplexe Bewältigungskonstellation dar, in der die einzelnen<br />
174<br />
Einflussgrößen verschieden gewicheet sind <strong>und</strong> unterschiedlich<br />
zusammenspielen. Die Tiefenstruktur der männlichen Sozialisation,<br />
die im Aufwachsen <strong>und</strong> in der Erziehung von Jungen<br />
im Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Jugendalter angelegt ist, spielt dabei eine<br />
relative Rolle. Denn die Tendenz zur Abwertung von Schwächeren<br />
<strong>und</strong> die Idolisierung einer außenfixierten Männlichkeit,<br />
die der männlichen Sozialisation in unserer Gesellschaft strukturell<br />
innewohnt (s.u.), kann von den meisten Jugendlichen im<br />
Laufe ihrer Biografie sozial einigermaßen ausbalanciert werden.<br />
Bei den rechtsextremen jungen Männern dagegen schlägt<br />
innere Hilflosigkeit in manifeste Einstellungs- <strong>und</strong> Verhaltensweisen<br />
um, da diese Jugendlichen in ihren Familien <strong>und</strong><br />
ihrem sozialen Umfeld biografisch wenig Möglichkeiten hatten,<br />
diese tiefenstrukturellen Antriebe aus sich heraus <strong>und</strong> für<br />
sich zu thematisieren <strong>und</strong> sozial verträglich umzuformen. In<br />
den Szenen rechtsgepolter Jugendkultur finden sie ihre Resonanz<br />
<strong>und</strong> das entsprechende Lernfeld für rechtsextremes Verhalten.<br />
175