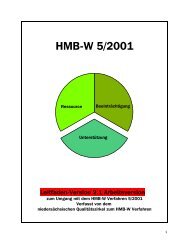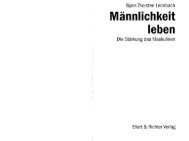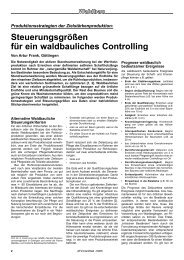3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
3.1 Zur Psycho® und Sozlodynamlk des Kindes - elearning.hawk ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Phantasien über den Vater überlassen bleibt, statt ihn in einer<br />
Welt erfahren zu können, in der es ihn durch Mittätigkeit kennen<br />
lernen kann" (1967, S. 193f). Hier ist schon das gemeint,<br />
was wir als Idolisierung von Männlichkeit durch die Jungen<br />
bezeichnen <strong>und</strong> das - so müssen wir hinzufügen - die Abwertung<br />
<strong>des</strong> Weiblichen fast zwangsläufig nach sich zieht.<br />
Heute drängen viele Männer aus eigenen biografischen Antrieben<br />
in die Familie hinein, werden aber gleichzeitig im Zuge<br />
der Intensivierung der Arbeit (bei höherer ökonomischer<br />
Verfügbarkeit <strong>des</strong> Mannes) wieder von der Familie weggezogen.<br />
Der Traum der männerbewegten Zirkel der 1990er Jahre,<br />
der „neue Mann" könne sich biografisch durchsetzen, auch<br />
wenn ihn das ökonomische System weiter vereinnahme, konnte<br />
sich so nicht erfüllen. Vielmehr hat sich ein bezeichnender<br />
Spannungszustand entwickelt, der sich in der neueren empirischen<br />
Väterforschung gut abbildet: Väter beteiligen sich deutlich<br />
mehr in den Familien, aber es scheint nicht für einen<br />
strukturellen Wandel hin zur Familienvaterschaft zu reichen.<br />
So hat sich zwar der entsprechende zeitliche Aufwand bei den<br />
Vätern im Durchschnitt wesentlich erhöht, er konzentriert sich<br />
aber vor allem auf das arbeitsfreie Wochenende sowie sportliche<br />
<strong>und</strong> spielerische Aktivitäten, während die Mithilfe bei<br />
pflegerischen <strong>und</strong> haushaltsbezogenen Arbeiten deutlich weniger<br />
zugenommen hat (vgl. Gonser 1994, Fthenakis 1999).<br />
Auch die Erwerbstätigkeit der Frau führt nicht zwingend zur<br />
partnerschaftlichen Teilung der Haushalts- <strong>und</strong> Familienaufgaben<br />
(vgl. BMFSJ 1997). Erhärtet werden diese Bef<strong>und</strong>e von<br />
der Kinderseite her. Der deutsche Kinder-Eltern-Survey Mitte<br />
der 1990er Jahre zeigte, dass Väter über den Alltag, die Einstellungen<br />
<strong>und</strong> die sozialen Beziehungen ihrer Finder wesentlich<br />
weniger Bescheid wissen als die Mütter (Zinnecker/Silbereisen<br />
1996). Viele Väter können also die für das<br />
Mannwerden notwendige Geschlechteridentifikation nicht anbieten.<br />
So sind es in der überwiegenden Mehrheit (85%) die<br />
Mütter, die über die Woche hinweg für die Kinder zuständig<br />
sind (BMSFJ 1997). Gisela Notz spricht in ihrer Väterstudie<br />
anfangs der 1990er Jahre sogar noch vom „Vater als Märchenprinz",<br />
der nur für „Action" zuständig ist <strong>und</strong> die alltägliche<br />
Pflege, in der sich ja Versorgung, Zuwendung <strong>und</strong> Identi-<br />
140<br />
fikationsdynamik miteinander verbinden, weiterhin der Mutter<br />
überlässt, auch wenn am Wochenende die Väter mehr als früher<br />
Pflegetätigkeiten übernehmen (Fthenakis 1999). Dass diese<br />
Mütterzentrierung in der frühkindlichen Phase von der<br />
Mehrheit der Bevölkerung als nicht problematisch, ja als<br />
selbstverständlich positiv angesehen wird, zeigt eine Repräsentativerhebung<br />
<strong>des</strong> Deutschen Jugendinstituts von<br />
1991/1992, nach der über zwei Drittel der westdeutschen Väter<br />
<strong>und</strong> Mütter der Antwortvorgabe „Kleinkinder sollten in<br />
den ersten drei Jahren bei der Mutter/in der Familie sein" zustimmten.<br />
Dem entspricht, dass viele der kinderbetreuenden<br />
Mütter mit ihrer Familienrolle so zufrieden sind, dass sie freiwillig<br />
auf die Erwerbstätigkeit verzichten <strong>und</strong> die ersten Lebensjahre<br />
ausschließlich für das Kind da sein wollen (Matzner<br />
1998; vgl. auch Döge/Volz 2002). Auch dies ist eine nicht zu<br />
unterschätzende Barriere für Männer, in die alltägliche Familienarbeit<br />
einzusteigen. So entsteht ein Verwehrungskreisel,<br />
der aber nicht als solcher erkannt, höchstens in anderen Bezügen<br />
(Bedürftigkeit) gespürt wird: Wird ein Kind geboren,<br />
kommen die Paare unter den Druck der Aushandlung, aus arbeitsorganisatorischen<br />
Gründen (Zusammenspiel zwischen<br />
externer männlicher Verfügbarkeit <strong>und</strong> Karriere), aber auch<br />
unter dem Einfluss geschlechtsdifferenter Lebenszufriedenheit<br />
zur traditionellen Rollenteilung zurück. Dies geschieht auch,<br />
wenn sie vorher in ihren Einstellungen <strong>und</strong> ihrer Lebenspraxis<br />
eine partnerschaftliche Rollenteilung in Haushalt <strong>und</strong> Beruf<br />
bevorzugt hatten (vgl. Notz 1991, Gonser 1994). Im Nachhinein<br />
- so zeigt eine entsprechende Väterstudie - wird dann die<br />
„verpasste Gelegenheit", das Auslassen <strong>des</strong> väterlichen Erziehungsurlaubs<br />
von einigen (allerdings im Gesamtsample eher<br />
wenigen) Männern nicht nur als Ursache für die mangelnde<br />
Intensität der weiteren Beziehung <strong>des</strong> Vaters zu dem Kind,<br />
sondern auch als Ursache für Unzufriedenheiten in der Partnerschaft<br />
gesehen (Vascovics/Rost 1999, S. 162f). Auch diese widersprüchlichen<br />
Konstellationen - viele Männer möchten gerne<br />
in die Familien hinein, können es aber nicht <strong>und</strong> rationalisieren<br />
dann zwangsläufig diese Verwehrung - verweisen wieder auf<br />
die Probleme der Entgrenzung der Männlichkeit. Die Rationalisierung<br />
geschieht dann vor allem über Begründungen wie Eingeb<strong>und</strong>ensein<br />
in die Arbeit <strong>und</strong> drohender Karriereverlust, zu