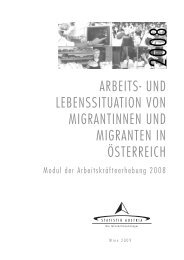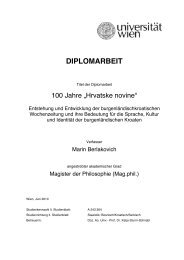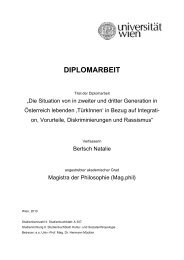Download PDF - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Download PDF - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Download PDF - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beide Positionen stehen in Einklang mit einem weit verbreiteten sprachideologischen<br />
Konsens, dass der Erwerb und die Gebrauchsextension des Deutschen auch in Österreich als<br />
zentrale Integrationsbereitschaft zu bewerten ist.<br />
Auch wenn die befragten Experten sprachideologisch mehrheitlich an den hegemonialen<br />
Diskursen über Deutsch als Integrationsvoraussetzung anknüpfen, zeichnen ihre<br />
Beschreibungen über die konkrete Sprachenpraxis auf den Baustellen ein sehr viel<br />
differenzierteres Bild, das theoretisch mit dem Begriff des „Sprachenregimes“ verstehbar<br />
gemacht werden kann. Sprachenregime bezeichnet ein Bündel an impliziten oder expliziten<br />
institutionellen, legislativen Regeln und Maßnahmen, Sprachideologien sowie<br />
habitualisierten Praktiken, die einen spezifischen Raum regeln (vgl. Busch 2009:131f). Der<br />
Begriff erlaubt es, sprachliche Regulationen nicht funktionalistisch vorauszusetzen, sondern<br />
diese als Verdichtungen sozialer (Sprach)Handlungen zu begreifen, die durch asymmetrische<br />
Macht‐ und Herrschaftsverhältnisse geprägt sind. Das Set an Regeln, sprachlichen Ideologien<br />
und Praktiken beschreibt demnach keine unbewegliche, starre Totalität. Ein solches<br />
Verständnis würde letztlich von der Möglichkeit einer vollkommenen Kontrollierbarkeit<br />
sprachlicher Praktiken ausgehen und die bedeutungsvollen dynamischen sprachlichen<br />
Aushandlungsprozesse negieren, die etwa auf der Baustelle existieren. Dass das<br />
Sprachenregime erst durch die individuellen und/oder kollektiven Sprachenpraktiken der<br />
Affirmation, Infragestellung, Umkodierung, Ablehnung und Veränderung konstituiert wird,<br />
zeigt sich sowohl in den Experteninterviews als auch im Gespräch mit einem Arbeiter, der<br />
neben seinen regulären Arbeiten am Bau immer wieder spontane Dolmetschertätigkeiten<br />
übernimmt und damit als multilingualer Kommunikationsvermittler zwischen Polier und<br />
Arbeitern fungiert. Ohne seine Sprachkompetenzen wäre die Kommunikation zwischen dem<br />
Polier und den mehrheitlich nicht‐deutsprachigen Arbeitern auf der Baustelle nicht möglich.<br />
Die Bedeutung einzelner multilingualer Bauarbeiter für den reibungslosen Ablauf des<br />
Arbeitsprozesses beschreibt keine Ausnahme, sondern vielmehr den Regelfall der<br />
Baustellenkommunikation. Zumindest für die Durchführung der Bauarbeiten ist es aus Sicht<br />
der bauunternehmerischen Führungskräfte sowie der Sicherheitsbeauftragten unabdingbar,<br />
auf die mehrsprachige Baustellenrealität über das bloße Einfordern von Deutschkenntnissen<br />
hinaus, zu reagieren. So ist auch die Forderung im Rahmen des SCCs (Safety Certificate<br />
Contractors), eines Zertifizierungsverfahrens für Sicherheitsmanagementsysteme unter<br />
Berücksichtigung relevanter Gesundheits‐ und Umweltschutzaspekte, dass zumindest einE<br />
ArbeiterIn der Arbeitspartie zweisprachig sein muss, um die Kommunikation mit den<br />
Führungs‐ und Sicherheitskräften zu gewährleisten. 19<br />
Die Konkretisierung der Zweisprachigkeit als „einfaches Deutsch und Muttersprache“, wie<br />
sie der befragte Experte vornimmt, enthält einen soziolinguistisch interessanten Aspekt. Sie<br />
19 Das ist eine SCC‐Forderung. Zum Beispiel ganz klar. Es muss zumindest einen von der Arbeitspartie geben,<br />
der beid‐... der zweisprachig ist. Einfaches Deutsch und seine Muttersprache, so dass er den anderen<br />
übersetzen kann (I, 164‐166).<br />
22