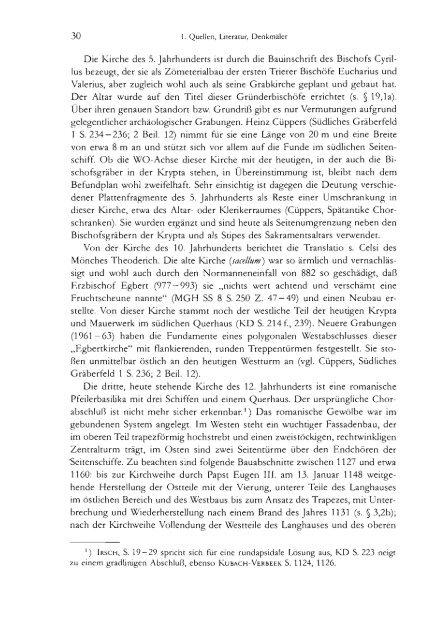- Seite 1 und 2: DAS ERZBISTUM TRIER 8 DIE BENEDII
- Seite 3: @) Gedruckt auf säurefreiem Papier
- Seite 6 und 7: VI Vorwort den Leitern und dem gesa
- Seite 8 und 9: VIII Inhaltsverzeichnis b. Von der
- Seite 10 und 11: x Inhaltsverzeichnis 5. Religiöses
- Seite 12 und 13: XlI Inhaltsverzeichnis c. Beichtvat
- Seite 14 und 15: XIV DHGE Diss. DSAM DThC Du Cange D
- Seite 16 und 17: XVI UnivBi Urk. UrkQLuxemburg Vf. V
- Seite 18 und 19: 2 1. Quellen, Literatur, Denkmäler
- Seite 20 und 21: 4 1. Quellen, Literatur, Denkmäler
- Seite 22 und 23: 6 1276 XII 1278 VIII (MrhR 4 Nr. 35
- Seite 24 und 25: 8 1. Quellen, Literatur, Denkmäler
- Seite 26 und 27: 10 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 29 und 30: § 1. Quellen Ignographia abbatiae
- Seite 31 und 32: § 1. Quellen 15 Go s e Erich, Kata
- Seite 33 und 34: § 2. Literatur 17 -, Ein alter Abt
- Seite 35 und 36: § 2. Literatur 19 -, Die Abtei St.
- Seite 37 und 38: § 2. Literatur 21 -, D as südlich
- Seite 39 und 40: § 2. Literatur 23 Heyen Franz-Jose
- Seite 41 und 42: § 2. Literatur 25 M a rx Jakob d.
- Seite 43 und 44: § 2. Literatur 27 - , Die Auflösu
- Seite 45: § 3. Denkmäler 29 Ottu:Ylere in c
- Seite 50: 34 I, Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 54: 38 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 57 und 58: § 3. Denkmäler 41 Zusammenhang mi
- Seite 59 und 60: § 3. Denkmäler 43 Unter den in de
- Seite 61 und 62: § 3. Denkmäler 45 sarum jigurarum
- Seite 64 und 65: 48 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 66 und 67: 50 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 68 und 69: 52 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 70 und 71: 54 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 72: 56 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 75 und 76: § 3. D enkmäler 59 den Kirn'schen
- Seite 77 und 78: § 3. D enkm äler 61 Im Norden des
- Seite 79 und 80: § 3. Denkmäler 63 deutlich. Noch
- Seite 81 und 82: § 3. D enkmäler 65 Evangelii gemm
- Seite 83 und 84: § 3. Denkmäler 67 De festo s. Euc
- Seite 85: § 3. Denkmäler 69 BI. 14r Ave Mat
- Seite 88 und 89: 2. ARCHIV UND BIBLIOTHEK § 4. Das
- Seite 90 und 91: 74 2. Archiv und Bibliothek latione
- Seite 92 und 93: 76 2. Archiv und Bibliothek erfolgt
- Seite 94 und 95: 78 2. Archiv und Bibliothek Es ergi
- Seite 96 und 97:
80 2. Archiv und Bibliothek Nr. 45)
- Seite 99 und 100:
§ 5. Die Bibliothek 83 gung nach (
- Seite 101 und 102:
§ 5. Die Bibliothek 85 schollene K
- Seite 103 und 104:
§ 5. Die Bibliothek 87 bände, auf
- Seite 105 und 106:
§ 5. Die Bibliothek 89 min war 01z
- Seite 107 und 108:
§ 5. Die Bibliothek 91 Benzing, Ka
- Seite 110 und 111:
94 2. Archiv und Biblio thek war in
- Seite 112 und 113:
96 2. Archiv und Bibliothek weitere
- Seite 114 und 115:
98 2. Archiv und Bibliothek nge und
- Seite 116 und 117:
100 2. Archiv und Bibliothek 1541 f
- Seite 118 und 119:
102 2. Archiv und Bibljothek fremde
- Seite 120 und 121:
104 2. Archiv und Bibliothek 2. Ver
- Seite 122:
106 2. Archiv und Bibliothek 4. T H
- Seite 125 und 126:
§ 5. Die Bibliothek 109 17. S Hs 4
- Seite 127 und 128:
§ 5. Die Bibliothek 111 Texte von
- Seite 131 und 132:
§ 5. Die Bibliothek 115 39. TBA Ab
- Seite 133 und 134:
§ 5. Die Bibliothek 117 de musica
- Seite 135 und 136:
§ 5. Die Bibliothek 119 59. T Hs 9
- Seite 137:
§ 5. Die Bibliothek 121 frühen Mi
- Seite 140 und 141:
124 2. Archiv und Bibliothek 77. T
- Seite 142:
126 2. Archiv und Bibliothek anno D
- Seite 146:
130 2. Archiv und Bibliothek DeckbI
- Seite 150 und 151:
134 2. Archiv und Bibliothek 14/ 15
- Seite 153:
§ 5. Die Bibliothek 137 usw.); BI.
- Seite 156 und 157:
140 2. Archiv und Bibliothek 149. T
- Seite 158 und 159:
142 2. Archiv und Bibliothek 159. T
- Seite 160 und 161:
144 2. Archiv und Bibliothek 167. T
- Seite 162:
146 2. Archiv und Bibliothek Pauly-
- Seite 165:
§ 5. Die Bibliothek 149 damals sch
- Seite 170:
154 2. Archiv und Bibliothek 185. S
- Seite 173:
§ 5. Die Bibliothek 157 Suppl. 4 S
- Seite 177 und 178:
§ 5. Die Bibliothek 161 schrift be
- Seite 179 und 180:
§ 5. Die Bibliothek 163 sterü bea
- Seite 181 und 182:
§ 5. Die Biblio thek 165 Innozenz
- Seite 183:
§ 5. Die Bibliothek 167 Provinzial
- Seite 186 und 187:
170 2. Archiv und Bibliothek G dei
- Seite 188 und 189:
172 2. Archiv und Bibliothek Schrei
- Seite 190 und 191:
174 2. Archiv und Bibliothek 238. T
- Seite 192 und 193:
176 2. Archiv und Bibliothek Nr. 22
- Seite 194:
178 2. Archiv und Bibliothek post m
- Seite 198 und 199:
182 2. Archiv und Bibliothek Epistu
- Seite 200 und 201:
184 2. Archiv und Bibliothek exerci
- Seite 202 und 203:
186 2. Archiv und Bibliothek (inc.
- Seite 204 und 205:
188 2. Archiv und Bibliothek BI. 24
- Seite 206 und 207:
190 2. Archiv und Bibliothek script
- Seite 209:
§ 5. Die Bibliothek 193 DeckblI. h
- Seite 212 und 213:
196 2. Archiv und Bibliothek Dilect
- Seite 214 und 215:
198 2. Archiv und Bibliothek Euchar
- Seite 217:
§ 5. Die Bibliothek 201 nes (pL 40
- Seite 222:
206 2. Archiv und Bibliothek quam p
- Seite 225 und 226:
§ 5. Die Bibliothek 209 non vernal
- Seite 227 und 228:
§ 5. Die Bibliothek 211 Frater car
- Seite 229 und 230:
§ 5. Die Bibliothek 213 einem Serm
- Seite 231 und 232:
§ 5. Die Bibliothek 215 16. Jh.: B
- Seite 233 und 234:
§ 5. Die Bibliothek 217 et ... Cum
- Seite 237:
§ 5. Die Bibliothek 221 inc. Culme
- Seite 241 und 242:
§ 5. Die Bibliothek 225 an Gabriel
- Seite 243 und 244:
§ 5. Die Bibliothek 227 1970 S. 14
- Seite 245 und 246:
§ 5. Die Bibliothek 229 c. Fragmen
- Seite 248 und 249:
232 2. Archiv und Bibliothek 395. D
- Seite 250 und 251:
234 2. Archiv und Bibliothek K 7 S.
- Seite 252 und 253:
236 2. Archiv und Bibliothek Hubert
- Seite 254 und 255:
238 2. Archiv und Bibliothek S Hs.
- Seite 256 und 257:
240 2. Archiv und Bibliothek T Hs.
- Seite 258 und 259:
242 3. Historische Übersicht der Z
- Seite 260 und 261:
244 3. Historische Übersicht Kirch
- Seite 262 und 263:
246 3. Historische Übersicht eigen
- Seite 264 und 265:
248 3. Historische Übersicht spät
- Seite 266 und 267:
250 3. Historische Übersicht Kues
- Seite 268 und 269:
252 3. Historische Übersicht allem
- Seite 270 und 271:
254 3. Historische Übersicht § 16
- Seite 272 und 273:
256 3. Historische Übersicht perso
- Seite 274 und 275:
258 3. Historische Übersicht Heinr
- Seite 276 und 277:
260 3. Historische Übersicht könn
- Seite 278 und 279:
262 3. Historische Übersicht dem e
- Seite 280 und 281:
264 3. Historische Übersicht zu he
- Seite 282 und 283:
266 3. Historische Übersicht § 16
- Seite 284 und 285:
268 3. Historische Übersicht der W
- Seite 286 und 287:
270 3. Historische Übersicht Unter
- Seite 288:
272 3. Historische Übersicht Nachd
- Seite 291 und 292:
§ 11. Die Neuzeit 275 wohlhabenden
- Seite 293 und 294:
§ 11. Die Neuzeit 277 che starben
- Seite 295 und 296:
§ 11. Die Neuzeit 279 Der letzte S
- Seite 297 und 298:
§ 11 . Die euzeit 281 § 30: Johan
- Seite 299 und 300:
§ 11. Die Neuzeit 283 administrati
- Seite 301 und 302:
§ 11. Die Neuzeit 285 Bursfelder K
- Seite 303 und 304:
§ 12. D as Ende in der Säkularisa
- Seite 305 und 306:
§ 12. Das Ende in der Säkularisat
- Seite 307:
§ 12. D as Ende in der Säkularisa
- Seite 310 und 311:
4. VERFASSUNG § 13. Regel und Cons
- Seite 312 und 313:
296 4. Verfassung Dezember 1435 in
- Seite 314 und 315:
298 4. Verfassung ten wurde. Dies g
- Seite 317 und 318:
§ 14. Klosterämter, Konvent und j
- Seite 319 und 320:
§ 14. J..Josterämter, Konvent und
- Seite 322 und 323:
306 4. Verfassung dener Zugaben an
- Seite 324 und 325:
308 4. Verfassung Verwaltung des Ho
- Seite 326 und 327:
310 4. Verfassung über Einnahmen u
- Seite 329 und 330:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 331 und 332:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 333 und 334:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 335 und 336:
§ 14. I-Josterämter, Konvent und
- Seite 337 und 338:
§ 14. Klosterämter, Konvent und J
- Seite 339 und 340:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 341 und 342:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 343 und 344:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 345 und 346:
§ 14. Klosterämter, Konvent und J
- Seite 347:
§ 14. Klosterämter, Konvent und f
- Seite 350 und 351:
334 4. Verfassung zung mit dem Konv
- Seite 352 und 353:
336 4. Verfassung tation des Hospit
- Seite 354 und 355:
338 4. Verfassung Das Hospital unte
- Seite 356 und 357:
340 4. Verfassung § 16. Äußere B
- Seite 358 und 359:
342 4. Verfassung men und beauftrag
- Seite 360 und 361:
344 4. Verfassung kunft aus Reichsb
- Seite 362 und 363:
346 4. Verfassung begründer der Bi
- Seite 364 und 365:
348 4. Verfassung wofür das Kapite
- Seite 366 und 367:
350 4. Verfassung Schäden der Abte
- Seite 368 und 369:
352 4. Verfassung gisehe Herzogsfam
- Seite 370 und 371:
354 4. Verfassung möglich; im 13.
- Seite 372 und 373:
356 4. Verfassung Auf luxemburgisch
- Seite 374 und 375:
358 4. Verfassung stingen fanden Ab
- Seite 376 und 377:
360 4. Verfassung schen Mönchsrefo
- Seite 378 und 379:
362 4. Verfassung Kurz nach der Ern
- Seite 380 und 381:
364 4. Verfassung Das Mortuar bezeu
- Seite 383 und 384:
§ 16. Äußere Beziehungen 367 kar
- Seite 385 und 386:
§ 16. Äußere Beziehungen 369 meh
- Seite 387 und 388:
§ 16. Äußere Beziehungen 371 thi
- Seite 389 und 390:
§ 16. Äußere Beziehungen 373 von
- Seite 391 und 392:
§ 16. Äußere Beziehungen 375 Wal
- Seite 393 und 394:
§ 17. Gerichtsbarkeit 377 § 17. G
- Seite 395 und 396:
§ 17. Gerichtsbarkeit 379 Amtmann
- Seite 397 und 398:
§ 18. Siegel und Wappen 381 gedrü
- Seite 399 und 400:
§ 18. Siegel und Wappen 383 Papier
- Seite 401:
5. RELIGIÖSES UND GEISTIGES LEBEN
- Seite 404 und 405:
388 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 406 und 407:
390 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 408 und 409:
392 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 411 und 412:
§ 19. St. Eucharius-St. Matthias a
- Seite 413 und 414:
§ 19. St. Eucharius-St. Matthias a
- Seite 415 und 416:
§ 20. Der Gottesdienst 399 nen, sc
- Seite 417 und 418:
§ 20. D er Gottesdienst 401 missa,
- Seite 419 und 420:
§ 20. Der Gottesdienst 403 und zu
- Seite 421 und 422:
§ 20. Der Gottesdienst 405 macht.
- Seite 423 und 424:
§ 20. Der Gottesdjenst 407 ei ner
- Seite 425 und 426:
§ 20. Der Gottesdienst 409 Gewänd
- Seite 427 und 428:
§ 20. Der Gottesdienst 411 Mittwoc
- Seite 429 und 430:
§ 20. Der Gottesdienst 413 der Gew
- Seite 431 und 432:
§ 20. D er Gottesdienst 415 schmü
- Seite 433:
§ 20. Der Gottesdienst 417 Ambrosi
- Seite 436 und 437:
420 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 438:
422 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 441 und 442:
§ 20. D er Gottesdienst 425 Fronle
- Seite 443 und 444:
§ 20. Der Gottesdienst 427 St. Val
- Seite 445 und 446:
§ 20. Der G ottesdienst 429 Mittwo
- Seite 447 und 448:
§ 20. Der Gottesdienst 431 scrueht
- Seite 449:
§ 20. D er Gottesdienst 433 quiem
- Seite 452 und 453:
436 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 454:
438 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 459 und 460:
§ 22. Ablässe, Wallfahrten, Brude
- Seite 461 und 462:
§ 22. Ablässe, Wallfahrten, Brude
- Seite 463 und 464:
Marienkapelle § 22. Ablässe, Wall
- Seite 465 und 466:
§ 22. Ablässe, Wallfahrten, Brude
- Seite 467 und 468:
§ 22. Ablässe, Wallfahrten, Brude
- Seite 469 und 470:
§ 22. Ablässe, Wallfahrten, Brude
- Seite 472 und 473:
456 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 474 und 475:
458 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 476 und 477:
460 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 478 und 479:
462 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 480 und 481:
464 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 482 und 483:
466 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 484 und 485:
468 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 486 und 487:
470 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 488 und 489:
472 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 490 und 491:
474 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 492 und 493:
476 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 494:
478 6. Der Besitz sind 1). Für den
- Seite 497 und 498:
§ 24. Übersicht 481 führt wurde,
- Seite 499 und 500:
§ 24. Übersicht 483 d. Neuzeitlic
- Seite 501 und 502:
§ 24. Übersicht 485 weil sie weni
- Seite 504 und 505:
488 6. Der Besitz Trierer Bürger (
- Seite 507 und 508:
§ 25. D er Grundbesitz und die Her
- Seite 509 und 510:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 512 und 513:
496 6. Der Besitz Schwierigkeit ber
- Seite 514 und 515:
498 6. Der Besitz Hof, 5 Weiher, 2
- Seite 516 und 517:
500 6. Der Besitz Hoiff genannt. De
- Seite 518 und 519:
502 6. Der Besitz 4. Die Grundherrs
- Seite 520 und 521:
504 6. Der Besitz Oudrenne (Udern,
- Seite 522 und 523:
506 6. Der Besitz Me sen ich (Ldkr.
- Seite 524 und 525:
508 6. Der Besitz war der Abt nicht
- Seite 526 und 527:
510 6. Der Besitz der Rechte und Er
- Seite 528 und 529:
512 6. Der Besitz ausgenommen oder
- Seite 531 und 532:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 533 und 534:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 536 und 537:
520 6. D er Besitz nennen, die in d
- Seite 538 und 539:
522 6. Der Besitz die Vogtei verzic
- Seite 540 und 541:
524 6. Der Besitz Zuständig sind a
- Seite 543 und 544:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 545 und 546:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 547:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 551 und 552:
§ 25. Der Grundbesitz und die Herr
- Seite 553 und 554:
§ 25. D er Grundbesitz und die Her
- Seite 555 und 556:
§ 25. D er G rundbesitz und die He
- Seite 557 und 558:
§ 26. Kirchen und Zehnte 541 führ
- Seite 559 und 560:
§ 26. Kirchen und Zehnte 543 sein,
- Seite 561 und 562:
§ 26. Kirchen und Zehnte 545 und A
- Seite 563:
§ 26. Kirchen und Zehnte 547 (paul
- Seite 566 und 567:
550 6. Der Besitz 27'). Um die Ausg
- Seite 568 und 569:
552 6. Der Besitz 5,2 S.92; Pauly,
- Seite 570 und 571:
554 6. Der Besitz pach, UrkQLuxembu
- Seite 572 und 573:
556 6. Der Besitz der Rechte des Bi
- Seite 574 und 575:
558 6. Der Besitz Wiltz und P. Mart
- Seite 576 und 577:
560 6. Der Besitz S. 51; nicht bei
- Seite 578 und 579:
562 6. Der Besitz von Villmar, des
- Seite 580 und 581:
564 6. Der Besitz Trier/ St. Alban
- Seite 582 und 583:
566 6. Der Besitz Best. 186 Nr. 303
- Seite 584 und 585:
568 6. Der Besitz Visitationsprotok
- Seite 586 und 587:
570 6. Der Besitz die Leiche trugen
- Seite 588 und 589:
572 6. Der Besitz ausgeschlossen w
- Seite 590 und 591:
574 6. Der Besitz betraute, wurden
- Seite 593 und 594:
§ 26. hlrchen und Zehnte 577 als F
- Seite 596 und 597:
580 6. Der Besitz Adam und Johann v
- Seite 598 und 599:
582 6. Der Besitz hulden wegen dar
- Seite 600 und 601:
584 7. Personallisten Gother in der
- Seite 602 und 603:
586 7. Personallisten gen, Betingen
- Seite 604 und 605:
588 7. Personallisten Bernhard 1075
- Seite 606 und 607:
590 7. Personallisten oder andere V
- Seite 608 und 609:
592 7. Personalljsten men, daß Ber
- Seite 610 und 611:
594 7. Personallisten S. 47 f.). Am
- Seite 612 und 613:
596 7. Personallisten Nr. 112). Da
- Seite 614 und 615:
598 7. Personallisten Otto bezeugt
- Seite 616 und 617:
600 7. Persnnallisten tracht, so k
- Seite 618 und 619:
602 7. Personallisten immer noch ge
- Seite 620 und 621:
604 7. Personallisren lienstiftung"
- Seite 622 und 623:
606 7. Personallisten In dem Nekrol
- Seite 624 und 625:
608 7. Personallisten links überei
- Seite 626 und 627:
610 7. Personallisten (K Best. 215
- Seite 628 und 629:
612 7. Personallisten schon 1357 30
- Seite 630 und 631:
614 7. Personallisten mung des Erzb
- Seite 632 und 633:
616 7. Personallisten an die Abtei
- Seite 634 und 635:
618 7. Personallisten 1427 von Paps
- Seite 636 und 637:
620 7. Personallisten kloster Marie
- Seite 638 und 639:
622 7. Personallisten nisation der
- Seite 640 und 641:
624 7. Personallisten oberen Ecke e
- Seite 642 und 643:
626 7. Personallisten den St. Matth
- Seite 645 und 646:
§ 28. Die Äbte 629 Rundsiegel c:
- Seite 647 und 648:
§ 28. Die Äbte 631 Abt Antonius s
- Seite 649 und 650:
§ 28. Die Äbte 633 Lehre der Conc
- Seite 651 und 652:
§ 28. Die Äbte Johannes V. von Wi
- Seite 653 und 654:
§ 28. Die Äbte 637 Wappen: Euchar
- Seite 655 und 656:
§ 28. Die Äbte 639 tin in Trier 1
- Seite 657 und 658:
§ 28. Die Äbte 641 zum Abt am 28.
- Seite 659 und 660:
§ 28. Die Äbte 643 ten nach innen
- Seite 661 und 662:
§ 28. Die Äbte 645 quälend waren
- Seite 663 und 664:
§ 28. Die Äbte 647 1665 bzw. Janu
- Seite 665 und 666:
§ 28. Die Äbte 649 1692 in St.Max
- Seite 667 und 668:
§ 28. Die Äbte 651 min als Subdia
- Seite 669 und 670:
§ 28. Die Äbte 653 gleich mit dem
- Seite 671 und 672:
§ 28. Die Äbte 655 22, Rez. 1751
- Seite 673 und 674:
§ 28. Die Äbte 657 Abt Adalbert s
- Seite 675 und 676:
§ 29. Katalog der Amtsträger 659
- Seite 677 und 678:
§ 29. Katalog der Amtsträger Bene
- Seite 679 und 680:
§ 29. Katalog der Amtsträger Walt
- Seite 681 und 682:
§ 29. Katalog der Amtsträger Konr
- Seite 683 und 684:
§ 29. Katalog der Amtsträger Bene
- Seite 685 und 686:
§ 29. Katalog der Amtsträger K o
- Seite 687 und 688:
§ 29. Katalog der Amtsträger Bene
- Seite 689 und 690:
§ 29. Katalog der Amtsträger Tilm
- Seite 691 und 692:
§ 29. Katalog der Amtsträger B en
- Seite 693 und 694:
§ 29. Katalog der Amtsträger E be
- Seite 695 und 696:
§ 29. Katalog der Amtsträger Hein
- Seite 697 und 698:
§ 30. Katalog der Mönche 681 ? Ge
- Seite 699 und 700:
§ 30. Katalog der Mönche 683 (V)
- Seite 701 und 702:
§ 30. Katalog der Mönche 685 Rudo
- Seite 703 und 704:
§ 30. Katalog der Mönche 687 etn
- Seite 705 und 706:
§ 30. Katalog der Mönche 689 hann
- Seite 707 und 708:
§ 30. Katalog der Mönche 691 ihre
- Seite 709 und 710:
§ 30. Katalog der Mönche 693 Phil
- Seite 711 und 712:
§ 30. Katalog der Mönche 695 Petr
- Seite 714 und 715:
698 7. Personallisten tisch mit dem
- Seite 716 und 717:
700 7. Personallisten Bertold. Zu d
- Seite 718:
702 7. Personallisten der Gemeinde
- Seite 721:
§ 30. Katalog der Mönche 705 P e
- Seite 725 und 726:
§ 30. Katalog der Mönche 709 J 0
- Seite 727 und 728:
§ 30. Katalog der Mönche 711 im A
- Seite 729 und 730:
§ 30. Katalog der Mönche 713 Jako
- Seite 731 und 732:
§ 30. Katalog der Mönche 715 Best
- Seite 733 und 734:
§ 30. Katalog der Mönche 717 Trit
- Seite 735 und 736:
§ 30. Katalog der Mönche 719 Wilh
- Seite 737:
§ 30. Katalog der Mönche 721 ihm
- Seite 740:
724 7. Personallisten ihn als Celle
- Seite 743 und 744:
§ 30. I-.:.atalog der Mönche 727
- Seite 745 und 746:
§ 30. Katalog der Mönche 729 BI.
- Seite 747 und 748:
§ 30. Katalog der Mönche 731 Sept
- Seite 749 und 750:
§ 30. Katalog der Mönche 733 Joha
- Seite 751:
§ 30. Katalog der Mönche 735 ihn
- Seite 754 und 755:
738 7. Personallisten Fanckel nach
- Seite 756 und 757:
740 7. Personallisten der Abtei das
- Seite 758 und 759:
742 7. Personallisten 2 BI. 164 f ,
- Seite 760 und 761:
744 7. Personallisten zur Zahlung d
- Seite 762:
746 7. Personallisten aus seiner Se
- Seite 765 und 766:
§ 30. Katalog der Mönche 749 Abt
- Seite 767 und 768:
§ 30. Katalog der Mönche 75 1 ihn
- Seite 769 und 770:
§ 30. Katalog der Mönche 753 1700
- Seite 771 und 772:
§ 30. Katalog der Mönche 755 S. 1
- Seite 773 und 774:
§ 30. Katalog der Mönche 757 361
- Seite 775 und 776:
§ 30. Katalog der Mönche 759 etwa
- Seite 777 und 778:
§ 30. Katalog der Mönche 761 Hau,
- Seite 779 und 780:
§ 30. Katalog der Mönche 763 Merz
- Seite 781 und 782:
§ 30. Katalog der Mönche 765 Matt
- Seite 783 und 784:
§ 30. Katalog der Mönche 767 Cell
- Seite 785 und 786:
§ 30. Katalog der Mönche 769 am 2
- Seite 787 und 788:
§ 30. Katalog der Mönche 771 Ordi
- Seite 789 und 790:
§ 30. Katalog der Mönche 773 war
- Seite 791 und 792:
§ 30. Katalog der Mönche 775 Trie
- Seite 793 und 794:
§ 30. Katalog der Mönche 777 St.
- Seite 795 und 796:
§ 30. Katalog der Mönche 779 ber
- Seite 797 und 798:
§ 30. Katalog der Mönche 781 rich
- Seite 799 und 800:
§ 30. Katalog der Mönche 783 St.
- Seite 801 und 802:
§ 30. Katalog der Mönche 785 Rhei
- Seite 803 und 804:
§ 30. Katalog der Mönche 787 (Tri
- Seite 805 und 806:
§ 30. Katalog der Mönche 789 kob
- Seite 807 und 808:
§ 30. Katalog der Mönche 791 Herb
- Seite 809 und 810:
§ 30. Katalog der Mönche 793 coll
- Seite 811 und 812:
§ 30. Katalog der Mönche 795 am 2
- Seite 813 und 814:
§ 30. Katalog der Mönche 797 von
- Seite 815 und 816:
§ 30. Katalog der Mönche 799 18.
- Seite 817 und 818:
§ 30. Katalog der Mönche 801 J 0
- Seite 819 und 820:
§ 30. Katalog der Mönche 803 Auff
- Seite 821 und 822:
§ 30. K atalog der Mi>nche Ru pe r
- Seite 823 und 824:
Benno, sac., mo., 26. August. Mx b
- Seite 825 und 826:
Gottfried, sac., !lIO., 27. April.
- Seite 827 und 828:
§ 30. r.,:atalog der Mönche Gis e
- Seite 829 und 830:
Bart hol 0 m ä u s, conv., 1 7. N
- Seite 831 und 832:
§ 30. Katalog der Mönche Franeo,
- Seite 833 und 834:
Bernhard, mo., 5. Februar. Eu. Herw
- Seite 835 und 836:
K o nrad, mo., 25. Februar. Eu. Arn
- Seite 837 und 838:
§ 30. Katalog der Mönche Nikolaus
- Seite 839 und 840:
§ 30. Katalog der Mönche E ch o ,
- Seite 841 und 842:
§ 30. Katalog der Mönche Heinrich
- Seite 843 und 844:
Eberhard, mo., 21. Mai. Eu. Barthol
- Seite 845 und 846:
Wilhelm, mo., 5. Juni. Eu. Wald ric
- Seite 847 und 848:
Theoderich, mo., 23. Juni. E u. J o
- Seite 849 und 850:
Ru d ° lf, mo., 9. Juli. E u. Sibo
- Seite 851 und 852:
Gottfried, mo., 29. Juli. E u. Rava
- Seite 853 und 854:
Otto, mo., 11. August. Eu. Friedric
- Seite 855 und 856:
§ 30. Katalog der Mönche 839 Lam
- Seite 857 und 858:
§ 30. Katalog der Mönche M a rt i
- Seite 859 und 860:
J o hannes, mo., 20. September. Eu.
- Seite 861 und 862:
§ 30. Katalog der Mönche P e trus
- Seite 863 und 864:
§ 30. Katalog der Mönche 847 Niko
- Seite 865 und 866:
Marsilius, mo., 19. November. E u.
- Seite 867 und 868:
§ 30. Katalog der Mönche Florenti
- Seite 869 und 870:
§ 30. Katalog der Mönche 853 List
- Seite 871 und 872:
§ 31. Katalog der Konversen und Do
- Seite 873 und 874:
§ 31. K atalog der Konversen und D
- Seite 875 und 876:
§ 32. Säkularpriester und Schulth
- Seite 877 und 878:
§ 32. Säkularpriester und Schulth
- Seite 879 und 880:
§ 32. Säkularpriester und Schulth
- Seite 881 und 882:
REGISTER Von Uwe Israel Im Register
- Seite 883 und 884:
Alberich, M (zw. Anf. 13. u. 15. Jh
- Seite 888 und 889:
872 Register v. Bockenheim, Lautwei
- Seite 890:
874 Register - VI., Kg. v. Frankrei
- Seite 894 und 895:
878 Register v. Cronberg s. Frank C
- Seite 898:
882 Register - M (zw. Anf. 13. u. 1
- Seite 902 und 903:
886 Register - M (vor 1480 - 90, t
- Seite 904:
888 Register - (2 x) M (vor 1480-90
- Seite 908 und 909:
892 Register - Winze, Mann v. Gela
- Seite 911 und 912:
- M (zw. Anf 13. u. 15. Jh., t 15.
- Seite 913 und 914:
- 1., Ebf. Trier (1189-1212) 5,37,2
- Seite 916 und 917:
900 Register - de Vi//ano, Untervog
- Seite 918 und 919:
902 Register Lindo, K (vor 1480 - 9
- Seite 920 und 921:
904 Register Mayer, Johannes s. Mey
- Seite 922 und 923:
906 Register Menfred, Memfred, M? (
- Seite 928 und 929:
912 Register - M (vor 1480 - 90, t
- Seite 930 und 931:
914 Register Reichenbach, Abtei (Di
- Seite 932 und 933:
916 Register - Johann Ernst, Villma
- Seite 934:
918 Register Schlieks, Michael, Sch
- Seite 937 und 938:
v. Südlingen s. Johannes - Weirich
- Seite 939:
- Bibliothek der Weißen Väter 229
- Seite 942 und 943:
926 Register Vorratskammer 423 v. V
- Seite 945 und 946:
- M (vor 1480-90, t 31. Okt.) 847 -
- Seite 948:
Abb. 2: Grundherrschaft um das Klos