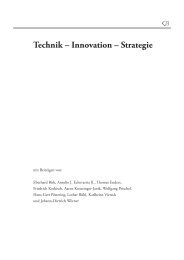Download - Gneisenau Gesellschaft
Download - Gneisenau Gesellschaft
Download - Gneisenau Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Luftwaffenmotive in der Frühphase der Freiwilligenwerbung<br />
der Bundeswehr<br />
Text: Dr. Thorsten Loch<br />
Öffentlich verbreitete Soldatenbilder seien es – so der<br />
langjährige Leiter der Abteilung Forschung am Militärgeschichtlichen<br />
Forschungsamt, Professor Dr. Manfred<br />
Messerschmidt –, die Aufschluss über die „politischen und<br />
gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen“ 1 eines Staatswesens<br />
böten. Die gedankliche Weiterentwicklung dieser<br />
Auffassung geht in die Erkenntnis über, dass es sich bei<br />
den öffentlich verbreiteten Soldatenbildern regelmäßig um<br />
Identität stiftende Konstrukte handelt, die bewusst oder<br />
unbewusst Leitbilder schufen und nicht selten zu Mythen<br />
geronnen. 2 Daher können diese Bilder als am Schnittpunkt<br />
von Militär, Staat und <strong>Gesellschaft</strong> liegend verstanden werden<br />
und es zudem ermöglichen, das Wesen dieser Trinität<br />
so zu erfassen, wie es durch die Analyse von programmatischen<br />
Reden oder Schriften kaum möglich wäre. 3<br />
Die erste deutsche Armee, die ein derartiges Bild – in manipulativer<br />
Absicht – schuf, war die Wehrmacht. Im Zuge<br />
eines politisch initialisierten und durch Reichswehr und<br />
Wehrmacht mitgetragenen Prozesses der Bellifizierung<br />
und Wehrhaftmachung 4 von <strong>Gesellschaft</strong> als auch des Militärs<br />
selbst, entwickelte sich ein äußeres Bild des Soldaten,<br />
das visuell über die Grenzen des Soldatentums hinaus zu<br />
einem entgrenzten Kämpfertum pervertierte. Sein Zweck<br />
war eindeutig politisch motiviert: die <strong>Gesellschaft</strong> und<br />
ihre Soldaten auf die kommenden (totalen) Kriege und<br />
auch auf die rassisch motivierten Grenzüberschreitungen<br />
des Holocaustes vorzubereiten. Die öffentlich verbreiteten<br />
„äußeren“ Soldatenbilder erzeugten „innere“ Bilder eines<br />
Heroen und (rassischen) Kämpfers jenseits des klassisch<br />
Soldatischen, um die Bevölkerung auf die geplanten totalen<br />
Waffengänge geistig einzustimmen.<br />
Dieses Bild des Kämpfers der Wehrmacht, wie ihn Erich<br />
Hoffmann 1941 in einer zinkenen Büste darstellte [Bild<br />
1, Hoffmann, Der Kämpfer], war der Archetypus des nationalsozialistischen<br />
Kämpfers, 5 der sich in Rubriken wie<br />
Führermythos, Volksgemeinschaft, Kampf und rassischer<br />
Thorsten Loch<br />
Kämpfer fassen lässt und das nationalsozialistische Ideal<br />
des Mannes darstellte: einen männlichen Herrscherwillen,<br />
das Heldische und die Leistung des Einzelnen. 6 Es<br />
erlaubte in seiner visualisierten Sinnhaftigkeit Anschluss<br />
an die NS-Ideologie des darwinistischen und rassisch legitimierten<br />
„Kampfes um das Dasein“. Es band sich zwar<br />
durchaus zurück an tradierte militärisch-soldatische Argumente<br />
wie Entschlossenheit, Mut und Vertrauen, übertrat<br />
aber die Grenzen eben jenes Soldatischen, indem es an<br />
den rassischen Kämpfer appellierte und somit den politisch-ideologischen<br />
Wesenskern der NS-Idee visualisierte.<br />
Damit wurde ein Bild des Soldaten in <strong>Gesellschaft</strong> und<br />
Streitkräfte hinein transportiert, das einen zum äußersten<br />
entschlossenen Mann zeigte, der bereit sein musste,<br />
die tradierten Grenzen des soldatischen Tötens zum rassischen<br />
Morden im „Daseinskampf der Völker“ zu überschreiten.<br />
Diese Idee schuf sich das Bild des heroischen<br />
Individuums einer hochmodernen, effektiv und professionellen<br />
Wehrmacht, visuell getragen von begeisterten<br />
jungen Gewaltspezialisten wie Panzerkommandanten,<br />
Stoßtruppführern und Fliegern, 7 die ein „Image von Gewaltbereitschaft“<br />
8 vermittelten.<br />
1. Manfred Messerschmidt, Die Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indoktrination, Hamburg 1969 (=Truppe und Verwaltung 16), S. 200.<br />
2. Thorsten Loch, Frontkämpfer – rassischer Kämpfer – Nichtkämpfer. Überlegungen zum Bild des deutschen Soldaten im 20. Jahrhundert, in: Militär in Frankreich und Deutschland 1870-2010. Vergleich, Verflechtung und Wahrnehmung<br />
zwischen Konflikt und Kooperation. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts Paris und des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam, hrsg. von Jörg Echternkamp und Stefan Martens, Paderborn 2012, S. 91-108, hier S. 95.<br />
3. Diese Einschätzung bei Gerhard Paul, Aufstand der Bilder. Die NS-Propaganda vor 1933, 2. Auflage Bonn 1992, S. 11 f.<br />
4. Vgl. Frank Reichherzer, „Alles ist Front!“ Wehrwissenschaften in Deutschland und die Bellifizierung der <strong>Gesellschaft</strong> vom Ersten Weltkrieg bis in den Kalten Krieg, Paderborn 2011 (=Krieg in der Geschichte, 68). Siehe nun Rüdiger Bergien,<br />
Die bellizistische Republik. Wehrkonsens und „Wehrhaftmachung“ in Deutschland 1918-1933, hrsg. mit Unterstützung des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam, München 2012 (=Ordnungssysteme, 35), der die These vertritt,<br />
es handele sich bei der personellen Geheimrüstung um das Ergebnis einer umfassenden Kooperation zwischen zivilen und militärischen Behörden.<br />
5. Vgl. Erich Hoffmann, Der Kämpfer, verzeichnet in: Große Deutsche Kunstausstellung 1941 im Haus der Deutschen Kunst zu München, München 1941, S. 42. Zum Soldatenbild der NS-Zeit siehe Krieg und Militär im Film des 20. Jahrhunderts.<br />
Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Bernhard Chiari, Matthias Rogg und Wolfgang Schmidt, München 2003 (=Beiträge zur Militärgeschichte, 59) und Gerhard Paul, Bilder des Krieges. Krieg der Bilder.<br />
Die Visualisierung des modernen Krieges, Paderborn, München 2004.<br />
6. Diese zeitgenössische Einschätzung bei Arthur Laumann, Flieger und Nationalsozialismus, in: Deutsche Luftwacht. Zeitschrift für alle Gebiete der Luftfahrt. Ausgabe Luftwelt 1934, Bd. 1, Nr. 20, S. 378.<br />
7. Vgl. Jens Jäger, Photographie. Bilder der Neuzeit. Einführung in die Historische Bildforschung, Tübingen 2000 (=Historische Einführungen, 7), S. 121 sowie Gerhard Paul, Bilder des Krieges. Krieg der Bilder. Die Visualisierung des<br />
modernen Krieges, Paderborn, München 2004, S. 236-241.<br />
8. Howard, Die Erfindung des Friedens. Über den Krieg und die Ordnung in der Welt, Lüneburg 2001, S. 73.<br />
16