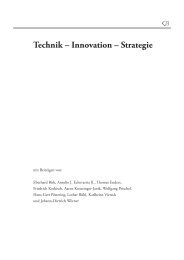Download - Gneisenau Gesellschaft
Download - Gneisenau Gesellschaft
Download - Gneisenau Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
18<br />
LUFTWAFFENMOTIVE IN DER FRÜHPHASE DER FREIWILLIGENWERBUNG DER BUNDESWEHR<br />
der Wehrmacht einem anderen Zweck folgten, als die Bilder<br />
der Nachwuchswerbung der Bundeswehr.<br />
Diese dienten je länger je mehr einem komplexen Kommunikationsprozess,<br />
in dessen Mittelpunkt der Kunde,<br />
die jugendlich-männliche Zielgruppe, stand, die es zu<br />
erreichen galt. Die Bilder der Nachwuchswerbung versprachen<br />
den Kunden mehr oder weniger befriedigende<br />
Lösungen für ihr Problem der Arbeitsplatzsuche nach der<br />
schulischen oder beruflichen Ausbildung zu bieten. Im<br />
Gegensatz zu den Soldatenbildern der Wehrmacht, ging<br />
es diesen Bildern nicht um den Transport bestimmter<br />
Bildmuster, um die <strong>Gesellschaft</strong> im weitesten Sinne zu<br />
beeinflussen, sondern den Arbeitsplatz Bundeswehr als<br />
attraktive Berufsalternative zu kommunizieren. Die dabei<br />
entwickelten und transportierten Bilder waren nicht das<br />
Produkt eines politischen Willens sondern vielmehr das<br />
Ergebnis der Beobachtung der Beobachter, also demoskopischer<br />
Untersuchungen, die die Einstellung der Zielgruppe<br />
analysierte und visuell-bildlich umsetzten.<br />
Dabei entwickelte sich vor dem Hintergrund der historischen<br />
Folie und der Einstellung weiter Teile der <strong>Gesellschaft</strong><br />
ein Soldatenbild, dessen „roter Faden“ sich zwischen<br />
1956 und der Wiedervereinigung 1990 durch alle Motive<br />
zieht. Im Vergleich zum Heroen der Wehrmacht, der die<br />
<strong>Gesellschaft</strong> auf den kommenden Krieg vorbereiten sollte,<br />
zeigte das Soldatenbild der Nachwuchswerbung der Bundeswehr<br />
einen „postheroischen“ Soldaten. Betrachtet man<br />
jedoch eine größere Entwicklungslinie, scheint es angebracht,<br />
weniger vom „postheroischen“ als vielmehr vom<br />
„bürgerlichen“ Soldaten zu sprechen: Ein Soldatenbild,<br />
mit offenen und weichen Gesichtszügen, einem Soldaten,<br />
der sich in vielen Kontexten präsentierte, jedoch nicht ein<br />
einziges Mal kämpfend dargestellt wurde. Dies gilt generell<br />
für die gesamte Nachwuchswerbung zwischen 1956 und<br />
1990. An die Stelle des heroischen Soldaten, des Kämpfers<br />
für die nationale Schicksalsgemeinschaft und die „arische<br />
Rasse“ trat der defensiv gestimmte Soldat. Der heldenhafte<br />
Kämpfer wandelte sich zum postheroischen Beschützer.<br />
Hinter diesem visuellen Bruch verbirgt sich ein tiefer lie-<br />
gender Wandel, der von der Durchsetzung einer bürgerlichen<br />
<strong>Gesellschaft</strong>sordnung zeugt, deren Ursprünge im 19.<br />
Jahrhundert wurzeln.<br />
Doch wie lässt sich dieser Wandel erklären? 16 Für die<br />
Werbung länger dienender Mannschaften, vor allem<br />
aber Unteroffiziere und Offiziere, war bis zum Ende des<br />
Zweiten Weltkrieges überwiegend die jeweilige Truppe<br />
verantwortlich. Erst im Zuge des Krieges entwickelten<br />
sich Zentralisierungstendenzen. Die Bundeswehr brach<br />
völlig mit dieser Tradition, indem von nun an das Bundesverteidigungsministerium<br />
zentral für die Werbung des<br />
Nachwuchses verantwortlich zeichnete. Mangels fachlicher<br />
Kontinuitäten und somit mangels qualifizierten Personals<br />
und Fachwissens, griff man auf die Kompetenz und<br />
Beratungsleistung ziviler Werbeagenturen zurück. Woher<br />
aber kamen nun die Bildinhalte, deren Grundzüge sich bis<br />
1990 kaum änderten? Die Niederlage in zwei Weltkriegen,<br />
der totale Zusammenbruch und auch das wachsende<br />
Bewusstsein für die verbrecherische Kriegführung hatten<br />
alles Soldatische aus dem Alltag der Deutschen verbannt.<br />
Dies wurde durch die alliierte Besatzungsherrschaft und<br />
ihre Demilitarisierungspolitik in vielen Lebensbereichen<br />
verstärkt. Die Mehrheit lehnte aus unterschiedlichsten<br />
Gründen die Aufstellung der Bundeswehr ab, für die Politik<br />
hingegen war sie ein Mittel zum Schutz gegen die<br />
sowjetische Aggression und zum anderen ein Mittel zur<br />
Erreichung von mehr Souveränität und Mitsprache im<br />
westlichen Bündnis. Die Nachwuchswerbung hatte all dies<br />
zu berücksichtigen. Ihrem Bemühen um die Gunst der<br />
Zielgruppe stand das schlechte Image der Streitkräfte und<br />
seit Ende der 1950er-Jahre eine prosperierende Wirtschaft<br />
entgegen, die attraktive Alternativen zum Soldatenberuf<br />
bereithielt. Die anfänglich guten Bewerberzahlen waren<br />
in den frühen 1960er-Jahern rückläufig und führten bereits<br />
ab 1965 zu besorgniserregenden Personallücken. Die<br />
Präsentation eines neuen Soldatenbildes und die bildliche<br />
Abkehr von der Wehrmacht reichten da ebenso wenig aus<br />
wie die im Vergleich zur Wirtschaft geringen materiellen<br />
resp. wirtschaftlichen Anreize. Erst eine grundlegende Reform<br />
in der Aus- und Weiterbildung der länger dienenden<br />
16. Für die folgenden Überlegungen vgl. Thorsten Loch, Soldatenbilder im Wandel. Die Nachwuchswerbung der Bundeswehr in Werbeanzeigen, in: Visual History. Ein Studienbuch, hrsg. von Gerhard Paul, Göttingen 2006, S. 279 f. sowie<br />
Loch, Frontkämpfer, S. 104-106.