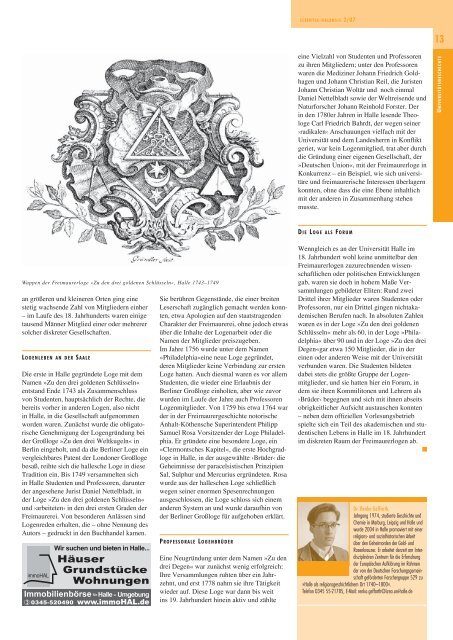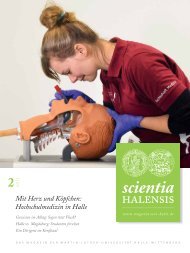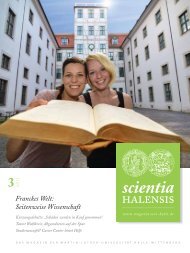Scientia Halensis 2 (2007) - Martin-Luther-Universität Halle ...
Scientia Halensis 2 (2007) - Martin-Luther-Universität Halle ...
Scientia Halensis 2 (2007) - Martin-Luther-Universität Halle ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wappen der Freimaurerloge »Zu den drei goldenen Schlüsseln«, <strong>Halle</strong> 1743–1749<br />
an größeren und kleineren Orten ging eine<br />
stetig wachsende Zahl von Mitgliedern einher<br />
– im Laufe des 18. Jahrhunderts waren einige<br />
tausend Männer Mitglied einer oder mehrerer<br />
solcher diskreter Gesellschaften.<br />
L OGENLEBEN AN DER SAALE<br />
Die erste in <strong>Halle</strong> gegründete Loge mit dem<br />
Namen »Zu den drei goldenen Schlüsseln«<br />
entstand Ende 1743 als Zusammenschluss<br />
von Studenten, hauptsächlich der Rechte, die<br />
bereits vorher in anderen Logen, also nicht<br />
in <strong>Halle</strong>, in die Gesellschaft aufgenommen<br />
worden waren. Zunächst wurde die obligatorische<br />
Genehmigung der Logengründung bei<br />
der Großloge »Zu den drei Weltkugeln« in<br />
Berlin eingeholt, und da die Berliner Loge ein<br />
vergleichbares Patent der Londoner Großloge<br />
besaß, reihte sich die hallesche Loge in diese<br />
Tradition ein. Bis 1749 versammelten sich<br />
in <strong>Halle</strong> Studenten und Professoren, darunter<br />
der angesehene Jurist Daniel Nettelbladt, in<br />
der Loge »Zu den drei goldenen Schlüsseln«<br />
und ›arbeiteten‹ in den drei ersten Graden der<br />
Freimaurerei. Von besonderen Anlässen sind<br />
Logenreden erhalten, die – ohne Nennung des<br />
Autors – gedruckt in den Buchhandel kamen.<br />
Sie berühren Gegenstände, die einer breiten<br />
Leserschaft zugänglich gemacht werden konnten,<br />
etwa Apologien auf den staatstragenden<br />
Charakter der Freimaurerei, ohne jedoch etwas<br />
über die Inhalte der Logenarbeit oder die<br />
Namen der Mitglieder preiszugeben.<br />
Im Jahre 1756 wurde unter dem Namen<br />
»Philadelphia«eine neue Loge gegründet,<br />
deren Mitglieder keine Verbindung zur ersten<br />
Loge hatten. Auch diesmal waren es vor allem<br />
Studenten, die wieder eine Erlaubnis der<br />
Berliner Großloge einholten, aber wie zuvor<br />
wurden im Laufe der Jahre auch Professoren<br />
Logenmitglieder. Von 1759 bis etwa 1764 war<br />
der in der Freimaurergeschichte notorische<br />
Anhalt-Köthensche Superintendent Philipp<br />
Samuel Rosa Vorsitzender der Loge Philadelphia.<br />
Er gründete eine besondere Loge, ein<br />
»Clermontsches Kapitel«, die erste Hochgradloge<br />
in <strong>Halle</strong>, in der ausgewählte ›Brüder‹ die<br />
Geheimnisse der paracelsistischen Prinzipien<br />
Sal, Sulphur und Mercurius ergründeten. Rosa<br />
wurde aus der halleschen Loge schließlich<br />
wegen seiner enormen Spesenrechnungen<br />
ausgeschlossen, die Loge schloss sich einem<br />
anderen System an und wurde daraufhin von<br />
der Berliner Großloge für aufgehoben erklärt.<br />
P ROFESSORALE LOGENBRÜDER<br />
Eine Neugründung unter dem Namen »Zu den<br />
drei Degen« war zunächst wenig erfolgreich:<br />
Ihre Versammlungen ruhten über ein Jahrzehnt,<br />
und erst 1778 nahm sie ihre Tätigkeit<br />
wieder auf. Diese Loge war dann bis weit<br />
ins 19. Jahrhundert hinein aktiv und zählte<br />
SCIENTIA HALENSIS 2/07<br />
eine Vielzahl von Studenten und Professoren<br />
zu ihren Mitgliedern; unter den Professoren<br />
waren die Mediziner Johann Friedrich Goldhagen<br />
und Johann Christian Reil, die Juristen<br />
Johann Christian Woltär und noch einmal<br />
Daniel Nettelbladt sowie der Weltreisende und<br />
Naturforscher Johann Reinhold Forster. Der<br />
in den 1780er Jahren in <strong>Halle</strong> lesende Theologe<br />
Carl Friedrich Bahrdt, der wegen seiner<br />
›radikalen‹ Anschauungen vielfach mit der<br />
<strong>Universität</strong> und dem Landesherrn in Konfl ikt<br />
geriet, war kein Logenmitglied, trat aber durch<br />
die Gründung einer eigenen Gesellschaft, der<br />
»Deutschen Union«, mit der Freimaurerloge in<br />
Konkurrenz – ein Beispiel, wie sich universitäre<br />
und freimaurerische Interessen überlagern<br />
konnten, ohne dass die eine Ebene inhaltlich<br />
mit der anderen in Zusammenhang stehen<br />
musste.<br />
D IE LOGE ALS FORUM<br />
Wenngleich es an der <strong>Universität</strong> <strong>Halle</strong> im<br />
18. Jahrhundert wohl keine unmittelbar den<br />
Freimaurerlogen zuzurechnenden wissenschaftlichen<br />
oder politischen Entwicklungen<br />
gab, waren sie doch in hohem Maße Versammlungen<br />
gebildeter Eliten: Rund zwei<br />
Drittel ihrer Mitglieder waren Studenten oder<br />
Professoren, nur ein Drittel gingen nichtakademischen<br />
Berufen nach. In absoluten Zahlen<br />
waren es in der Loge »Zu den drei goldenen<br />
Schlüsseln« mehr als 60, in der Loge »Philadelphia«<br />
über 90 und in der Loge »Zu den drei<br />
Degen«gar etwa 150 Mitglieder, die in der<br />
einen oder anderen Weise mit der <strong>Universität</strong><br />
verbunden waren. Die Studenten bildeten<br />
dabei stets die größte Gruppe der Logenmitglieder,<br />
und sie hatten hier ein Forum, in<br />
dem sie ihren Kommilitonen und Lehrern als<br />
›Brüder‹ begegnen und sich mit ihnen abseits<br />
obrigkeitlicher Aufsicht austauschen konnten<br />
– neben dem offi ziellen Vorlesungsbetrieb<br />
spielte sich ein Teil des akademischen und studentischen<br />
Lebens in <strong>Halle</strong> im 18. Jahrhundert<br />
im diskreten Raum der Freimaurerlogen ab.<br />
■<br />
Dr. Renko Geffarth,<br />
Jahrgang 1974, studierte Geschichte und<br />
Chemie in Marburg, Leipzig und <strong>Halle</strong> und<br />
wurde 2004 in <strong>Halle</strong> promoviert mit einer<br />
religions- und sozialhistorischen Arbeit<br />
über den Geheimorden der Gold- und<br />
Rosenkreuzer. Er arbeitet derzeit am Interdisziplinären<br />
Zentrum für die Erforschung<br />
der Europäischen Aufklärung im Rahmen<br />
der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
geförderten Forschergruppe 529 zu<br />
»<strong>Halle</strong> als religionsgeschichtlichem Ort 1740–1800«.<br />
Telefon 0345 55-21785, E-Mail: renko.geffarth@izea.uni-halle.de<br />
13<br />
U NIVERSITÄTSGESCHICHTE