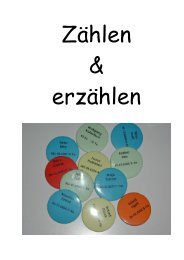Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bau von Äolsharfen<br />
Martin Pühringer<br />
"Da fing die Äolsharfe der Schöpfung an zu zittern und zu klingen, von oben und unten angeweht, und meine<br />
unsterbliche Seele war eine Saite auf dieser Laute."<br />
Jaena Paul, Leben des Quintus Fixlein (1796)<br />
Die Äolsharfe ist ein Saiteninstrument, das durch den natürlichen Wind zum Klingen gebracht wird. Sie besteht<br />
aus (normalerweise) 12 Darm- bzw. Messingsaiten, die alle gleich lang, aber verschieden dick sind.<br />
Diese sind auf einem Holzkörper (bis zu 2 m lang) angebracht, welcher den Wind über die Saiten führt und<br />
gleichzeitig als Resonanzkörper dient. Ihr leiser, geheimnisvoller Klang verzauberte die Menschen seit langer<br />
Zeit.<br />
Geschichte: Von Homer an (800 v. Chr.) sprechen Legenden von Hermes, der seine Leier durch den Wind<br />
spielen ließ. Auch Davids Harfe wurde durch Gottes Wind zu Klingen gebracht.<br />
Die neuere Geschichte der Äolsharfe beginnt mit ihrer Wiederentdeckung durch Kircher (Musurgia universalis,<br />
1652), der ihre Konstruktion beschrieb. Der Name findet sich erstmals in Hofmanns Lexikon universale<br />
(1677): Aeolium instrumentum. Während in England Äolsharfen vor allem in Häusern (Fenstern) aufgestellt<br />
wurden, fanden sie sich am Kontinent eher in Grotten, Gärten oder Sommerhäusern. Neben England, wo es<br />
eine richtige Äolsharfen-Euphorie gab wurde nur noch in Deutschland eine größere Zahl davon gebaut. Außerhalb<br />
von Europa fanden sich entsprechende Instrumente in Äthiopien, Java, China und Guyana.<br />
In der Tonentstehung begegnet uns das interessante Phänomen des Wechselspiels zwischen <strong>Chaos</strong> und<br />
<strong>Ordnung</strong>. Der gleichmäßige Wind streicht über die Saiten, wodurch dahinter eine minimale Ablösung von<br />
Wirbeln entsteht. Diese verstärken wieder die schwache Schwingung der Saiten, damit verstärkt sich aber<br />
auch die Wirbelstraße. Der Rückkopplungskreis führt zu einem stabilen Ton in der Wechselwirkung Saitenschwingung<br />
– Wirbelablösung. Somit ist eine einfache Luftströmung in eine geordnete Schwingung umgewandelt<br />
worden. Die Charakteristik der Töne hängt vor allem von der Windgeschwindigkeit ab. Bei den von<br />
uns gebauten Exemplaren begann der Ton ab etwa 25 km/h, eher tief und obertonarm. Bis 40 km/h nahm<br />
der Obertonreichtum zu, der Klang wurde also heller und höher. Bei höheren Geschwindigkeiten verschwindet<br />
der Ton wieder.<br />
31