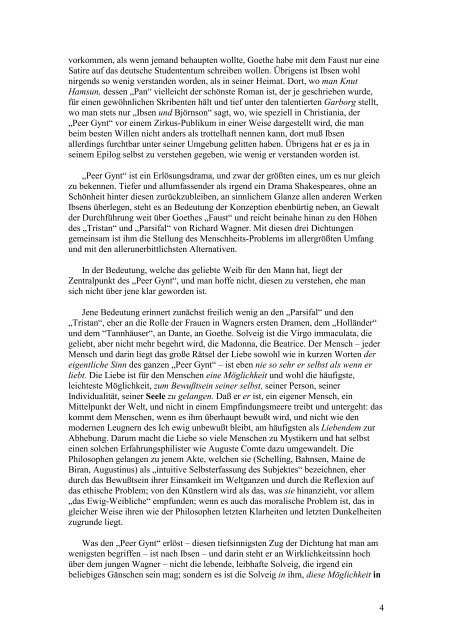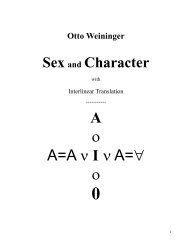Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
vorkommen, als wenn jemand behaupten wollte, Goethe habe mit dem Faust nur eine<br />
Satire auf das deutsche Studententum schreiben wollen. Übrigens ist Ibsen wohl<br />
nirgends so wenig verstanden worden, als in seiner Heimat. Dort, wo man Knut<br />
Hamsun, dessen „Pan“ vielleicht der schönste Roman ist, der je geschrieben wurde,<br />
für einen gewöhnlichen Skribenten hält und tief unter den talentierten Garborg stellt,<br />
wo man stets nur „Ibsen und Björnson“ sagt, wo, wie speziell in Christiania, der<br />
„Peer Gynt“ vor einem Zirkus-Publikum in einer Weise dargestellt wird, <strong>die</strong> man<br />
beim besten Willen nicht anders als trottelhaft nennen kann, dort muß Ibsen<br />
allerdings furchtbar unter seiner Umgebung gelitten haben. Übrigens hat er es ja in<br />
seinem Epilog selbst zu verstehen gegeben, wie wenig er verstanden worden ist.<br />
„Peer Gynt“ ist ein Erlösungsdrama, und zwar der größten eines, um es nur gleich<br />
zu bekennen. Tiefer und allumfassender als irgend ein Drama Shakespeares, ohne an<br />
Schönheit hinter <strong>die</strong>sen zurückzubleiben, an sinnlichem Glanze allen anderen Werken<br />
Ibsens überlegen, steht es an Bedeutung der Konzeption ebenbürtig neben, an Gewalt<br />
der Durchführung weit über Goethes „Faust“ und reicht beinahe hinan zu den Höhen<br />
des „Tristan“ und „Parsifal“ <strong>von</strong> Richard Wagner. Mit <strong>die</strong>sen drei Dichtungen<br />
gemeinsam ist ihm <strong>die</strong> Stellung des Menschheits-Problems im allergrößten Umfang<br />
und mit den allerunerbittlichsten Alternativen.<br />
In der Bedeutung, welche das geliebte Weib für den Mann hat, liegt der<br />
Zentralpunkt des „Peer Gynt“, und man hoffe nicht, <strong>die</strong>sen zu verstehen, ehe man<br />
sich nicht über jene klar geworden ist.<br />
Jene Bedeutung erinnert zunächst freilich wenig an den „Parsifal“ und den<br />
„Tristan“, eher an <strong>die</strong> Rolle der Frauen in Wagners ersten Dramen, dem „Holländer“<br />
und dem “Tannhäuser“, an Dante, an Goethe. Solveig ist <strong>die</strong> Virgo immaculata, <strong>die</strong><br />
geliebt, aber nicht mehr begehrt wird, <strong>die</strong> Madonna, <strong>die</strong> Beatrice. Der Mensch – jeder<br />
Mensch und darin liegt das große Rätsel der Liebe sowohl wie in kurzen Worten der<br />
eigentliche Sinn des ganzen „Peer Gynt“ – ist eben nie so sehr er selbst als wenn er<br />
liebt. Die Liebe ist für den Menschen eine Möglichkeit und wohl <strong>die</strong> häufigste,<br />
leichteste Möglichkeit, zum Bewußtsein seiner selbst, seiner Person, seiner<br />
Individualität, seiner Seele zu gelangen. Daß er er ist, ein eigener Mensch, ein<br />
Mittelpunkt der Welt, und nicht in einem Empfindungsmeere treibt und untergeht: das<br />
kommt dem Menschen, wenn es ihm überhaupt bewußt wird, und nicht wie den<br />
modernen Leugnern des Ich ewig unbewußt bleibt, am häufigsten als Liebendem zur<br />
Abhebung. Darum macht <strong>die</strong> Liebe so viele Menschen zu Mystikern und hat selbst<br />
einen solchen Erfahrungsphilister wie Auguste Comte dazu umgewandelt. Die<br />
Philosophen gelangen zu jenem Akte, welchen sie (Schelling, Bahnsen, Maine de<br />
Biran, Augustinus) als „intuitive Selbsterfassung des Subjektes“ bezeichnen, eher<br />
durch das Bewußtsein ihrer Einsamkeit im Weltganzen und durch <strong>die</strong> Reflexion auf<br />
das ethische Problem; <strong>von</strong> den Künstlern wird als das, was sie hinanzieht, vor allem<br />
„das Ewig-Weibliche“ empfunden; wenn es auch das moralische Problem ist, das in<br />
gleicher Weise ihren wie der Philosophen <strong>letzten</strong> Klarheiten und <strong>letzten</strong> Dunkelheiten<br />
zugrunde liegt.<br />
Was den „Peer Gynt“ erlöst – <strong>die</strong>sen tiefsinnigsten Zug der Dichtung hat man am<br />
wenigsten begriffen – ist nach Ibsen – und darin steht er an Wirklichkeitssinn hoch<br />
über dem jungen Wagner – nicht <strong>die</strong> lebende, leibhafte Solveig, <strong>die</strong> irgend ein<br />
beliebiges Gänschen sein mag; sondern es ist <strong>die</strong> Solveig in ihm, <strong>die</strong>se Möglichkeit in<br />
4