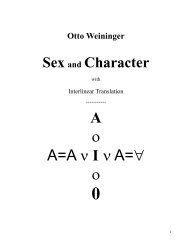Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Darum will er alle Vergangenheit töten: Er reitet seine Mutter in den Tod hinüber.<br />
Denn er muß „vergessen, was ihn drückt“. Seine Mutter 32 hat ihm gegenüber immer<br />
<strong>die</strong> Moral und <strong>die</strong> Einsicht vertreten; nun entzieht er sich gleichsam selbst seinen<br />
Mutterboden. Vielleicht liegt auch hier keimhaft der Gedanke zugrunde, daß er<br />
gerade in seinem Verhältnis zum Weibe allein er selbst war. 33<br />
So sehen wir ihn denn im vierten Akte am tiefsten gesunken. Der Mensch lebt<br />
nun in völliger Gemeinschaft mit den Affen, als welche sich das Trollpack des<br />
zweiten Aktes endgültig entpuppt (absichtliche Wiederholung des Wortes: Der „Alte<br />
war schlimm, <strong>die</strong> Jungen sind Bestien“); ja der Gyntismus wird zur Losung der<br />
Menschheit überhaupt: Peer Gynt wird Prophet. In <strong>die</strong>ser Eigenschaft bietet er alles<br />
auf, um – <strong>von</strong> einem Mädchen beachtet zu werden und hierdurch etwas für sich zu<br />
gewinnen. Am Ende erfällt sich nun gar sein alter Traum: Er wird Kaiser. Aber mit<br />
Schrecken muß er zuletzt gewahren, daß er in einem Irrenhause steckt und der Kaiser<br />
der wahnsinnigen, vertierten Menschheit ist.<br />
In <strong>die</strong>ser Szene im Irrenhause liegt wohl <strong>die</strong> gräßlichste Ironie, <strong>die</strong> fürchterlichste<br />
Satire, auf <strong>die</strong> je ein Mensch verfallen ist.<br />
Peer Gynt im Verein mit den Irren, <strong>von</strong> denen <strong>die</strong>ser wie eine Feder ist, <strong>die</strong> nie<br />
zum Schreiben, sondern stets nur als Streusand gebraucht wird, jener wie ein Papier,<br />
das nie beschrieben wurde: ein unaufgeschlagenes Buch in seiner Mutter Schoß, sich<br />
als verdruckt erweisend, da es aufgemacht wird. Das absolute Fehlen eines Ich und<br />
das damit verbundene völlige Fehlen eines Soll; den Menschen, der nicht mehr weiß,<br />
was er ist und danach schreit, <strong>von</strong> irgend jemand seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt<br />
zu werden, <strong>die</strong> er selbst nicht mehr finden und nicht aktiv mehr verwirklichen<br />
kann; <strong>die</strong> Verzweiflung daran, je das sein zu können, wozu man geboren ist – <strong>die</strong>s<br />
alles sagt in seinen wenigen wilden Rhythmen der Dialog mit dem Minister Hussein.<br />
Es ist nicht meine Absicht, einen fortlaufenden Kommentar zu der Dichtung zu<br />
liefern, in der mir so manche Einzelheiten gar nicht durchsichtig sind. Solche<br />
Unternehmungen haben, abgesehen <strong>von</strong> ihrem Umfange, immer zu viel Prätention<br />
und können darum nur geschmacklos wirken.<br />
Ich will nur noch auf einige große Schönheiten der Dichtung hinweisen: außer auf<br />
den in <strong>die</strong>ser Hinsicht allgemein berühmten Schluß des dritten noch auf <strong>die</strong> erste<br />
Szene des zweiten und auf <strong>die</strong> außerordentliche Mitte des fünften Aktes, wo Peer<br />
Gynt des nicht gelebten Lebens seines höheren Ich gedenken muß („Knäuel“, „Welke<br />
32 Eine der vorzüglichsten Frauengestalten Ibsens, wenn auch ohne sonderliche Tiefe behandelt.<br />
33 Die Interpretation <strong>die</strong>ser Schlußszene des dritten Aktes, <strong>die</strong> ich hier versuche, ist, ich fühle es, sehr gewagt und<br />
ich kann sie nur noch durch den Hinweis auf den fünften Akt stützen, wo <strong>die</strong> Mutter dem endlich zum Bewußtsein<br />
seiner Schuld gelangten Sohne ebenfalls als Anklägerin eben im Hinblick auf <strong>die</strong>sen Ritt erscheint. Aber <strong>die</strong>se<br />
Szene des dritten Aktes – für <strong>die</strong> naive Auffassung <strong>die</strong> leichteste der Dichtung – muß in einer so durchaus<br />
symbolischen Tragö<strong>die</strong> doch auch einen tieferen Sinn besitzen. Sollte <strong>die</strong>ser sein, daß in Peer jetzt der Egoismus<br />
des Patienten, des <strong>von</strong> eigenen Leiden Geplagten und darum, für <strong>die</strong> der anderen Achtlosen zum Vorschein<br />
komme? Daß er an allen anderen Wesen rächen wolle, daß ihm kein Glück mit Solveig beschieden ist? Ich kann es<br />
nicht ganz glauben. Auch schiene mir nur noch folgendes möglich. Ibsen, der in den Zeiten seiner eigentlichen<br />
hervorragenden Produktion durchaus Masochist ist (Beweis vor allem <strong>die</strong> „Nordische Heerfahrt“ und „Baumeister<br />
Solness“), war in seiner Jugend nicht frei <strong>von</strong> sadistischen Zügen (in vielen der <strong>von</strong> ihm lange zurückgehaltenen<br />
Gedichten und in „Olafs Liljekrans“, auch im „Fest auf Solhaug“ ist noch eine Spur <strong>von</strong> Sadismus). Es sind nun<br />
wirklich in den Peer Gynt des zweiten („Raub der Ingride“) und des ersten Aktes (Drohung an Solveig) sadistische<br />
Züge geraten; möglich, daß Ibsen auch <strong>die</strong>se Züchtigung an sich vornehmen wollte. Für den Charakter des Peer<br />
Gynt wäre das aber durchaus unwesentlich und also ein Fehler der Dichtung.<br />
14