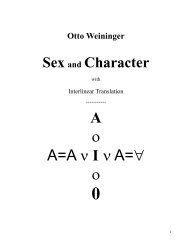Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Ueber die letzten Dinge (1904), von Otto Weininger - Natural Thinker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ihn ausübte. Nach einer Siegfriedvorstellung sagte er einmal, er begreife nicht, wie –<br />
nach <strong>die</strong>ser Melo<strong>die</strong> – das Haus noch stehen bleiben könne. Noch in der verzweifelten<br />
Stimmung seiner <strong>letzten</strong> Lebenstage wurde er <strong>von</strong> dem Motiv – er selbst nannte es<br />
„<strong>die</strong> Resorption des Horizontes“ (weil der ganze Horizont hier gleichsam umarmt,<br />
verschlungen wird) – aufs furchtbarste erschüttert. Vor der zunehmenden<br />
Verdunkelung seiner Gemütsstimmung tat sich noch einmal ein weiter offener blauer<br />
Himmel auf; dem umdüsterten Auge erstrahlte noch einmal das „siegende Licht.“ –<br />
Sonst will ich noch das Regenbogen-Motiv (Rheingold) erwähnen, welches ihm etwas<br />
<strong>von</strong> der „Freiheit des Objektes“ zu enthalten schien; auch <strong>die</strong>ses schätzte er besonders<br />
hoch. – Einige musikpsychologische Bemerkungen über Wagnersche Melo<strong>die</strong>n, <strong>die</strong><br />
ihm besonders nahe gingen, hat er übrigens selbst in <strong>die</strong>sem Buche zur Sprache<br />
gebracht.<br />
Nächst Richard Wagner verehrte er Beethoven am meisten. Er hielt Beethoven für<br />
ein Genie, dessen Gefahr das Verbrechen gewesen ist, wie Knut Hamsun, Kant,<br />
Augustinus. Die Gefahr des Bösen, <strong>die</strong> Sehnsucht nach Reinheit, das furchtbare<br />
Leiden und der gewaltige Kampf waren es, <strong>die</strong> ihn bei Beethoven anzogen; vor allem<br />
aber jene merkwürdige, verklärte Freude, deren Beethoven allein fähig war – er<br />
nannte sie „<strong>die</strong> gerettete Freude.“ (Dabei dachte er besonders an das Adagio aus der<br />
IX. Symphonie, <strong>die</strong> Stelle in B-dur.) – Von den Mozartschen Opern schätzte er den<br />
Don Juan am höchsten; Mozart, Bach und Händel waren <strong>die</strong> – in seinem weiteren<br />
Sinne – frömmsten Komponisten. 5 Als <strong>die</strong> Gefahr Bachs sah er das Chaos an; <strong>die</strong><br />
Gefahr des Händel sei Zweifel an der Allmacht Gottes gewesen. Aus der modernen<br />
Musik schätzte er das Lied der Solveig in Griegs Peer-Gynt-Suite besonders hoch; er<br />
nannte dessen A-dur-Melo<strong>die</strong> „<strong>die</strong> größte Luftverdünnung, <strong>die</strong> jemals erreicht worden<br />
sei.“ – Die sogenannte „leichte Musik“ war ihm entweder gleichgültig oder (wie z.B.<br />
alle Walzer) direkt antipathisch.<br />
Ich will nun einiges über das Verhältnis <strong>Weininger</strong>s zur Natur anführen. Er besaß<br />
eine ungeheuer starke, sehr differenzierte und sehr umfassende Naturempfindung; hier<br />
zeigte sich recht eigentlich seine durchaus universelle Veranlagung. Das höchste für<br />
ihn war der Sonnenuntergang (der ihm wahrscheinlich das Erlöschen des göttlichen<br />
Lichtes beim Sündenfall symbolisierte). Alle Erscheinungen des Lichtes wirkten sehr<br />
stark auf ihn; am stärksten der Anblick des Feuers, das er als den Ausdruck des<br />
Bösen, der Vernichtung empfand. Auch für das Wasser in allen seinen Formen hatte<br />
er viel Sinn. Die Quelle bedeutete ihm <strong>die</strong> Geburt, der Fluß das apollinische und das<br />
Meer das dionysische Prinzip. Überhaupt wurde alles Sichtbare als das Symbol einer<br />
ethischen und psychischen Realität aufgefaßt. Nicht als ob sich jede Empfindung<br />
gleich in abstrakte Reflexion umgesetzt hätte; sondern das intensivste Naturerlebnis<br />
war ihm eins mit einer sicheren Erkenntnis über <strong>die</strong> Bedeutung <strong>die</strong>ses Phänomens für<br />
das Universum. Mit der Form und der Farbe zugleich erschaute er <strong>die</strong> sittliche Potenz,<br />
<strong>die</strong> Idee, <strong>die</strong> Symbol eines Geistigen. „Alle Tiere sind Symbole verbrecherischer, alle<br />
Pflanzen Symbole neurasthenischer Phänomene im Menschen“ (Letzte Aphorismen).<br />
In <strong>die</strong>ser Symbolik traf sich seine Intuition mit der idealistischen Philosophie. „Die<br />
Welt ist meine Vorstellung“ –, somit kommt allen Erscheinungen nur soweit Realität<br />
zu, als sie Symbole jener zweiten Welt sind, <strong>die</strong> uns in verschiedenen Gestalten hier<br />
entgegentritt: als das höhere, ewige Leben; als das zeitlose Sein, als <strong>die</strong> intelligible<br />
5 Man lese <strong>die</strong> Stelle über <strong>die</strong> Arten der Frömmigkeit in „Geschlecht und Charakter“ (1. Auflage, S.433) nach. Da<br />
heißt es unter anderem: „Frömmigkeit braucht nicht in ewiger Betrachtung vor dem Weltganzen zu stehen (so wie<br />
Bach vor ihm steht); sie mag (wie bei Mozart) als eine alle Einzeldinge begleitende Religiosität sich offenbaren.“<br />
iii