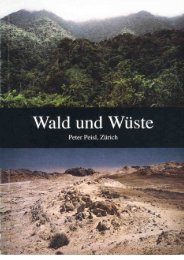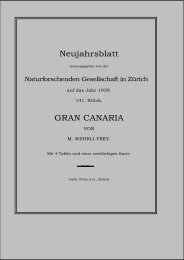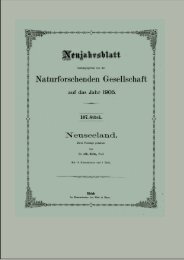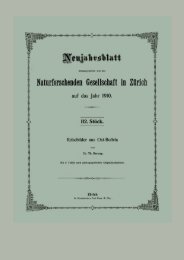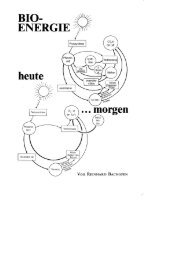Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 29 -<br />
alpentäler von Davos und Arosa für Tuberkulose auf den Fall von Saharastaub zurückzuführen sei. Im<br />
Jahre 1936 wurden am 4. März, 7. April, 26. und 27. Juni, 27. und 28. Juli, 20. und 21. September<br />
Staubfälle signalisiert. Am 5. März wurde <strong>in</strong> Arosa gelbroter Schnee festgestellt:<br />
«Schmutzige Strähnen, unmittelbar daneben das Weiss unberührt lassend» 71 nachdem am 4. März <strong>in</strong><br />
Arosa der Staub trocken angeweht worden und im Engad<strong>in</strong> mit Niederschlag gefallen war. Auch am 20.<br />
März 1937 wurde <strong>in</strong> Arosa «gelber» Schnee konstatiert: auf e<strong>in</strong>em Quadratmeter Bodenfläche konnten an<br />
diesem Tage bis zu 0,6 g Staub gesammelt werden.<br />
Trotzdem zweifellos <strong>in</strong> zahlreichen Fällen direkt Saharastaub bis über die Schweizeralpen geweht wurde,<br />
ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass <strong>in</strong> gewissen Fällen der Staub auch lokaler oder<br />
mediterraner Herkunft ist. Darauf sche<strong>in</strong>t u. a. e<strong>in</strong>e Beobachtung von Glawion h<strong>in</strong>zuweisen, der kürzlich<br />
«Über e<strong>in</strong>ige Staubfälle <strong>in</strong> Arosa» berichtete 72 . Er verfolgte die Trübung der Luft mit e<strong>in</strong>em<br />
Freiluftkonimeter der Firma Zeiss. Bei subtropischer Warmluft wurde jeweilen hoher Staubgehalt der<br />
Luft festgestellt, während der Staubgehalt von maritimer Polarluft meistens sehr niedrig war. Aber gerade<br />
am 22. Juli 1936 wies maritime Polarluft e<strong>in</strong> Maximum an Staubteilchen (48200 Teilchen pro Liter gegen<br />
29000 Teilchen der subtrop. Warmluft vom 28. Juli) auf. Wahrsche<strong>in</strong>lich habe die kalte Polarluft aus<br />
tieferen Lagen staubreiche Luft mit sich geführt.<br />
1926 wies R. Billwiller jun. auf den Glarner Dimmerföhn als e<strong>in</strong>e besondere Föhnart h<strong>in</strong>, die bisher <strong>in</strong> der<br />
Fachliteratur unbeachtet geblieben sei. Billwiller glaubt, dass bei Dimmerföhn «die Talschlüsse der Föhntäler<br />
zum Teil überweht werden und der W<strong>in</strong>dfall mehr den Ausgang der Täler und das Voralpengebiet» treffe.<br />
Als Beispiele erwähnt Billwiller den Dimmerföhn vom 4./5. Januar 1919, der grosse W<strong>in</strong>dwurfschäden<br />
im Mittelland verursachte und den Föhnsturm vom 15. Februar 1925 73 , bei denen das Zentrum e<strong>in</strong>er<br />
Depression ganz besonders nahe den Alpen passierte «und grosse barometrische Gradienten über<br />
letzteren bed<strong>in</strong>gte». Wir vermuten, dass die Bezeichnung Dimmerföhn auf die vielleicht gerade bei<br />
Dimmerföhn häufige Trübung der Luft durch mittelländischen oder Saharastaub zurückzuführen ist.<br />
Die Klassifikation der Föhnstürme ist noch ke<strong>in</strong>eswegs allgeme<strong>in</strong> geklärt. So wurde <strong>in</strong> der Presse<br />
(«Basler Nationalzeitung» vom 30. Juni 1937 durch Dr. W. Strub) der Föhnsturm vom 20. Mai 1937 als<br />
«Scirocco» bezeichnet, da es sich nicht um den gewöhnlichen Alpenföhn gehandelt habe, weil «hiesige<br />
Personen damals nicht Kopfweh wie sonst bei Föhn, sondern rheumatische Schmerzen empfunden» hätten. Zweifellos g<strong>in</strong>g<br />
der Föhnsturm vom 20. Mai 19,37 aus der starken Südströmung hervor, welche von Süditalien bis nach<br />
Norddeutschland strömte, <strong>in</strong> Italien als heisser, feuchter und unerträglicher Scirocco empfunden wurde,<br />
aber beim Übergang über die Alpen nahm dieser W<strong>in</strong>d doch typische Föhneigenschaften an: relativ<br />
grosse Trockenheit und Wärme <strong>in</strong> der Ost- und Zentralschweiz verglichen mit dem Tess<strong>in</strong>.<br />
Das Problem der Abhängigkeit des Bef<strong>in</strong>dens des Menschen von den Wetterersche<strong>in</strong>ungen, die<br />
sogenannte «Wetterfühligkeit» ist erst <strong>in</strong> den letzten Jahren 74 stärker beachtet worden. Es ist allgeme<strong>in</strong><br />
bekannt, dass Föhnlagen je nach Veranlagung und Disposition <strong>in</strong> ganz aus-<br />
71 N.Z.Z., 8. März 1936.<br />
72 Met. Zeitschr., 1937, Februar.<br />
73 R. Billwiller, «Der Glarner Dimmerföhn». Verhandlungen der Schweizer Naturforsch. <strong>Gesellschaft</strong>, Freiburg 1926. Die<br />
Dimmerföhne vom 4.15. Januar 1919 und 15. Februar 1925 s<strong>in</strong>d ausführlich geschildert im <strong>Neujahrsblatt</strong> der <strong>Naturforschende</strong>n<br />
<strong>Gesellschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Zürich</strong> auf das Jahr 1926 von Hans Frey, «Die lokalen W<strong>in</strong>de am <strong>Zürich</strong>see». Die Bezeichnung Dimmerföhn<br />
sche<strong>in</strong>t nicht immer <strong>in</strong> dem von O. Heer erwähnten S<strong>in</strong>ne gebraucht worden zu se<strong>in</strong>. Nach Wild («Ueber den Föhn etc.», 8.75)<br />
unterschied 1865 Dr. med. Oertle <strong>in</strong> Glarus den «wilden Föhn» und den «zahmen oder Dimmerföhn». Bei letzterem wehe nur<br />
mässig starke südliche Luftströmung.<br />
74 Siehe vor allem die «Bioklimatischen Beiblätter» der Met. Zeitschr. Der Verfasser des vorliegenden <strong>Neujahrsblatt</strong>es hat -<br />
angeregt durch e<strong>in</strong>en «Beitrag zur Erforschung der Wetterfühligkeit» von ,Dr. E. Düm (Solothurn 1936) - während e<strong>in</strong>es ganzen<br />
Jahres genaue Aufzeichnungen über das subjektive Bef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Wetterlage gesammelt und dabei<br />
feststellen können, dass nicht nur Föhnlagen, sondern auch der Durchgang von Störungsl<strong>in</strong>ien der Tiefdruckgebiete und der<br />
Wechsel der Luftmassen e<strong>in</strong>en nach Stunden genau bestimmbaren E<strong>in</strong>fluss auf das Bef<strong>in</strong>den ausüben. Wenn möglich, sollen die<br />
betreffenden Aufzeichnungen an anderer Stelle veröffentlicht werden.