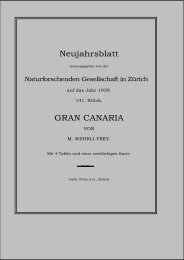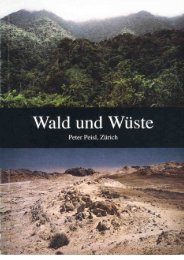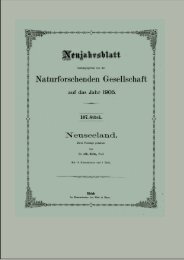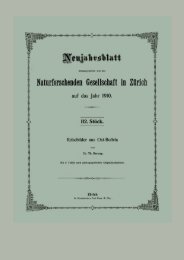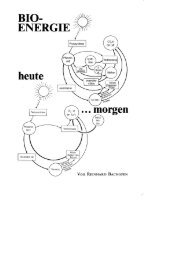Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorwort<br />
Die vorliegende Studie über den schweizerischen Alpenföhn, die ich me<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dern Hansjörg, Mario und<br />
Monica widme, versucht <strong>in</strong> möglichst leicht fasslicher Form <strong>in</strong> das Verständnis der Föhnersche<strong>in</strong>ungen im S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>er Physik der Atmosphäre unter Berücksichtigung der modernen Literatur e<strong>in</strong>zuführen. Aus Raumgründen<br />
verzichten wir auf e<strong>in</strong> besonderes Literaturverzeichnis. Dies kann um so leichter geschehen, als bis zum Jahre 1926<br />
e<strong>in</strong> nahezu voll-ständiges Literaturverzeichnis über «Föhn nord- und südwärts der Alpen» im Faszikel 1V4 der<br />
«Bibliographie der schweizerischen Landeskunde» unter dem Titel «Klimatologie» von Dr. R. B. Billwiller (Bern<br />
1927) vorliegt. Im übrigen geben wir die notwendigen Literaturh<strong>in</strong>weise <strong>in</strong> Fussnoten, soweit diese wie auch der<br />
Text aus Raumgründen nicht gekürzt werden mussten.<br />
Es wäre uns nicht möglich gewesen, ohne weitgehendste Unterstützung durch die Beamten der Schweizerischen<br />
Meteorologischen Zentralanstalt unsere Arbeit <strong>in</strong>nert nützlicher Frist abzuschliessen. Direktor Dr. P. L.<br />
Merganton danken wir für die Erlaubnis, die Bibliothek der Zentralanstalt benützen zu dürfen, der Bibliothekar<strong>in</strong><br />
Frl. E. Ste<strong>in</strong>er für den Eifer, mit dem sie unseren Bibliothekwünschen entgegenkam, Dr. J. Maurer, Dr. R. Billwiller,<br />
Ing. Grütter und Utt<strong>in</strong>ger für die wertvollen W<strong>in</strong>ke, mit denen sie uns bereitwillig an die Hand gegangen s<strong>in</strong>d. Nicht<br />
ger<strong>in</strong>gen Dank schulden wir auch jenen Herren und Institutionen, die uns entgegenkommenderweise<br />
meteorologisches Beobachtungsmaterial zur Verfügung stellten. Wir haben sie jeweilen an der entsprechenden<br />
Stelle im Text erwähnt. Zu guter Letzt möchten wir auch dem Redaktor der Vierteljahrsschrift der <strong>Naturforschende</strong>n<br />
<strong>Gesellschaft</strong>, Prof. Dr. Hans Sch<strong>in</strong>z für die moralische Unterstützung danken, die er der vorliegenden Arbeit<br />
angedeihen liess. Der Verfasser<br />
1. KAPITEL<br />
Eigenschaften und Wirkungen des Föhnw<strong>in</strong>des<br />
In den schweizerischen Alpentälern tritt vom Herbst bis zum Frühjahr, seltener im Sommer, e<strong>in</strong><br />
eigentümlicher, warmer und trockener Südw<strong>in</strong>d, der sogenannte F ö h n auf, dessen Eigenschaften schon gegen die<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts das Interesse der Naturforscher erregten. Es ist nicht leicht, festzustellen, seit welchem<br />
Zeitpunkt der Föhn als e<strong>in</strong>e besondere W<strong>in</strong>dart erkannt und dementsprechend benannt wurde. Vielleicht bedeutete<br />
«die fön» zunächst nichts anderes als die südliche Himmelsrichtung. Wenigstens kann so e<strong>in</strong> im schweizerischen<br />
Idiotikon angeführtes Zitat aus dem Jahre 1489 aufgefasst werden: «Die Stadt <strong>Zürich</strong> liegt gegen der pfön an e<strong>in</strong>em<br />
See». Auch TSCHUDI schrieb 1606: «Da kam e<strong>in</strong> starker W<strong>in</strong>d von Mittag her, den wir Fön oder Südw<strong>in</strong>d<br />
nannten» 1 . Wahrsche<strong>in</strong>lich leitet sich das Wort Föhn von der late<strong>in</strong>ischen Bezeichnung des Westw<strong>in</strong>des «favonius»<br />
(Churwälsch: «favougn», «favoign», «fuagn»; welschschweizerisch: «foé», «foën», tess<strong>in</strong>isch: «fogn»;<br />
althochdeutsch wahrsche<strong>in</strong>lich: «der fonno» oder «die fonna») ab.<br />
Die Dialektausdrücke s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>heitlich. «Fön» sagt man im Prättigau (auch Pfön), <strong>in</strong> der<br />
Innerschweiz <strong>in</strong> den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden, sowie im Oberwallis; «Föne» im Saviental<br />
und im Guggisberg; «Fö» im Kanton Schaffhausen und im Gasterland; «Fü» im Aversertal, im Kanton Glarus (hier<br />
auch «Fön», «Fün», «Funa») und im Berner Oberland; «Pfön» im Appenzell und im Rhe<strong>in</strong>waldtal.<br />
Merkwürdigerweise ist der «Föhn» nicht<br />
1 Ähnlich H. E. Escher 1692: «. . . der Mittagw<strong>in</strong>d, die Föhn genennet.» Erst im 19.Jahrhundert setzte sich der männliche Artikel<br />
durch; J. J. Scheuchzer spricht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er «Helvetiae Historia Naturalis» durchgehend von «die Föhn» oder «Mittagw<strong>in</strong>d» und<br />
«ihren» Eigenschaften.