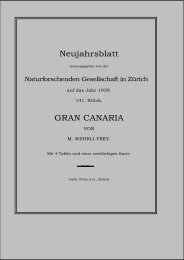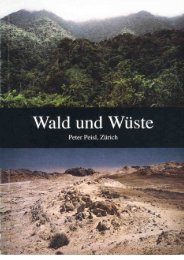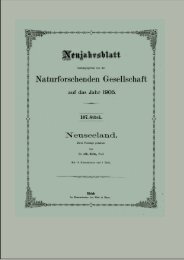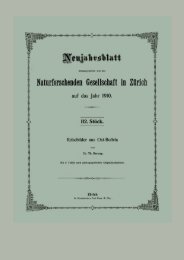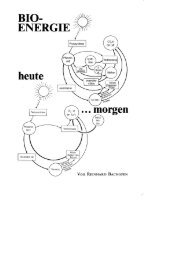Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Neujahrsblatt - Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 39 -<br />
absteigender W<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bergtal nur möglich, wenn - bezogen z.<br />
B. auf das Niveau des Talh<strong>in</strong>tergrundes - im Talh<strong>in</strong>tergrund höherer<br />
Luftdruck als im vorderen Teile des Tales herrscht. In der Gipfelhöhe<br />
der Alpen kann bei e<strong>in</strong>em Föhnsturm e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches, ziemlich<br />
gleichmässiges Luftdruckgefälle von Südosten nach Nordwesten angenommen<br />
werden. Das Relief der Alpen, der Voralpen, des Mittellandes<br />
und des Jura stört den Abfluss der bodennahen Luftschichten.<br />
Je mehr Luft <strong>in</strong> den mittleren Luftschichten - über dem Mittelland<br />
abfliesst, um so niedriger wird im Mittelland der Luftdruck werden.<br />
Deshalb wird nördlich der Alpen die bodennahe Luftschicht nur bis<br />
zu e<strong>in</strong>er gewissen Höhe herab <strong>in</strong> Bewegung geraten, während gleichzeitig<br />
die Föhnströmung nach und nach <strong>in</strong> die Föhntäler herabgezogen<br />
wird. Die Heftigkeit der Föhnströmung nimmt mit der Höhe über<br />
dem Talgrunde zu, da sich <strong>in</strong> der Höhe und im Talh<strong>in</strong>tergrund die<br />
Stroml<strong>in</strong>ien zusammendrängen. Diese Tatsache lässt sich auch im<br />
Glarnerland feststellen 104 .<br />
Wegen ihrer grossen k<strong>in</strong>etischen Energie räumt die <strong>in</strong> der Höhe<br />
wehende Föhnströmung nach und nach die tieferen, im Tale lagernden<br />
Luftschichten mehr oder weniger vollständig aus. Dies ist aber<br />
nur deshalb möglich, weil die unteren Luftschichten selbst schon im<br />
langsamen Abfliessen begriffen s<strong>in</strong>d. Analog wie bei e<strong>in</strong>em Flussbett<br />
wird die Föhnströmung <strong>in</strong> der Talmitte die grösste Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
aufweisen. Es ist anzunehmen, dass bei den meisten Föhntälern<br />
der Schweiz die Föhnströmung analog wie beim Innsbrucker Föhn an<br />
den das Föhntal quer abschliessenden Berghängen ihrer Bewegungsenergie<br />
zufolge wieder <strong>in</strong> die Höhe strömt, so beim Ausgang des<br />
Reusstales an den Hängen des Rigi und Rossberges, beim Ausgang<br />
des L<strong>in</strong>thtales an den Hängen des Planggenstockes und des Speer,<br />
um im Mittelland nur vere<strong>in</strong>zelt oder zeitlich verspätet durch die unteren<br />
Luftschichten bis zum Boden durchzubrechen, nachdem die<br />
Abb. 38.Föhnströmung und Luftdruck.<br />
Da die Bewegung e<strong>in</strong>er Flüssigkeit durch<br />
fünf Grössen (drei Komponenten der<br />
Geschw<strong>in</strong>digkeit, Druck und Dichte, bestimmt<br />
wird, müssen zur mathematischen<br />
Bestimmung e<strong>in</strong>er Flüssigkeitsbewegung<br />
fünf Gleichungen aufgestellt werden: 1.<br />
Die Eulersche Bewegungsgleichung mit<br />
drei Komponenten, 2. die Kont<strong>in</strong>uitätsgleichung<br />
als Ausdruck der Erhaltung der<br />
Masse, 3. die Zustandsgleichung. Die<br />
Strömung e<strong>in</strong>es Gases mit <strong>in</strong>nerer Reibung<br />
kann nie wirbelfrei se<strong>in</strong>. Der hydrostatische<br />
Druck wird beim Auftreten<br />
e<strong>in</strong>er Strömung vom hydrodynamischen<br />
Druck überlagert, weshalb obige schematische<br />
Zeichnung ke<strong>in</strong> genaues Bild der<br />
Druckverhältnisse geben kann. Bekanntlich<br />
s<strong>in</strong>kt der Druck mit wachsender Geschw<strong>in</strong>digkeit,<br />
um bei abnehmender Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
wieder zuzunehmen.<br />
Wolkenschicht durch Föhnfenster aufgelöst worden ist. Die ausgesprochenen lokalen Luftdruckm<strong>in</strong>ima<br />
der Föhntäler f<strong>in</strong>den zum Teil ihre Erklärung durch die übergrosse, trockenadiabatische Erwärmung der<br />
Föhnluft: Da jede Erwärmung der Luft e<strong>in</strong>e Steigerung des Luftdruckes nach sich zieht, erfordert umgekehrt<br />
das aerodynamische Gleichgewicht der Luft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gewissen Niveau über der Talsohle, dass die<br />
relativ warme Föhnluft nach ihrem Abstieg <strong>in</strong>s Tal e<strong>in</strong>e Senkung der lokalen Niveauflächen des Luftdruckes<br />
nach sich zieht 105 . Andererseits könnten diese lokalen Luftdruckm<strong>in</strong>ima zum Teil wohl auch als<br />
hydrodynamische Ersche<strong>in</strong>ung erklärt werden: In den engen Föhntälern muss die grosse Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
der Föhnströmung sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Druckverm<strong>in</strong>derung äussern.<br />
E<strong>in</strong>e analoge Ersche<strong>in</strong>ung kann über dem Mittelland angenommen werden. Da die Föhn-<br />
104 Der Hüttenwart der Fridol<strong>in</strong>shütte am Tödi erzählt, wenn der Föhn stark wehe, wage man kaum die Türe der Hütte zu öffnen.<br />
Er habe schon oft weit mehr als zwei Stunden zum Aufstieg bis zur Hütte gebraucht, da er mit dem Träger absitzen musste, um<br />
nicht vom W<strong>in</strong>d mitgerissen zu werden. Besonders stark wehe der Föhn noch weiter oben, «so dass es fast unmöglich ist, vom<br />
Tödi zum Ruse<strong>in</strong> zu gelangen. Aus diesem Grunde s<strong>in</strong>d schon oft Bergsteigerpartien zurückgekommen». Dagegen liegen die<br />
Steilhänge und das steil geschnittene Tal des Bifertenbaches unterhalb der Fridol<strong>in</strong>shütte auch bei stärkstem Föhn im<br />
W<strong>in</strong>dschatten. Oft weht der Föhn nur <strong>in</strong> der Höhe; gelangt gar nicht bis zur Hütte (sog. Bergföhn). Auch beim Hotel «Tödi» <strong>in</strong><br />
der Thierfehd macht sich der Föhn stärker bemerkbar als unten im Tal bei L<strong>in</strong>thal. Selbst zwischen Auen und L<strong>in</strong>thal soll e<strong>in</strong><br />
gewisser Unterschied der W<strong>in</strong>dstärke bemerkbar se<strong>in</strong>: In Auen und auch von Rasten, d.h. vom Ausgang des Sernftales, abwärts<br />
weht der Föhn stärker als <strong>in</strong> L<strong>in</strong>thal selbst oder zwischen L<strong>in</strong>thal und Haslen.<br />
105 E<strong>in</strong>e Erwärmung der Luft um 10 führt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Höhe von 1000 m zu e<strong>in</strong>er Luftdrucksteigerung von 0,31 mm nach der Formel<br />
db = b • h - dt/2184 (b = Barometerstand, h = Meereshöhe, genauer relative Höhe über dem Niveau der Umgebung, dt =<br />
Temperatursteigerung <strong>in</strong> Celsiusgraden, db = Luftdrucksteigerung). Umgekehrt kann e<strong>in</strong>e verzögerte Abnahme des Luftdruckes<br />
mit wachsender Höhe durch übernormales Temperaturgefälle verursacht se<strong>in</strong>.