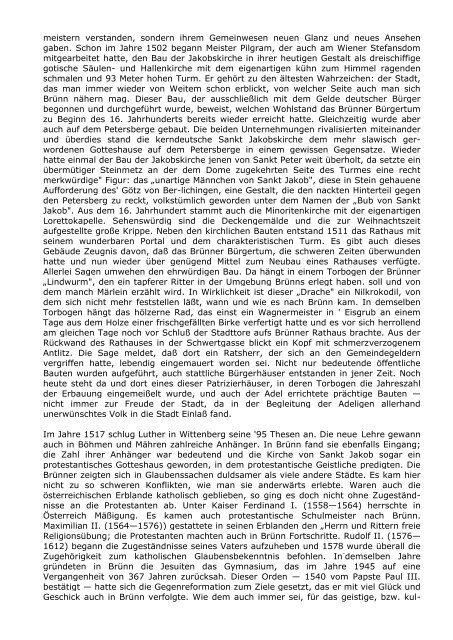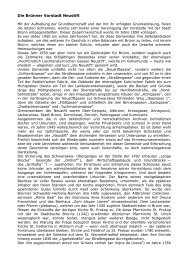Aus Brünns Vergangenheit
Aus Brünns Vergangenheit
Aus Brünns Vergangenheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
meistern verstanden, sondern ihrem Gemeinwesen neuen Glanz und neues Ansehen<br />
gaben. Schon im Jahre 1502 begann Meister Pilgram, der auch am Wiener Stefansdom<br />
mitgearbeitet hatte, den Bau der Jakobskirche in ihrer heutigen Gestalt als dreischiffige<br />
gotische Säulen- und Hallenkirche mit dem eigenartigen kühn zum Himmel ragenden<br />
schmalen und 93 Meter hohen Turm. Er gehört zu den ältesten Wahrzeichen: der Stadt,<br />
das man immer wieder von Weitem schon erblickt, von welcher Seite auch man sich<br />
Brünn nähern mag. Dieser Bau, der ausschließlich mit dem Gelde deutscher Bürger<br />
begonnen und durchgeführt wurde, beweist, welchen Wohlstand das Brünner Bürgertum<br />
zu Beginn des 16. Jahrhunderts bereits wieder erreicht hatte. Gleichzeitig wurde aber<br />
auch auf dem Petersberge gebaut. Die beiden Unternehmungen rivalisierten miteinander<br />
und überdies stand die kerndeutsche Sankt Jakobskirche dem mehr slawisch gerwordenen<br />
Gotteshause auf dem Petersberge in einem gewissen Gegensatze. Wieder<br />
hatte einmal der Bau der Jakobskirche jenen von Sankt Peter weit überholt, da setzte ein<br />
übermütiger Steinmetz an der dem Dome zugekehrten Seite des Turmes eine recht<br />
merkwürdige" Figur: das „unartige Männchen von Sankt Jakob", diese in Stein gehauene<br />
Aufforderung des' Götz von Ber-lichingen, eine Gestalt, die den nackten Hinterteil gegen<br />
den Petersberg zu reckt, volkstümlich geworden unter dem Namen der „Bub von Sankt<br />
Jakob". <strong>Aus</strong> dem 16. Jahrhundert stammt auch die Minoritenkirche mit der eigenartigen<br />
Lorettokapelle. Sehenswürdig sind die Deckengemälde und die zur Weihnachtszeit<br />
aufgestellte große Krippe. Neben den kirchlichen Bauten entstand 1511 das Rathaus mit<br />
seinem wunderbaren Portal und dem charakteristischen Turm. Es gibt auch dieses<br />
Gebäude Zeugnis davon, daß das Brünner Bürgertum, die schweren Zeiten überwunden<br />
hatte und nun wieder über genügend Mittel zum Neubau eines Rathauses verfügte.<br />
Allerlei Sagen umwehen den ehrwürdigen Bau. Da hängt in einem Torbogen der Brünner<br />
„Lindwurm", den ein tapferer Ritter in der Umgebung <strong>Brünns</strong> erlegt haben. soll und von<br />
dem manch Märlein erzählt wird. In Wirklichkeit ist dieser „Drache" ein Nilkrokodil, von<br />
dem sich nicht mehr feststellen läßt, wann und wie es nach Brünn kam. In demselben<br />
Torbogen hängt das hölzerne Rad, das einst ein Wagnermeister in ' Eisgrub an einem<br />
Tage aus dem Holze einer frischgefällten Birke verfertigt hatte und es vor sich herrollend<br />
am gleichen Tage noch vor Schluß der Stadttore aufs Brünner Rathaus brachte. <strong>Aus</strong> der<br />
Rückwand des Rathauses in der Schwertgasse blickt ein Kopf mit schmerzverzogenem<br />
Antlitz. Die Sage meldet, daß dort ein Ratsherr, der sich an den Gemeindegeldern<br />
vergriffen hatte, lebendig eingemauert worden sei. Nicht nur bedeutende öffentliche<br />
Bauten wurden aufgeführt, auch stattliche Bürgerhäuser entstanden in jener Zeit. Noch<br />
heute steht da und dort eines dieser Patrizierhäuser, in deren Torbogen die Jahreszahl<br />
der Erbauung eingemeißelt wurde, und auch der Adel errichtete prächtige Bauten —<br />
nicht immer zur Freude der Stadt, da in der Begleitung der Adeligen allerhand<br />
unerwünschtes Volk in die Stadt Einlaß fand.<br />
Im Jahre 1517 schlug Luther in Wittenberg seine '95 Thesen an. Die neue Lehre gewann<br />
auch in Böhmen und Mähren zahlreiche Anhänger. In Brünn fand sie ebenfalls Eingang;<br />
die Zahl ihrer Anhänger war bedeutend und die Kirche von Sankt Jakob sogar ein<br />
protestantisches Gotteshaus geworden, in dem protestantische Geistliche predigten. Die<br />
Brünner zeigten sich in Glaubenssachen duldsamer als viele andere Städte. Es kam hier<br />
nicht zu so schweren Konflikten, wie man sie anderwärts erlebte. Waren auch die<br />
österreichischen Erblande katholisch geblieben, so ging es doch nicht ohne Zugeständnisse<br />
an die Protestanten ab. Unter Kaiser Ferdinand I. (1558—1564) herrschte in<br />
Österreich Mäßigung. Es kamen auch protestantische Schulmeister nach Brünn.<br />
Maximilian II. (1564—1576)) gestattete in seinen Erblanden den „Herrn und Rittern freie<br />
Religionsübung; die Protestanten machten auch in Brünn Fortschritte. Rudolf II. (1576—<br />
1612) begann die Zugeständnisse seines Vaters aufzuheben und 1578 wurde überall die<br />
Zugehörigkeit zum katholischen Glaubensbekenntnis befohlen. In - demselben Jahre<br />
gründeten in Brünn die Jesuiten das Gymnasium, das im Jahre 1945 auf eine<br />
<strong>Vergangenheit</strong> von 367 Jahren zurücksah. Dieser Orden — 1540 vom Papste Paul III.<br />
bestätigt — hatte sich die Gegenreformation zum Ziele gesetzt, das er mit viel Glück und<br />
Geschick auch in Brünn verfolgte. Wie dem auch immer sei, für das geistige, bzw. kul-