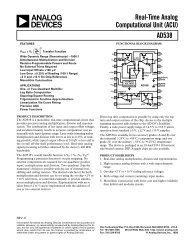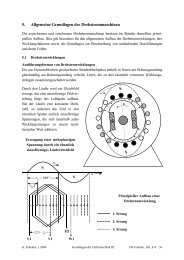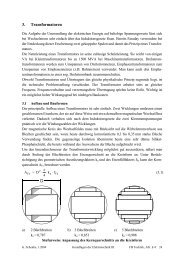4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home
4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home
4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die abgegebene Ausgangsspannung wird einem vorgegebenen sinusförmigen Sollwert möglichst<br />
gut angenähert. Beide Teilstromrichter arbeiten abwechselnd im Gleich- bzw. Wechselrichterbetrieb.<br />
Der Verschiebungsfaktor der Lastseite bestimmt dabei die jeweilige Stromrichtung.<br />
Die Differenzen in den Ausgangsspannungen der beiden Teilstromrichter einer Ausgangsphase<br />
haben Kreisströme wie beim Umkehrstromrichter zur Folge. Zur Vermeidung des Kreisstromes<br />
können auch beim Steuerumrichter kreisstromfreie Schaltungen verwendet werden. Bei<br />
Stromrichtungsumkehr tritt dann eine Totzeit auf.<br />
Wegen überwiegender Phasenanschnittsteuerung ist der Blindleistungsbedarf aus dem speisenden<br />
Drehstromnetz beim Steuerumrichter hoch.<br />
α<br />
Gleichrichterbetrieb<br />
u I<br />
0<br />
t<br />
α<br />
Wechselrichterbetrieb<br />
Spannungsverlauf in einer Phase beim Steuerumrichter<br />
<strong>4.</strong>4 Lastgeführte Wechselrichter<br />
Beim lastgeführten Wechselrichter stellt die Last die Kommutierungsspannung während der<br />
Kommutierung zur Verfügung.<br />
Da ein <strong>Stromrichter</strong> für die natürliche Kommutierung stets induktive Blindleistung braucht, ist<br />
Voraussetzung für den Betrieb lastgeführter <strong>Stromrichter</strong>, dass die Last diese zur Verfügung<br />
stellen kann. Der Laststrom muss aus diesem Grund eine kapazitive Komponente aufweisen.<br />
Diese Bedingung erfüllen Parallel- und Reihenschwingkreise oder übererregte Synchronmaschinen.<br />
Schwingkreiswechselrichter<br />
Eine ohmsch-induktive Last kann durch einen Kondensator zu einem Parallel- oder<br />
Reihenschwingkreis ergänzt werden. Die Eigenfrequenz f 0 des verlustlosen Lastkreises ist:<br />
1<br />
f 0 = (<strong>4.</strong>56)<br />
2π ⋅ L ⋅ C<br />
Die Eigenfrequenz f R des freischwingenden verlustbehafteten Lastkreises mit der Dämpfung δ<br />
heißt Kennfrequenz und berechnet sich zu:<br />
f<br />
R<br />
2<br />
R R C<br />
= f0<br />
⋅ 1- δ mit δ = = ⋅<br />
(<strong>4.</strong>57)<br />
2 ⋅ ω ⋅ L 2 L<br />
0<br />
Die Gln. (<strong>4.</strong>56 u. <strong>4.</strong>57) gelten sowohl für einen Parallel- als auch für einen Reihenschwingkreis.<br />
Die Betriebsfrequenz, mit der ein Schwingkreiswechselrichter betrieben wird, wird von der<br />
Steuerung vorgegeben. Damit der Schwingkreis eine kapazitive Stromkomponente hat, muss die<br />
Betriebsfrequenz beim Parallelschwingkreis oberhalb und beim Reihenschwingkreis unterhalb der<br />
Eigenfrequenz liegen.<br />
G. Schenke, 12.2006 Leistungselektronik <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 58