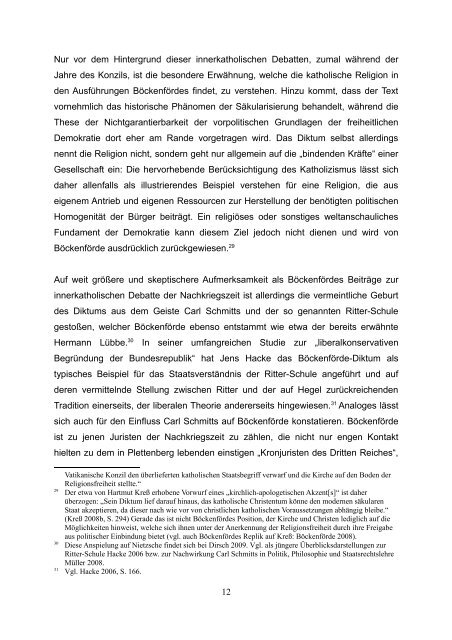Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nur vor dem Hintergrund dieser innerkatholischen Debatten, zumal während der<br />
Jahre des Konzils, ist die besondere Erwähnung, welche die katholische Religion in<br />
den Ausführungen Böckenfördes findet, zu verstehen. Hinzu kommt, dass der Text<br />
vornehmlich das historische Phänomen der Säkularisierung behandelt, während die<br />
These der Nichtgarantierbarkeit der vorpolitischen Grundlagen der freiheitlichen<br />
Demokratie dort eher am Rande vorgetragen wird. Das Diktum selbst allerdings<br />
nennt die Religion nicht, sondern geht nur allgemein auf die „bindenden Kräfte“ einer<br />
Gesellschaft ein: Die hervorhebende Berücksichtigung des Katholizismus lässt sich<br />
daher allenfalls als illustrierendes Beispiel verstehen <strong>für</strong> eine Religion, die aus<br />
eigenem Antrieb und eigenen Ressourcen zur Herstellung der benötigten politischen<br />
Homogenität der Bürger beiträgt. Ein religiöses oder sonstiges weltanschauliches<br />
Fundament der Demokratie kann diesem Ziel jedoch nicht dienen und wird von<br />
Böckenförde ausdrücklich zurückgewiesen. 29<br />
Auf weit größere und skeptischere Aufmerksamkeit als Böckenfördes Beiträge zur<br />
innerkatholischen Debatte der Nachkriegszeit ist allerdings die vermeintliche Geburt<br />
des Diktums aus dem Geiste Carl Schmitts und der so genannten Ritter-Schule<br />
gestoßen, welcher Böckenförde ebenso entstammt wie etwa der bereits erwähnte<br />
Hermann Lübbe. 30 In seiner umfangreichen Studie zur „liberalkonservativen<br />
Begründung der Bundesrepublik“ hat Jens Hacke das Böckenförde-Diktum als<br />
typisches Beispiel <strong>für</strong> das Staatsverständnis der Ritter-Schule angeführt und auf<br />
deren vermittelnde Stellung zwischen Ritter und der auf Hegel zurückreichenden<br />
Tradition einerseits, der liberalen Theorie andererseits hingewiesen. 31 Analoges lässt<br />
sich auch <strong>für</strong> den Einfluss Carl Schmitts auf Böckenförde konstatieren. Böckenförde<br />
ist zu jenen Juristen der Nachkriegszeit zu zählen, die nicht nur engen Kontakt<br />
hielten zu dem in Plettenberg lebenden einstigen „Kronjuristen des Dritten Reiches“,<br />
Vatikanische Konzil den überlieferten katholischen Staatsbegriff verwarf und die Kirche auf den Boden der<br />
Religionsfreiheit stellte.“<br />
29<br />
Der etwa von Hartmut Kreß erhobene Vorwurf eines „kirchlich-apologetischen Akzent[s]“ ist daher<br />
überzogen: „Sein Diktum lief darauf hinaus, das katholische Christentum könne den modernen säkularen<br />
Staat akzeptieren, da dieser nach wie vor von christlichen katholischen Voraussetzungen abhängig bleibe.“<br />
(Kreß 2008b, S. 294) Gerade das ist nicht Böckenfördes Position, der Kirche und Christen lediglich auf die<br />
Möglichkeiten hinweist, welche sich ihnen unter der Anerkennung der Religionsfreiheit durch ihre Freigabe<br />
aus politischer Einbindung bietet (vgl. auch Böckenfördes Replik auf Kreß: Böckenförde 2008).<br />
30<br />
Diese Anspielung auf Nietzsche findet sich bei Dirsch 2009. Vgl. als jüngere Überblicksdarstellungen zur<br />
Ritter-Schule Hacke 2006 bzw. zur Nachwirkung Carl Schmitts in Politik, Philosophie und Staatsrechtslehre<br />
Müller 2008.<br />
31<br />
Vgl. Hacke 2006, S. 166.<br />
12