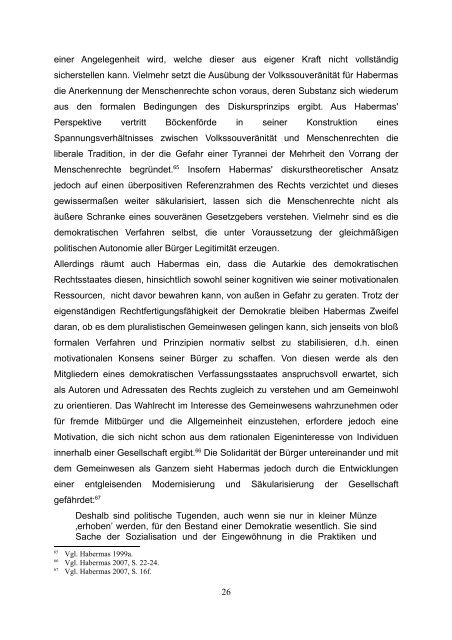Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einer Angelegenheit wird, welche dieser aus eigener Kraft nicht vollständig<br />
sicherstellen kann. Vielmehr setzt die Ausübung der Volkssouveränität <strong>für</strong> Habermas<br />
die Anerkennung der Menschenrechte schon voraus, deren Substanz sich wiederum<br />
aus den formalen Bedingungen des Diskursprinzips ergibt. Aus Habermas'<br />
Perspektive vertritt Böckenförde in seiner Konstruktion eines<br />
Spannungsverhältnisses zwischen Volkssouveränität und Menschenrechten die<br />
liberale Tradition, in der die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit den Vorrang der<br />
Menschenrechte begründet. 65 Insofern Habermas' diskurstheoretischer Ansatz<br />
jedoch auf einen überpositiven Referenzrahmen des Rechts verzichtet und dieses<br />
gewissermaßen weiter säkularisiert, lassen sich die Menschenrechte nicht als<br />
äußere Schranke eines souveränen Gesetzgebers verstehen. Vielmehr sind es die<br />
demokratischen Verfahren selbst, die unter Voraussetzung der gleichmäßigen<br />
politischen Autonomie aller Bürger Legitimität erzeugen.<br />
Allerdings räumt auch Habermas ein, dass die Autarkie des demokratischen<br />
Rechtsstaates diesen, hinsichtlich sowohl seiner kognitiven wie seiner motivationalen<br />
Ressourcen, nicht davor bewahren kann, von außen in Gefahr zu geraten. Trotz der<br />
eigenständigen Rechtfertigungsfähigkeit der Demokratie bleiben Habermas Zweifel<br />
daran, ob es dem pluralistischen Gemeinwesen gelingen kann, sich jenseits von bloß<br />
formalen Verfahren und Prinzipien normativ selbst zu stabilisieren, d.h. einen<br />
motivationalen Konsens seiner Bürger zu schaffen. Von diesen werde als den<br />
Mitgliedern eines demokratischen Verfassungsstaates anspruchsvoll erwartet, sich<br />
als Autoren und Adressaten des Rechts zugleich zu verstehen und am Gemeinwohl<br />
zu orientieren. Das Wahlrecht im Interesse des Gemeinwesens wahrzunehmen oder<br />
<strong>für</strong> fremde Mitbürger und die Allgemeinheit einzustehen, erfordere jedoch eine<br />
Motivation, die sich nicht schon aus dem rationalen Eigeninteresse von Individuen<br />
innerhalb einer Gesellschaft ergibt. 66 Die Solidarität der Bürger untereinander und mit<br />
dem Gemeinwesen als Ganzem sieht Habermas jedoch durch die Entwicklungen<br />
einer entgleisenden Modernisierung und Säkularisierung der Gesellschaft<br />
gefährdet: 67<br />
Deshalb sind politische Tugenden, auch wenn sie nur in kleiner Münze<br />
‚erhoben’ werden, <strong>für</strong> den Bestand einer Demokratie wesentlich. Sie sind<br />
Sache der Sozialisation und der Eingewöhnung in die Praktiken und<br />
65<br />
Vgl. Habermas 1999a.<br />
66<br />
Vgl. Habermas 2007, S. 22-24.<br />
67<br />
Vgl. Habermas 2007, S. 16f.<br />
26