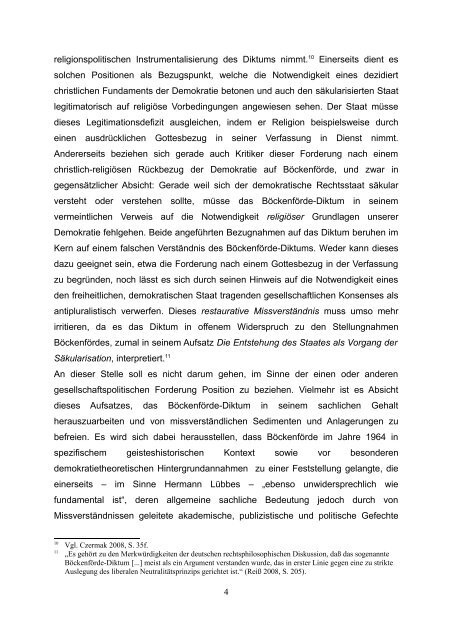Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eligionspolitischen Instrumentalisierung des Diktums nimmt. 10 Einerseits dient es<br />
solchen Positionen als Bezugspunkt, welche die Notwendigkeit eines dezidiert<br />
christlichen Fundaments der Demokratie betonen und auch den säkularisierten Staat<br />
legitimatorisch auf religiöse Vorbedingungen angewiesen sehen. Der Staat müsse<br />
dieses Legitimationsdefizit ausgleichen, indem er Religion beispielsweise durch<br />
einen ausdrücklichen Gottesbezug in seiner Verfassung in Dienst nimmt.<br />
Andererseits beziehen sich gerade auch Kritiker dieser Forderung nach einem<br />
christlich-religiösen Rückbezug der Demokratie auf Böckenförde, und zwar in<br />
gegensätzlicher Absicht: Gerade weil sich der demokratische Rechtsstaat säkular<br />
versteht oder verstehen sollte, müsse das Böckenförde-Diktum in seinem<br />
vermeintlichen Verweis auf die Notwendigkeit religiöser Grundlagen unserer<br />
Demokratie fehlgehen. Beide angeführten Bezugnahmen auf das Diktum beruhen im<br />
Kern auf einem falschen Verständnis des Böckenförde-Diktums. Weder kann dieses<br />
dazu geeignet sein, etwa die Forderung nach einem Gottesbezug in der Verfassung<br />
zu begründen, noch lässt es sich durch seinen Hinweis auf die Notwendigkeit eines<br />
den freiheitlichen, demokratischen Staat tragenden gesellschaftlichen Konsenses als<br />
antipluralistisch verwerfen. Dieses restaurative Missverständnis muss umso mehr<br />
irritieren, da es das Diktum in offenem Widerspruch zu den Stellungnahmen<br />
Böckenfördes, zumal in seinem Aufsatz Die Entstehung des Staates als Vorgang der<br />
Säkularisation, interpretiert. 11<br />
An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, im Sinne der einen oder anderen<br />
gesellschaftspolitischen Forderung Position zu beziehen. Vielmehr ist es Absicht<br />
dieses Aufsatzes, das Böckenförde-Diktum in seinem sachlichen Gehalt<br />
herauszuarbeiten und von missverständlichen Sedimenten und Anlagerungen zu<br />
befreien. Es wird sich dabei herausstellen, dass Böckenförde im Jahre 1964 in<br />
spezifischem geisteshistorischen Kontext sowie vor besonderen<br />
demokratietheoretischen Hintergrundannahmen zu einer Feststellung gelangte, die<br />
einerseits – im Sinne Hermann Lübbes – „ebenso unwidersprechlich wie<br />
fundamental ist“, deren allgemeine sachliche Bedeutung jedoch durch von<br />
Missverständnissen geleitete akademische, publizistische und politische Gefechte<br />
10<br />
Vgl. Czermak 2008, S. 35f.<br />
11<br />
„Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der deutschen rechtsphilosophischen Diskussion, daß das sogenannte<br />
Böckenförde-Diktum [...] meist als ein Argument verstanden wurde, das in erster Linie gegen eine zu strikte<br />
Auslegung des liberalen Neutralitätsprinzips gerichtet ist.“ (Reiß 2008, S. 205).<br />
4