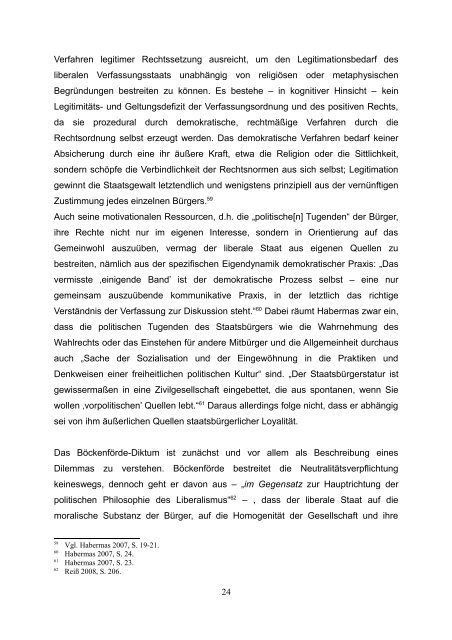Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verfahren legitimer Rechtssetzung ausreicht, um den Legitimationsbedarf des<br />
liberalen Verfassungsstaats unabhängig von religiösen oder metaphysischen<br />
Begründungen bestreiten zu können. Es bestehe – in kognitiver Hinsicht – kein<br />
Legitimitäts- und Geltungsdefizit der Verfassungsordnung und des positiven Rechts,<br />
da sie prozedural durch demokratische, rechtmäßige Verfahren durch die<br />
Rechtsordnung selbst erzeugt werden. Das demokratische Verfahren bedarf keiner<br />
Absicherung durch eine ihr äußere Kraft, etwa die Religion oder die Sittlichkeit,<br />
sondern schöpfe die Verbindlichkeit der Rechtsnormen aus sich selbst; Legitimation<br />
gewinnt die Staatsgewalt letztendlich und wenigstens prinzipiell aus der vernünftigen<br />
Zustimmung jedes einzelnen Bürgers. 59<br />
Auch seine motivationalen Ressourcen, d.h. die „politische[n] Tugenden“ der Bürger,<br />
ihre Rechte nicht nur im eigenen Interesse, sondern in Orientierung auf das<br />
Gemeinwohl auszuüben, vermag der liberale Staat aus eigenen Quellen zu<br />
bestreiten, nämlich aus der spezifischen Eigendynamik demokratischer Praxis: „Das<br />
vermisste ‚einigende Band’ ist der demokratische Prozess selbst – eine nur<br />
gemeinsam auszuübende kommunikative Praxis, in der letztlich das richtige<br />
Verständnis der Verfassung zur Diskussion steht.“ 60 Dabei räumt Habermas zwar ein,<br />
dass die politischen Tugenden des Staatsbürgers wie die Wahrnehmung des<br />
Wahlrechts oder das Einstehen <strong>für</strong> andere Mitbürger und die Allgemeinheit durchaus<br />
auch „Sache der Sozialisation und der Eingewöhnung in die Praktiken und<br />
Denkweisen einer freiheitlichen politischen Kultur“ sind. „Der Staatsbürgerstatur ist<br />
gewissermaßen in eine Zivilgesellschaft eingebettet, die aus spontanen, wenn Sie<br />
wollen ‚vorpolitischen’ Quellen lebt.“ 61 Daraus allerdings folge nicht, dass er abhängig<br />
sei von ihm äußerlichen Quellen staatsbürgerlicher Loyalität.<br />
Das Böckenförde-Diktum ist zunächst und vor allem als Beschreibung eines<br />
Dilemmas zu verstehen. Böckenförde bestreitet die Neutralitätsverpflichtung<br />
keineswegs, dennoch geht er davon aus – „im Gegensatz zur Hauptrichtung der<br />
politischen Philosophie des Liberalismus“ 62 – , dass der liberale Staat auf die<br />
moralische Substanz der Bürger, auf die Homogenität der Gesellschaft und ihre<br />
59<br />
Vgl. Habermas 2007, S. 19-21.<br />
60<br />
Habermas 2007, S. 24.<br />
61<br />
Habermas 2007, S. 23.<br />
62<br />
Reiß 2008, S. 206.<br />
24