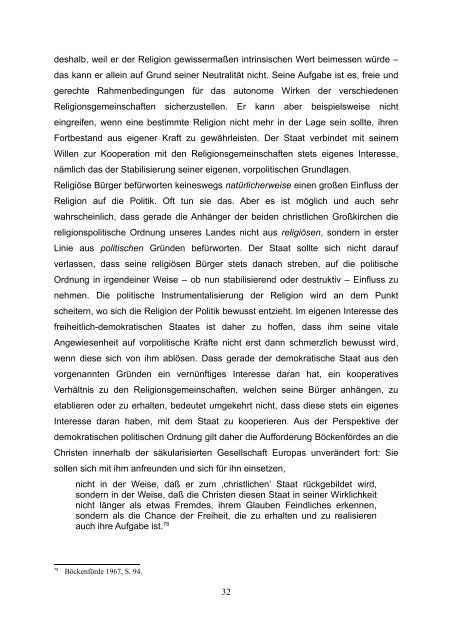Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
deshalb, weil er der Religion gewissermaßen intrinsischen Wert beimessen würde –<br />
das kann er allein auf Grund seiner Neutralität nicht. Seine Aufgabe ist es, freie und<br />
gerechte Rahmenbedingungen <strong>für</strong> das autonome Wirken der verschiedenen<br />
Religionsgemeinschaften sicherzustellen. Er kann aber beispielsweise nicht<br />
eingreifen, wenn eine bestimmte Religion nicht mehr in der Lage sein sollte, ihren<br />
Fortbestand aus eigener Kraft zu gewährleisten. Der Staat verbindet mit seinem<br />
Willen zur Kooperation mit den Religionsgemeinschaften stets eigenes Interesse,<br />
nämlich das der Stabilisierung seiner eigenen, vorpolitischen Grundlagen.<br />
Religiöse Bürger be<strong>für</strong>worten keineswegs natürlicherweise einen großen Einfluss der<br />
Religion auf die Politik. Oft tun sie das. Aber es ist möglich und auch sehr<br />
wahrscheinlich, dass gerade die Anhänger der beiden christlichen Großkirchen die<br />
religionspolitische Ordnung unseres Landes nicht aus religiösen, sondern in erster<br />
Linie aus politischen Gründen be<strong>für</strong>worten. Der Staat sollte sich nicht darauf<br />
verlassen, dass seine religiösen Bürger stets danach streben, auf die politische<br />
Ordnung in irgendeiner Weise – ob nun stabilisierend oder destruktiv – Einfluss zu<br />
nehmen. Die politische Instrumentalisierung der Religion wird an dem Punkt<br />
scheitern, wo sich die Religion der Politik bewusst entzieht. Im eigenen Interesse des<br />
freiheitlich-demokratischen Staates ist daher zu hoffen, dass ihm seine vitale<br />
Angewiesenheit auf vorpolitische Kräfte nicht erst dann schmerzlich bewusst wird,<br />
wenn diese sich von ihm ablösen. Dass gerade der demokratische Staat aus den<br />
vorgenannten Gründen ein vernünftiges Interesse daran hat, ein kooperatives<br />
Verhältnis zu den Religionsgemeinschaften, welchen seine Bürger anhängen, zu<br />
etablieren oder zu erhalten, bedeutet umgekehrt nicht, dass diese stets ein eigenes<br />
Interesse daran haben, mit dem Staat zu kooperieren. Aus der Perspektive der<br />
demokratischen politischen Ordnung gilt daher die Aufforderung Böckenfördes an die<br />
Christen innerhalb der säkularisierten Gesellschaft Europas unverändert fort: Sie<br />
sollen sich mit ihm anfreunden und sich <strong>für</strong> ihn einsetzen,<br />
nicht in der Weise, daß er zum ‚christlichen’ Staat rückgebildet wird,<br />
sondern in der Weise, daß die Christen diesen Staat in seiner Wirklichkeit<br />
nicht länger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches erkennen,<br />
sondern als die Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu realisieren<br />
auch ihre Aufgabe ist. 78<br />
78<br />
Böckenförde 1967, S. 94.<br />
32