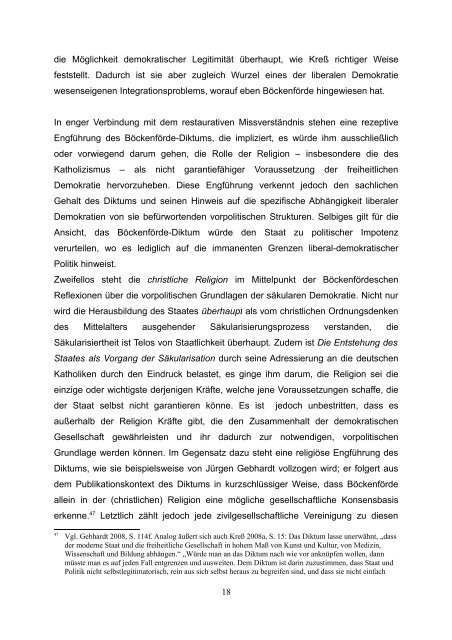Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Martin Ingenfeld - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Möglichkeit demokratischer Legitimität überhaupt, wie Kreß richtiger Weise<br />
feststellt. Dadurch ist sie aber zugleich Wurzel eines der liberalen Demokratie<br />
wesenseigenen Integrationsproblems, worauf eben Böckenförde hingewiesen hat.<br />
In enger Verbindung mit dem restaurativen Missverständnis stehen eine rezeptive<br />
Engführung des Böckenförde-Diktums, die impliziert, es würde ihm ausschließlich<br />
oder vorwiegend darum gehen, die Rolle der Religion – insbesondere die des<br />
Katholizismus – als nicht garantiefähiger Voraussetzung der freiheitlichen<br />
Demokratie hervorzuheben. Diese Engführung verkennt jedoch den sachlichen<br />
Gehalt des Diktums und seinen Hinweis auf die spezifische Abhängigkeit liberaler<br />
Demokratien von sie be<strong>für</strong>wortenden vorpolitischen Strukturen. Selbiges gilt <strong>für</strong> die<br />
Ansicht, das Böckenförde-Diktum würde den Staat zu politischer Impotenz<br />
verurteilen, wo es lediglich auf die immanenten Grenzen liberal-demokratischer<br />
Politik hinweist.<br />
Zweifellos steht die christliche Religion im Mittelpunkt der Böckenfördeschen<br />
Reflexionen über die vorpolitischen Grundlagen der säkularen Demokratie. Nicht nur<br />
wird die Herausbildung des Staates überhaupt als vom christlichen Ordnungsdenken<br />
des Mittelalters ausgehender Säkularisierungsprozess verstanden, die<br />
Säkularisiertheit ist Telos von Staatlichkeit überhaupt. Zudem ist Die Entstehung des<br />
Staates als Vorgang der Säkularisation durch seine Adressierung an die deutschen<br />
Katholiken durch den Eindruck belastet, es ginge ihm darum, die Religion sei die<br />
einzige oder wichtigste derjenigen Kräfte, welche jene Voraussetzungen schaffe, die<br />
der Staat selbst nicht garantieren könne. Es ist<br />
jedoch unbestritten, dass es<br />
außerhalb der Religion Kräfte gibt, die den Zusammenhalt der demokratischen<br />
Gesellschaft gewährleisten und ihr dadurch zur notwendigen, vorpolitischen<br />
Grundlage werden können. Im Gegensatz dazu steht eine religiöse Engführung des<br />
Diktums, wie sie beispielsweise von Jürgen Gebhardt vollzogen wird; er folgert aus<br />
dem Publikationskontext des Diktums in kurzschlüssiger Weise, dass Böckenförde<br />
allein in der (christlichen) Religion eine mögliche gesellschaftliche Konsensbasis<br />
erkenne. 47 Letztlich zählt jedoch jede zivilgesellschaftliche Vereinigung zu diesen<br />
47<br />
Vgl. Gebhardt 2008, S. 114f. Analog äußert sich auch Kreß 2008a, S. 15: Das Diktum lasse unerwähnt, „dass<br />
der moderne Staat und die freiheitliche Gesellschaft in hohem Maß von Kunst und Kultur, von Medizin,<br />
Wissenschaft und Bildung abhängen.“ „Würde man an das Diktum nach wie vor anknüpfen wollen, dann<br />
müsste man es auf jeden Fall entgrenzen und ausweiten. Dem Diktum ist darin zuzustimmen, dass Staat und<br />
Politik nicht selbstlegitimatorisch, rein aus sich selbst heraus zu begreifen sind, und dass sie nicht einfach<br />
18