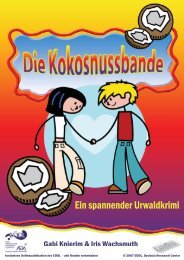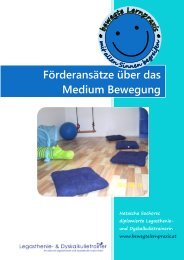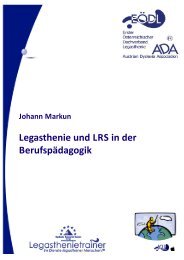DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
langsam. Dies hat zur Folge, dass legasthene Kinder nicht nur Probleme mit dem Lesen von<br />
Wörtern haben, sondern, dass es ihnen auch schwer fällt bzw. sie längere Zeit benötigen, um Wörter<br />
abzurufen, Dinge zu bezeichnen oder Zahlen, Farben oder Ähnliches zu benennen. Durch ähnliche<br />
Schwierigkeiten beim Benennen von Items und beim Lesen von bekannten Wörtern geht man<br />
davon aus, dass das Problem in der „schnellen, automatischen kognitiven Verarbeitung“ (vgl.<br />
Bowers&Wolf, 1992; Nicolson&Fawcett, 1990; Spring&Davis, 1988; Wolf, 1991; in Landerl,<br />
1996: 23) liegt.<br />
4.3 Exkurs: Stadien <strong>des</strong> Lese- und Rechtschreiberwerbs (Lesemodell von Frith, 1985,<br />
1986)<br />
In Zusammenhang mit der oben erwähnten sprachlichen Informationsverarbeitung möchte ich kurz<br />
den allgemeinen Prozess <strong>des</strong> Erwerbs der Lese- und Rechtschreibfähigkeit skizzieren. Dieser<br />
Prozess durchläuft insgesamt drei Stadien und beginnt mit dem logographischen Stadium, bei<br />
welchem Kinder Wörter aufgrund ihrer visuellen Merkmale erkennen bzw. unterscheiden können.<br />
Daraufhin folgt das alphabetische Stadium, bei dem es erstmals zum phonetischen Rekodieren<br />
kommt, was bedeutet, dass ein Wort Graphem <strong>für</strong> Graphem erlesen wird. Dadurch werden die<br />
Regelmäßigkeiten in der Graphem-Phonem-Zuordnung erlernt. Dem Kind ist es nun auch möglich<br />
unbekannte Wörter zu lesen. Das abschließende Stadium wird als orthographisches Stadium<br />
bezeichnet. Mit der Zeit bildet der Lerner einer Sprache mit Hilfe der rekodierten Wörter ein<br />
orthographisches Lexikon aus, in welchem die bereits bekannten Wörter gespeichert sind. So ist es<br />
nicht mehr nötig, je<strong>des</strong> Wort von neuem zu rekodieren, da man nun in der Lage ist, die Wörter<br />
direkt aus dem Gedächtnis abzurufen. Dies spart Zeit und ermöglicht flüssiges Lesen (vgl. Morton<br />
1989, in Ramus, in Gazzaniga, 2004: 816; vgl. Sölter, 2001; vgl. Klicpera et al., 2003: 25;<br />
Lesemodell von Ehri und Frith, 1985, 1986).<br />
4.4 Visuelle Defizite<br />
Man nimmt heute eher Abstand von der Hypothese, dass Fehler in der visuellen Wahrnehmung<br />
grundlegend <strong>für</strong> eine Legasthenie sind (vgl. Ramus in Gazzaniga, 2004: 819). Liberman et al.<br />
(1971; vgl. in Landerl, 1996: 19) führten zu diesem Thema eine eindrucksvolle Studie durch und<br />
kamen zu dem Ergebnis, dass Kinder eher jene Konsonanten verwechseln, welche phonetisch<br />
ähnlich sind ({d}-{t}; {g}-{k}), als solche, die ähnlich aussehen ({m}-{w}; {n}-{u}). Bei<br />
phonetisch und visuell ähnlichen Buchstaben treten wiederum am häufigsten Probleme auf (vgl.<br />
Cossu, Shankweiler, Liberman&Gugliotta, 1993; in Landerl, 1996: 19).<br />
4.5 Interaktion der verschiedenen Sinnesmodalitäten