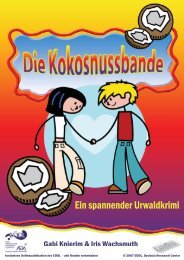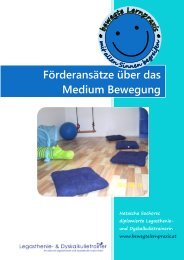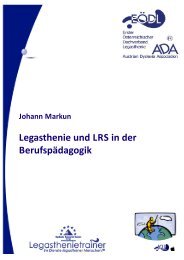DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
DANKSAGUNG - Bücher für diplomierte Legasthenietrainer des EÖDL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erst nach einer eingehenden Phase <strong>des</strong> Einhörens empfiehlt Sambanis mit dem Sprechen zu<br />
beginnen. Dies sollte sich in Form von Spielen und in der Gruppe vollziehen, bei denen die Kinder<br />
die Gelegenheit haben, ohne Zwang die neue Sprache auszuprobieren. Je<strong>des</strong> Kind soll selbst<br />
entscheiden dürfen, wann es zu sprechen beginnt und darf auf keinen Fall dazu gedrängt werden<br />
(vgl. Sambanis in Schulte-Körne, 2002: 210). Auch beim Erwerb der Muttersprache beginnen<br />
einige Kleinkinder früher, andere später, zu sprechen. Die Phase <strong>des</strong> Einhörens ist also individuell<br />
unterschiedlich lang und sollte respektiert werden.<br />
Erst viel später kommt schließlich das Lesen an die Reihe. Wenn Kinder eine angemessen lange<br />
Phase <strong>des</strong> Zuhörens und Sprechens absolviert haben, wird ihnen dies beim Lesen zugute kommen,<br />
da sie Wörter wieder erkennen werden und ganz von selbst eine erste Einsicht in die<br />
unterschiedlichen Phonem-Graphem-Zusammenhänge bekommen. Es stellt <strong>für</strong> sie eine enorme<br />
Erleichterung dar, wenn sie sich beim Lesen ausschließlich auf das Wortbild konzentrieren, da der<br />
Wortklang und die Bedeutung schon bekannt sind und sich bereits eingeprägt haben. Erst als letzter<br />
Schritt soll sich an das Schreiben herangewagt werden (vgl. Sambanis in Schulte-Körne, 2002:<br />
211). Die genannte Vorgehensweise ähnelt jener beim Erwerb der Muttersprache stark. Zuerst<br />
hören die Kinder die Sprache, dann beginnen sie zu sprechen. Wenn sie bezüglich <strong>des</strong> Wortklanges<br />
und der Wortbedeutung schon kleine Experten sind, erlernen sie in der Schule die dazugehörigen<br />
Wortbilder. Die große Schwierigkeit beim Fremdsprachenerwerb ist, dass die Kinder hierbei<br />
sowohl den Wortklang als auch das Wortbild und die Wortbedeutung gleichzeitig erlernen müssen,<br />
was vor allem zu Beginn sehr verwirrend sein kann. Dies gilt besonders <strong>für</strong> Englisch, da sich hier<br />
vor allem die Komponenten Wortklang und Wortbild zusätzlich meist stark unterscheiden. Diese<br />
Art <strong>des</strong> Fremdspracherwerbs ist prinzipiell sehr zu empfehlen. In Bezug auf legasthene Kinder ist es<br />
aber nicht möglich, ein <strong>für</strong> alle optimales Konzept diesbezüglich zu erstellen, da sich jede<br />
Legasthenie stark von anderen unterscheiden kann. Für Kinder mit Problemen im akustischen<br />
Bereich wird das anfängliche Einhören in die Sprache und das anschließende Sprechen<br />
problematische sein. Für Kinder mit Problemen im optischen Bereich wird sich das Lesen und<br />
Schreiben schwierig gestalten. Ideal, aber in der Realität kaum umsetzbar, wäre es, je<strong>des</strong> Kind je<br />
nach ihren/seinen Stärken und Schwächen individuell zu fördern. Dies gilt <strong>für</strong> Legastheniker<br />
gleichermaßen wie <strong>für</strong> Nichtlegastheniker. Wie diese Art <strong>des</strong> legasthenikergerechten Unterrichts<br />
aussehen kann werde ich im Kapitel Legasthenikerförderung in der Schule vorstellen.<br />
Grundsätzlich ist bezüglich <strong>des</strong> (Fremd-)spracherwerbs zu sagen, dass alle Lerninhalte in nicht zu<br />
großen Zeitabständen genügend oft wiederholt werden müssen. Es kann passieren, dass die<br />
Unterrichtsstunden sehr weit auseinanderliegen und die Neuronenverbindungen, welche im