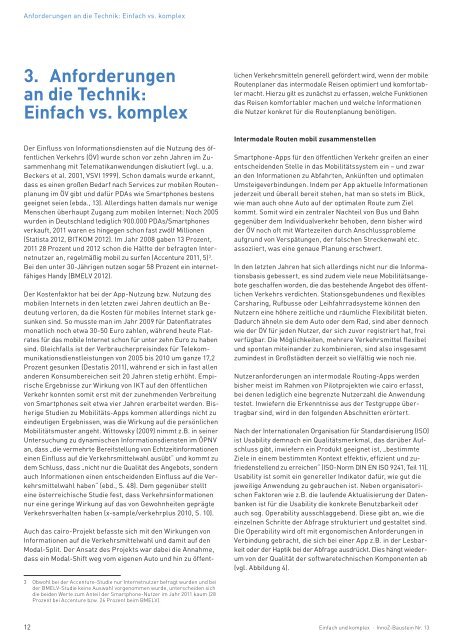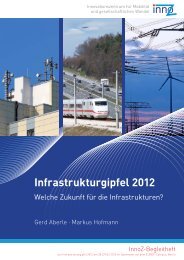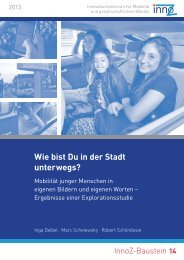Download - InnoZ
Download - InnoZ
Download - InnoZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anforderungen an die Technik: Einfach vs. komplex<br />
3. Anforderungen<br />
an die Technik:<br />
Einfach vs. komplex<br />
Der Einfluss von Informationsdiensten auf die Nutzung des öffentlichen<br />
Verkehrs (ÖV) wurde schon vor zehn Jahren im Zusammenhang<br />
mit Telematikanwendungen diskutiert (vgl. u.a.<br />
Beckers et al. 2001, VSVI 1999). Schon damals wurde erkannt,<br />
dass es einen großen Bedarf nach Services zur mobilen Routenplanung<br />
im ÖV gibt und dafür PDAs wie Smartphones bestens<br />
geeignet seien (ebda., 13). Allerdings hatten damals nur wenige<br />
Menschen überhaupt Zugang zum mobilen Internet: Noch 2005<br />
wurden in Deutschland lediglich 900.000 PDAs/Smartphones<br />
verkauft, 2011 waren es hingegen schon fast zwölf Millionen<br />
(Statista 2012, BITKOM 2012). Im Jahr 2008 gaben 13 Prozent,<br />
2011 28 Prozent und 2012 schon die Hälfte der befragten Internetnutzer<br />
an, regelmäßig mobil zu surfen (Accenture 2011, 5) 3 .<br />
Bei den unter 30-Jährigen nutzen sogar 58 Prozent ein internetfähiges<br />
Handy (BMELV 2012).<br />
Der Kostenfaktor hat bei der App-Nutzung bzw. Nutzung des<br />
mobilen Internets in den letzten zwei Jahren deutlich an Bedeutung<br />
verloren, da die Kosten für mobiles Internet stark gesunken<br />
sind. So musste man im Jahr 2009 für Datenflatrates<br />
monatlich noch etwa 30-50 Euro zahlen, während heute Flatrates<br />
für das mobile Internet schon für unter zehn Euro zu haben<br />
sind. Gleichfalls ist der Verbraucherpreisindex für Telekommunikationsdienstleistungen<br />
von 2005 bis 2010 um ganze 17,2<br />
Prozent gesunken (Destatis 2011), während er sich in fast allen<br />
anderen Konsumbereichen seit 20 Jahren stetig erhöht. Empirische<br />
Ergebnisse zur Wirkung von IKT auf den öffentlichen<br />
Verkehr konnten somit erst mit der zunehmenden Verbreitung<br />
von Smartphones seit etwa vier Jahren erarbeitet werden. Bisherige<br />
Studien zu Mobilitäts-Apps kommen allerdings nicht zu<br />
eindeutigen Ergebnissen, was die Wirkung auf die persönlichen<br />
Mobilitätsmuster angeht. Wittowsky (2009) nimmt z.B. in seiner<br />
Untersuchung zu dynamischen Informationsdiensten im ÖPNV<br />
an, dass „die vermehrte Bereitstellung von Echtzeitinformationen<br />
einen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl ausübt“ und kommt zu<br />
dem Schluss, dass „nicht nur die Qualität des Angebots, sondern<br />
auch Informationen einen entscheidenden Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl<br />
haben“ (ebd., S. 48). Dem gegenüber stellt<br />
eine österreichische Studie fest, dass Verkehrsinformationen<br />
nur eine geringe Wirkung auf das von Gewohnheiten geprägte<br />
Verkehrsverhalten haben (x-sample/verkehrplus 2010, S. 10).<br />
Auch das cairo-Projekt befasste sich mit den Wirkungen von<br />
Informationen auf die Verkehrsmittelwahl und damit auf den<br />
Modal-Split. Der Ansatz des Projekts war dabei die Annahme,<br />
dass ein Modal-Shift weg vom eigenen Auto und hin zu öffent-<br />
lichen Verkehrsmitteln generell gefördert wird, wenn der mobile<br />
Routenplaner das intermodale Reisen optimiert und komfortabler<br />
macht. Hierzu gilt es zunächst zu erfassen, welche Funktionen<br />
das Reisen komfortabler machen und welche Informationen<br />
die Nutzer konkret für die Routenplanung benötigen.<br />
Intermodale Routen mobil zusammenstellen<br />
Smartphone-Apps für den öffentlichen Verkehr greifen an einer<br />
entscheidenden Stelle in das Mobilitätssystem ein – und zwar<br />
an den Informationen zu Abfahrten, Ankünften und optimalen<br />
Umsteigeverbindungen. Indem per App aktuelle Informationen<br />
jederzeit und überall bereit stehen, hat man so stets im Blick,<br />
wie man auch ohne Auto auf der optimalen Route zum Ziel<br />
kommt. Somit wird ein zentraler Nachteil von Bus und Bahn<br />
gegenüber dem Individualverkehr behoben, denn bisher wird<br />
der ÖV noch oft mit Wartezeiten durch Anschlussprobleme<br />
aufgrund von Verspätungen, der falschen Streckenwahl etc.<br />
assoziiert, was eine genaue Planung erschwert.<br />
In den letzten Jahren hat sich allerdings nicht nur die Informationsbasis<br />
gebessert, es sind zudem viele neue Mobilitätsangebote<br />
geschaffen worden, die das bestehende Angebot des öffentlichen<br />
Verkehrs verdichten. Stationsgebundenes und flexibles<br />
Carsharing, Rufbusse oder Leihfahrradsysteme können den<br />
Nutzern eine höhere zeitliche und räumliche Flexibilität bieten.<br />
Dadurch ähneln sie dem Auto oder dem Rad, sind aber dennoch<br />
wie der ÖV für jeden Nutzer, der sich zuvor registriert hat, frei<br />
verfügbar. Die Möglichkeiten, mehrere Verkehrsmittel flexibel<br />
und spontan miteinander zu kombinieren, sind also insgesamt<br />
zumindest in Großstädten derzeit so vielfältig wie noch nie.<br />
Nutzeranforderungen an intermodale Routing-Apps werden<br />
bisher meist im Rahmen von Pilotprojekten wie cairo erfasst,<br />
bei denen lediglich eine begrenzte Nutzerzahl die Anwendung<br />
testet. Inwiefern die Erkenntnisse aus der Testgruppe übertragbar<br />
sind, wird in den folgenden Abschnitten erörtert.<br />
Nach der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO)<br />
ist Usability demnach ein Qualitätsmerkmal, das darüber Aufschluss<br />
gibt, inwiefern ein Produkt geeignet ist, „bestimmte<br />
Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend<br />
zu erreichen“ (ISO-Norm DIN EN ISO 9241, Teil 11).<br />
Usability ist somit ein genereller Indikator dafür, wie gut die<br />
jeweilige Anwendung zu gebrauchen ist. Neben organisatorischen<br />
Faktoren wie z.B. die laufende Aktualisierung der Datenbanken<br />
ist für die Usability die konkrete Benutzbarkeit oder<br />
auch sog. Operability ausschlaggebend. Diese gibt an, wie die<br />
einzelnen Schritte der Abfrage strukturiert und gestaltet sind.<br />
Die Operability wird oft mit ergonomischen Anforderungen in<br />
Verbindung gebracht, die sich bei einer App z.B. in der Lesbarkeit<br />
oder der Haptik bei der Abfrage ausdrückt. Dies hängt wiede r-<br />
um von der Qualität der softwaretechnischen Komponenten ab<br />
(vgl. Abbildung 4).<br />
3 Obwohl bei der Accenture-Studie nur Internetnutzer befragt wurden und bei<br />
der BMELV-Studie keine Auswahl vorgenommen wurde, unterscheiden sich<br />
die beiden Werte zum Anteil der Smartphone-Nutzer im Jahr 2011 kaum (28<br />
Prozent bei Accenture bzw. 26 Prozent beim BMELV).<br />
12 Einfach und komplex · <strong>InnoZ</strong>-Baustein Nr. 13