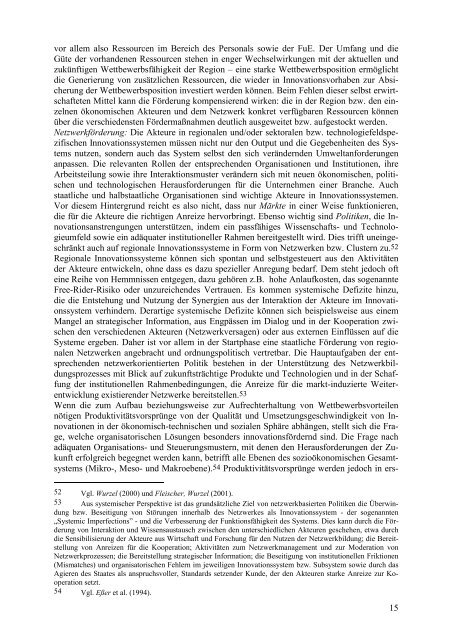Wolfgang Scholl und Ulrich G. Wurzel ... - DIW Berlin
Wolfgang Scholl und Ulrich G. Wurzel ... - DIW Berlin
Wolfgang Scholl und Ulrich G. Wurzel ... - DIW Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
vor allem also Ressourcen im Bereich des Personals sowie der FuE. Der Umfang <strong>und</strong> die<br />
Güte der vorhandenen Ressourcen stehen in enger Wechselwirkungen mit der aktuellen <strong>und</strong><br />
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Region – eine starke Wettbewerbsposition ermöglicht<br />
die Generierung von zusätzlichen Ressourcen, die wieder in Innovationsvorhaben zur Absicherung<br />
der Wettbewerbsposition investiert werden können. Beim Fehlen dieser selbst erwirtschafteten<br />
Mittel kann die Förderung kompensierend wirken: die in der Region bzw. den einzelnen<br />
ökonomischen Akteuren <strong>und</strong> dem Netzwerk konkret verfügbaren Ressourcen können<br />
über die verschiedensten Fördermaßnahmen deutlich ausgeweitet bzw. aufgestockt werden.<br />
Netzwerkförderung: Die Akteure in regionalen <strong>und</strong>/oder sektoralen bzw. technologiefeldspezifischen<br />
Innovationssystemen müssen nicht nur den Output <strong>und</strong> die Gegebenheiten des Systems<br />
nutzen, sondern auch das System selbst den sich verändernden Umweltanforderungen<br />
anpassen. Die relevanten Rollen der entsprechenden Organisationen <strong>und</strong> Institutionen, ihre<br />
Arbeitsteilung sowie ihre Interaktionsmuster verändern sich mit neuen ökonomischen, politischen<br />
<strong>und</strong> technologischen Herausforderungen für die Unternehmen einer Branche. Auch<br />
staatliche <strong>und</strong> halbstaatliche Organisationen sind wichtige Akteure in Innovationssystemen.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> reicht es also nicht, dass nur Märkte in einer Weise funktionieren,<br />
die für die Akteure die richtigen Anreize hervorbringt. Ebenso wichtig sind Politiken, die Innovationsanstrengungen<br />
unterstützen, indem ein passfähiges Wissenschafts- <strong>und</strong> Technologieumfeld<br />
sowie ein adäquater institutioneller Rahmen bereitgestellt wird. Dies trifft uneingeschränkt<br />
auch auf regionale Innovationssysteme in Form von Netzwerken bzw. Clustern zu.52<br />
Regionale Innovationssysteme können sich spontan <strong>und</strong> selbstgesteuert aus den Aktivitäten<br />
der Akteure entwickeln, ohne dass es dazu spezieller Anregung bedarf. Dem steht jedoch oft<br />
eine Reihe von Hemmnissen entgegen, dazu gehören z.B. hohe Anlaufkosten, das sogenannte<br />
Free-Rider-Risiko oder unzureichendes Vertrauen. Es kommen systemische Defizite hinzu,<br />
die die Entstehung <strong>und</strong> Nutzung der Synergien aus der Interaktion der Akteure im Innovationssystem<br />
verhindern. Derartige systemische Defizite können sich beispielsweise aus einem<br />
Mangel an strategischer Information, aus Engpässen im Dialog <strong>und</strong> in der Kooperation zwischen<br />
den verschiedenen Akteuren (Netzwerkversagen) oder aus externen Einflüssen auf die<br />
Systeme ergeben. Daher ist vor allem in der Startphase eine staatliche Förderung von regionalen<br />
Netzwerken angebracht <strong>und</strong> ordnungspolitisch vertretbar. Die Hauptaufgaben der entsprechenden<br />
netzwerkorientierten Politik bestehen in der Unterstützung des Netzwerkbildungsprozesses<br />
mit Blick auf zukunftsträchtige Produkte <strong>und</strong> Technologien <strong>und</strong> in der Schaffung<br />
der institutionellen Rahmenbedingungen, die Anreize für die markt-induzierte Weiterentwicklung<br />
existierender Netzwerke bereitstellen.53<br />
Wenn die zum Aufbau beziehungsweise zur Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen<br />
nötigen Produktivitätsvorsprünge von der Qualität <strong>und</strong> Umsetzungsgeschwindigkeit von Innovationen<br />
in der ökonomisch-technischen <strong>und</strong> sozialen Sphäre abhängen, stellt sich die Frage,<br />
welche organisatorischen Lösungen besonders innovationsfördernd sind. Die Frage nach<br />
adäquaten Organisations- <strong>und</strong> Steuerungsmustern, mit denen den Herausforderungen der Zukunft<br />
erfolgreich begegnet werden kann, betrifft alle Ebenen des sozioökonomischen Gesamtsystems<br />
(Mikro-, Meso- <strong>und</strong> Makroebene).54 Produktivitätsvorsprünge werden jedoch in ers-<br />
52 Vgl. <strong>Wurzel</strong> (2000) <strong>und</strong> Fleischer, <strong>Wurzel</strong> (2001).<br />
53 Aus systemischer Perspektive ist das gr<strong>und</strong>sätzliche Ziel von netzwerkbasierten Politiken die Überwindung<br />
bzw. Beseitigung von Störungen innerhalb des Netzwerkes als Innovationssystem - der sogenannten<br />
„Systemic Imperfections” - <strong>und</strong> die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Systems. Dies kann durch die Förderung<br />
von Interaktion <strong>und</strong> Wissensaustausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren geschehen, etwa durch<br />
die Sensibilisierung der Akteure aus Wirtschaft <strong>und</strong> Forschung für den Nutzen der Netzwerkbildung; die Bereitstellung<br />
von Anreizen für die Kooperation; Aktivitäten zum Netzwerkmanagement <strong>und</strong> zur Moderation von<br />
Netzwerkprozessen; die Bereitstellung strategischer Information; die Beseitigung von institutionellen Friktionen<br />
(Mismatches) <strong>und</strong> organisatorischen Fehlern im jeweiligen Innovationssystem bzw. Subsystem sowie durch das<br />
Agieren des Staates als anspruchsvoller, Standards setzender K<strong>und</strong>e, der den Akteuren starke Anreize zur Kooperation<br />
setzt.<br />
54 Vgl. Eßer et al. (1994).<br />
15